Rechtstext und Textarbeit
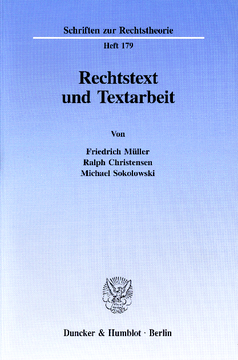
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Rechtstext und Textarbeit
Müller, Friedrich | Christensen, Ralph | Sokolowski, Michael
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 179
(1997)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Der Anfang liegt mitten in den Texten | 15 | ||
| I. Rechtstext: Der Rechtstext ist nicht Behälter der Rechtsnorm, sondern Durchzugsgebiet konkurrierender Interpretationen | 19 | ||
| 1. Für den Positivismus bildet die objektivierbare Bedeutung die Brücke zwischen der Geltung des Gesetzes und der Rechtfertigung juristischen Handelns | 19 | ||
| 1.1 Der Normtext repräsentiert die Rechtsnorm | 19 | ||
| 1.2 Die juristische Textarbeit wird auf einen Erkenntnisvorgang eingeschränkt | 21 | ||
| 1.3 Der Richter ist gerechtfertigt, soweit er die im Text verlorene Präsenz der Rechtsnorm wiederherstellt | 22 | ||
| 2. Die sprachliche Bedeutung ist mit dieser Rolle überfordert | 22 | ||
| 2.1 Die Sprachtheorie der Juristen ist von Legitimationsbedürfnissen bestimmt | 22 | ||
| 2.2 Die sprachliche Ordnung kann die Erwartungen der Juristen nicht erfüllen | 25 | ||
| 2.3 Legitimation ergibt sich nicht aus der Sprachtheorie, sondern allenfalls in der Sprachpraxis | 26 | ||
| 3. Geltung, Bedeutung und Rechtfertigung sind als Probleme voneinander zu trennen | 29 | ||
| 3.1 Die sprachliche Bedeutung ist dem juristischen Handeln nicht vorgeordnet | 30 | ||
| 3.2 Das juristische Handeln ist eine semantische Praxis | 31 | ||
| 3.3 Der Normtext hat am Beginn juristischer Textarbeit nicht schon Bedeutung, sondern nur Geltung | 32 | ||
| II. Textarbeit: Der Richter ist nicht der Mund des Gesetzes, sondern Konstrukteur der Rechtsnorm | 37 | ||
| 1. Die Praxis der Rechtserzeugung hat ihren Sinn in der Semantik des Kampfs um die Bedeutung des Gesetzes | 38 | ||
| 1.1 Der Richter trifft auf die ursprüngliche Gewalt des Konflikts und kommt für eine Rechtsfindung zu spät | 39 | ||
| 1.2 Der Richter zwingt den Konflikt in die Sprache und wendet ihn zu einem Kampf ums Recht | 55 | ||
| 1.3 Der semantische Kampf um die Bedeutung des Gesetzestextes ist symbolische Gewalt und bringt das Recht zur Sprache | 59 | ||
| 2. Das Gesetz ist nicht Gegenstand einer Rechtserkenntnis, sondern Arena für den Kampf um das Recht im Raum der Sprache | 68 | ||
| 2.1 In der semantischen Praxis sind Sprache und Sprecher intern relationiert | 69 | ||
| 2.2 Zwischen Normtext als Textformular und Rechtsnorm als Textbedeutung liegt das juristische Handeln als semantische Praxis | 72 | ||
| 2.3 Die Bedeutung des Nonntextes wird nicht mechanisch angewendet oder frei erfunden, sondern durchgesetzt | 74 | ||
| 3. Der Gang vom Normtext zum Text der Rechtsnorm ist der Weg, den die Gewalt durch die Sprache nimmt | 76 | ||
| 3.1 Grund und Grundlage der Rechtserzeugung ist die Gewalt der Sprache | 77 | ||
| 3.2 Um des Rechts Herr zu werden, übt der Richter Gewalt über Text und Fall und gibt damit das Gesetz | 80 | ||
| 3.3 Mit seinem Urteil schneidet der Richter das Wort zum Konflikt ab | 94 | ||
| III. Die Textstruktur des Rechtsstaats: Von der Verleugnung zur Teilung und Kontrolle richterlicher Gewalt | 99 | ||
| 1. Die Erschwerung der Gewalt durch die Sprache begründet die Hoffnung auf das Recht | 99 | ||
| 1.1 Die Gerechtigkeit kann die Gewalt nicht in einen Metacode einbinden | 100 | ||
| 1.2 Die Wahrheit der Rechtsbehauptung hebt die Gewalt nicht auf | 104 | ||
| 1.3 Trotz seines Entscheidungscharakters ist das Recht mehr als reine Gewalt | 112 | ||
| 2. Der Rechtsstaat bildet eine Textstruktur | 116 | ||
| 2.1 Zurechnungstext ist der Normtext als „geltende" Zeichenkette | 118 | ||
| 2.2 Der Rechtfertigungstext muß den Zusammenhang von Geltung und Bedeutung begründen | 121 | ||
| 2.3 Der Anordnungstext wird mittels des Rechtfertigungszwangs in die rechtsstaatliche Textstruktur eingeschrieben | 125 | ||
| 3. Die richterliche Gewalt wird der Teilung und Kontrolle unterworfen | 127 | ||
| 3.1 Läßt sich innerhalb der juristischen Textarbeit eine Praxis der Grenze denken? | 128 | ||
| 3.1.1 Die Wortlautgrenze wird nicht von der Sprache definiert | 129 | ||
| 3.1.2 Das methodisch Mögliche ist unbegrenzt | 130 | ||
| 3.1.3 Die Grenze juristischer Textarbeit ist ihr als Praxis aufgegeben | 133 | ||
| 3.2 Die rechtsstaatliche Textstruktur erlaubt eine praktische Kritik der Legitimität richterlicher Gewalt | 138 | ||
| 3.2.1 Die Dezision mit Normtextunterstellung verletzt den gewaltenteilenden Aspekt | 139 | ||
| 3.2.2 Die Dezision durch Rechtsverbiegung verletzt den gewaltenkontrollierenden Aspekt | 144 | ||
| 3.2.3 Methodenehrlichkeit verlangt, daß auch eine richtige Entscheidung ausreichend begründet wird | 155 | ||
| 3.3 Die rechtsstaatliche Textstruktur bewirkt eine doppelte Faltung der Gewalt | 166 | ||
| 3.3.1 Die Entscheidungsgewalt wird zwischen Gesetzgeber und Richter geteilt | 166 | ||
| 3.3.2 Die Entscheidungsgewalt kann an den methodischen und verfassungsrechtlichen Vorgaben für die Rechtserzeugung kontrolliert werden | 167 | ||
| 3.3.3 Das Paradox der Gesetzesbindung liegt darin, daß sich die richterliche Gewalt selbst die Hände bindet | 169 | ||
| Das Ende liegt in einer praktischen Alternative | 173 | ||
| Literaturverzeichnis | 175 | ||
| Personenverzeichnis | 185 | ||
| Sachverzeichnis | 189 |
