Minderjährigenschutz in sozialen Netzwerken
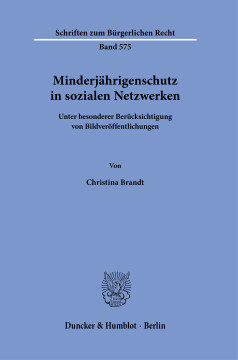
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Minderjährigenschutz in sozialen Netzwerken
Unter besonderer Berücksichtigung von Bildveröffentlichungen
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 575
(2024)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Christina Brandt studierte Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg sowie an der University of East Anglia in Norwich. Nach ihrem Studium war sie Doktorandin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung bei Prof. Dr. Christine Budzikiewicz. Während der Promotion wurde sie als Stipendiatin von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gefördert. Von Mai 2021 bis Mai 2023 absolvierte Frau Brandt ihr Rechtsreferendariat in Kassel, unter anderem mit Stationen in Frankfurt und Brüssel. Nach ihrem Referendariat war sie als Referentin für Europaangelegenheiten bei der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten in Berlin tätig.Abstract
Der Schutz Minderjähriger in den sozialen Netzwerken ist vor dem Hintergrund der stetigen Entwicklung ihrer Funktionsweisen und Nutzungsmöglichkeiten bedeutender denn je. Seit geraumer Zeit beschäftigen sich die Gerichte zunehmend mit Fragen zur Nutzung sozialer Netzwerke durch Minderjährige. Besondere Aufmerksamkeit erregten die sich über Jahre sowie über mehrere Instanzen erstreckenden Facebook-Entscheidungen zum »digitalen Nachlass« einer Minderjährigen. Die Vererbbarkeit eines Nutzeraccounts bildet nur ein Beispiel dafür, welche Rechtsfragen sich im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Netzwerke stellen. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Veröffentlichung von Bildern Minderjähriger, die entweder durch die Eltern (sog. sharenting), Dritte oder durch die Minderjährigen selbst vorgenommen werden. Die Arbeit zeigt einerseits, dass die bestehenden Normen bereits ein gutes Schutzniveau gewähren. Andererseits bedarf es neben der regulatorischen Ebene auch der Sensibilisierung der Gesellschaft für einen verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten, um mit dem Tempo des digitalen Wandels Schritt zu halten.»Protection of Minors in Social Networks. With Special Consideration of Image Publications«: The protection of minors in social networks is a particularly relevant topic in practice. The courts are increasingly dealing with issues arising from the use of social networks by minors.The inheritability of a user account is just one example of the legal issues that occurs in relation to the use of social networks. The focus of this study is on the publication of images of minors, either by parents (so-called sharenting), third parties or the minors themselves.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| A. Einleitung | 19 | ||
| I. Anlass der Untersuchung | 21 | ||
| II. Gang der Untersuchung | 24 | ||
| B. Faszination soziale Medien – Chancen und Risiken | 28 | ||
| I. Medienrealität Minderjähriger | 28 | ||
| 1. miniKIM-Studie 2020 | 29 | ||
| a) Mediennutzung der Zwei- bis Fünfjährigen | 29 | ||
| b) Medienpräsenz durch die Eltern | 30 | ||
| 2. KIM-Studie 2020 | 31 | ||
| a) Medienausstattung | 31 | ||
| b) Internetnutzung der Sechs- bis Dreizehnjährigen | 31 | ||
| c) Nutzung sozialer Netzwerke | 32 | ||
| aa) Die beliebtesten sozialen Netzwerke | 33 | ||
| bb) Das Bedürfnis nach Kommunikation | 34 | ||
| cc) Digitaler Schulhof | 35 | ||
| dd) Familiäre Vereinbarungen hinsichtlich Altersbeschränkungen | 35 | ||
| 3. JIM-Studie 2021 | 36 | ||
| a) Technische Medienausstattung der Zwölf- bis Neunzehnjährigen | 36 | ||
| b) Internetnutzung – das tägliche Bedürfnis | 36 | ||
| c) Aktivitäten im Internet – Schwerpunkt Kommunikation | 37 | ||
| d) WhatsApp, Instagram, Snapchat & Co. | 38 | ||
| 4. Zusammenfassung | 39 | ||
| II. Chancen und Risiken der Nutzung von Kommunikationsdiensten | 41 | ||
| 1. Stärkung der sozialen Kontakte | 42 | ||
| 2. Meinungsbildung in Zeiten von Big Data, Social Bots und Fake News | 43 | ||
| a) „Big Data“, „Microtargeting“, „Profiling“ & Co. | 43 | ||
| b) Einsatz automatisierter Profile und Fake News | 46 | ||
| 3. Zwischen Kontrollverlust und Kontrollillusion | 48 | ||
| a) Kontrollverlust der Nutzer | 48 | ||
| aa) Die Datengewinnung von Netzwerken | 48 | ||
| bb) Verbreitung von Inhalten durch andere Nutzer | 50 | ||
| b) Kontrollillusion der Nutzer | 51 | ||
| 4. Cybermobbing und Beleidigungen im Netz | 52 | ||
| 5. Fazit | 53 | ||
| III. Wege der Bildveröffentlichung | 54 | ||
| 1. Profilfotos und -videos | 54 | ||
| 2. Titelbilder | 56 | ||
| 3. Alben und Chronikfotos | 56 | ||
| 4. (Live-)Videos und Story-Funktion | 57 | ||
| 5. Versenden von Bildern | 57 | ||
| 6. Bewegtbilder | 58 | ||
| IV. Zusammenfassung | 59 | ||
| C. Vertragliche Rechtsbeziehung zwischen minderjährigen Nutzern und Netzwerkbetreibern | 61 | ||
| I. Die Wirksamkeit des Social-Media-Vertrags | 61 | ||
| 1. Rechtliche Vorteilhaftigkeit von Nutzungsverträgen i. S. d. § 107 BGB | 62 | ||
| 2. Die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter | 63 | ||
| 3. Bewirken der Leistung mit eigenen Mitteln | 63 | ||
| a) Daten sind keine Mittel i. S. d. § 110 BGB | 64 | ||
| b) Analoge Anwendbarkeit des § 110 BGB | 64 | ||
| c) Kein Überlassen der Daten | 66 | ||
| 4. Ergebnis | 66 | ||
| II. Die Gegenleistung im Social-Media-Vertrag | 67 | ||
| 1. Bestimmung der Gegenleistungspflicht | 67 | ||
| a) Begriff der Gegenleistung | 67 | ||
| b) Die Datenüberlassung als Gegenleistungspflicht | 68 | ||
| c) Die datenschutzrechtliche Einwilligung als Gegenleistung | 69 | ||
| d) Stellungnahme | 69 | ||
| e) Verknüpfungsarten der Gegenleistung | 70 | ||
| 2. Die Wirksamkeit der datenschutzrechtlichen Einwilligung | 71 | ||
| a) Freiwilligkeit der Entscheidung | 72 | ||
| aa) Kriterium des klaren Ungleichgewichts | 73 | ||
| bb) Kriterium der gleichwertigen Alternative | 73 | ||
| cc) Kriterium der Erforderlichkeit | 74 | ||
| dd) Kriterium der Informiertheit | 75 | ||
| ee) Beurteilung der Freiwilligkeit im Rahmen von Social-Media-Verträgen | 77 | ||
| b) Die Einwilligungsfähigkeit von Kindern nach Art. 8 DSGVO | 77 | ||
| aa) Wirksamkeitsvoraussetzungen nach Art. 8 DSGVO | 78 | ||
| bb) Anwendbarkeit der Regelungen über die Geschäftsfähigkeit | 79 | ||
| cc) Auseinanderklaffen der Altersgrenzen | 80 | ||
| c) Das Prinzip der Einsichtsfähigkeit | 81 | ||
| d) Wesentliche Rechtsfolge einer unwirksamen Einwilligung | 83 | ||
| e) Zusammenfassung | 83 | ||
| 3. Vertragliche Einordnung | 84 | ||
| a) Divergierende Ansichten im Schrifttum | 84 | ||
| b) Stellungnahme | 85 | ||
| 4. Ergebnis | 86 | ||
| III. Die Wirksamkeit von Nutzungsbedingungen | 86 | ||
| 1. Zumutbarkeit der Kenntnisnahme | 87 | ||
| 2. Überraschende Klauseln | 90 | ||
| 3. Inhaltskontrolle | 91 | ||
| a) Bestätigung bei der Registrierung, die Datenschutzbestimmungen des sozialen Netzwerks „gelesen“ zu haben | 92 | ||
| b) Bestätigung des Mindestalters | 93 | ||
| c) Selbstverpflichtung des Nutzers zur Angabe korrekter, persönlicher Informationen | 94 | ||
| aa) Unzulässigkeit nach §§ 4, 4a BDSG a.F. | 94 | ||
| bb) Unzulässigkeit nach den Vorschriften der DSGVO | 95 | ||
| (1) Keine Klarnamenpflicht aufgrund einer Einwilligung | 95 | ||
| (2) Interessenabwägung zugunsten einer pseudonymen Nutzung | 96 | ||
| (3) Grundsatz der Datenminimierung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. c, e DSGVO | 97 | ||
| cc) Verstoß gegen § 19 Abs. 2 TTDSG | 98 | ||
| dd) Fazit | 100 | ||
| d) Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten | 100 | ||
| aa) Anwendbarkeit der Inhaltskontrolle | 100 | ||
| bb) Inhaltskontrolle von Einwilligungserklärungen | 102 | ||
| cc) Zusammenfassung | 103 | ||
| e) Änderungen von Bedingungen | 104 | ||
| aa) Einseitige Änderungsvorbehalte | 104 | ||
| bb) Zustimmungsbedürftige Änderungsvorbehalte | 104 | ||
| cc) Anforderungen an einen Änderungsvorbehalt und dessen Umsetzung in der Praxis | 105 | ||
| dd) Ergebnis | 106 | ||
| f) Vererbbarkeit des Nutzerkontos | 107 | ||
| aa) Keine wirksame Einbeziehung der Gedenkzustands-Richtlinie | 107 | ||
| bb) Inhaltskontrolle | 108 | ||
| (1) Unwirksamkeit nach § 307 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB | 108 | ||
| (2) Unwirksamkeit nach § 307 Abs. 1, 2 Nr. 2 BGB | 109 | ||
| cc) Ergebnis | 110 | ||
| g) Lösch- und Sperrklauseln | 110 | ||
| aa) Löschung und Sperrung von digitalen Inhalten | 110 | ||
| bb) Vorübergehende Sperrung eines Accounts | 112 | ||
| cc) Vertragsbeendigung | 113 | ||
| dd) Ergebnis | 114 | ||
| 4. Bezug zu Minderjährigen | 115 | ||
| 5. Ergebnis | 115 | ||
| IV. Unwirksamkeit gemäß § 138 BGB | 116 | ||
| V. Anwendbarkeit der Verbraucherrechte gemäß §§ 312ff. BGB | 117 | ||
| 1. Bereitstellung personenbezogener Daten nach § 312 Abs. 1a S. 1 BGB | 118 | ||
| 2. Besondere Pflicht des Netzwerkanbieters beim Zustandekommen eines Vertrags gemäß § 312j Abs. 3 BGB | 118 | ||
| a) Geltung für soziale Netzwerke | 119 | ||
| b) Rechtsfolge: Keine Bindung des Verbrauchers an den Vertrag | 120 | ||
| 3. Ergebnis | 121 | ||
| VI. Zusammenfassung | 121 | ||
| D. Rechtliche Schranken der Nutzbarkeit sozialer Netzwerke | 124 | ||
| I. Persönlichkeitsrechtsgefährdungen durch Bildveröffentlichungen im Eltern-Kind-Verhältnis | 124 | ||
| 1. Rechtliche Zulässigkeit der Veröffentlichung nach der DSGVO | 125 | ||
| a) Sachlicher Anwendungsbereich gemäß Art. 2 Abs. 1 DSGVO | 125 | ||
| aa) Ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung | 126 | ||
| bb) Bilder als personenbezogenes Datum | 126 | ||
| (1) Informationen, die auf eine natürliche Person Bezug nehmen | 126 | ||
| (2) Perspektive zur Bestimmung des Personenbezugs | 127 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 128 | ||
| b) Ausnahme bei persönlicher oder familiärer Tätigkeit | 128 | ||
| aa) Unbestimmter Empfängerkreis | 129 | ||
| bb) Nähe- und Vertrauensverhältnis | 130 | ||
| cc) Netzwerkbetreiber als indirekte Adressaten von Bildmaterial | 130 | ||
| dd) Stellungnahme | 131 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 132 | ||
| c) Verantwortlichkeit der Eltern i. S. d. DSGVO | 132 | ||
| aa) Entscheidung der Eltern über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung | 133 | ||
| bb) Kollektive Verantwortlichkeit nach Art. 26 Abs. 1 DSGVO | 134 | ||
| (1) Weite Auslegung des Begriffs | 134 | ||
| (2) Einheit von Zwecken und Mitteln hinsichtlich eines bestimmten Verarbeitungsvorgangs | 135 | ||
| (3) Schlussfolgerungen für das konkrete Szenario | 136 | ||
| cc) Grad der Verantwortlichkeit | 137 | ||
| dd) Ergebnis | 138 | ||
| d) Legitimation der Bildveröffentlichung durch die Eltern | 138 | ||
| aa) Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSVGO | 138 | ||
| bb) Erlaubnistatbestand nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DSGVO | 139 | ||
| e) Rechtsfolgen | 140 | ||
| f) Ergebnis | 141 | ||
| 2. Rechtliche Zulässigkeit der Veröffentlichung nach dem KUG | 141 | ||
| a) Bildnis | 142 | ||
| b) Verbreiten oder öffentliches Zurschaustellen | 143 | ||
| aa) Verbreiten | 143 | ||
| bb) Öffentliches Zurschaustellen | 143 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 144 | ||
| c) Einwilligung nach § 22 S. 1 KUG | 145 | ||
| aa) Interessenkollision der Eltern | 146 | ||
| bb) Keine Ausnahme von § 1809 Abs. 1 BGB | 147 | ||
| d) Rechtsfolgen | 148 | ||
| e) Ergebnis | 149 | ||
| 3. Anwendungsvorrang der DSGVO | 150 | ||
| a) Bildveröffentlichung zu journalistischen Zwecken | 150 | ||
| b) Ausschließlichkeit der Zwecke | 151 | ||
| c) Zwischenergebnis | 152 | ||
| 4. Staatliche Eingriffe | 152 | ||
| a) Maßnahmen des Familiengerichts bei Kindeswohlgefährdungen | 153 | ||
| b) Entziehung der Entscheidungsbefugnis eines Elternteils | 154 | ||
| 5. Prozessuale Durchsetzung der Ansprüche | 155 | ||
| 6. Ergebnis | 156 | ||
| II. Die rechtliche Zulässigkeit von Bildveröffentlichungen durch Dritte | 157 | ||
| 1. Beurteilung nach den Vorschriften der DSGVO | 158 | ||
| a) Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a DSVGO | 158 | ||
| b) Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f DSGVO | 159 | ||
| 2. Beurteilung nach den Vorschriften des KUG | 160 | ||
| a) Einwilligung gemäß § 22 S. 1 KUG | 160 | ||
| aa) Konkludente Erteilung | 161 | ||
| bb) Selbstbestimmung des beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen | 162 | ||
| b) Ausnahme gemäß § 23 KUG | 162 | ||
| 3. Rechtsfolgen und Anwendungsvorrang | 163 | ||
| 4. Anordnungen von Maßnahmen durch das Familiengericht | 164 | ||
| 5. Minderjährige als Verantwortliche i. S.v. § 828 BGB | 165 | ||
| 6. Ergebnis | 166 | ||
| III. Zugriff der Erben auf Bildmaterial minderjähriger Kommunikationspartner eines verstorbenen Nutzers | 167 | ||
| 1. Die Erbrechtliche Beurteilung von Social Media Inhalten der Kommunikationspartner | 168 | ||
| a) Keine Differenzierung zwischen höchstpersönlichen und vermögensrechtlichen Inhalten | 170 | ||
| b) Kein schutzwürdiges Vertrauen der Kommunikationspartner | 172 | ||
| c) „Geteilte“ Inhalte der Kommunikationspartner | 172 | ||
| d) Nachträgliche Genehmigung von Nutzungsverträgen | 173 | ||
| e) Ergebnis | 173 | ||
| 2. Vereinbarkeit mit dem Fernmeldegeheimnis | 173 | ||
| 3. Datenschutzrechtliche Vereinbarkeit | 175 | ||
| a) Erfüllung des Vertrags durch die Übermittlung der Inhalte | 175 | ||
| b) Interessenabwägung | 176 | ||
| aa) Berechtigte Interessen der Parteien | 177 | ||
| bb) Abwägung der Interessen | 177 | ||
| c) Fazit | 179 | ||
| 4. Konsequenzen | 180 | ||
| a) Auskunftsanspruch der Erben | 180 | ||
| b) Wahrung von Persönlichkeits- und Verwertungsrechten | 180 | ||
| c) Lebzeitige Vorsorge der Nutzer | 181 | ||
| 5. Fazit | 182 | ||
| IV. Übermittlung von Daten aus dem Adressbuch des Mobiltelefons | 183 | ||
| 1. Rechtliche Grenzziehung der Nutzbarkeit | 184 | ||
| a) Widerspruch zur Verwendung von Pseudonymen | 184 | ||
| b) Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung | 184 | ||
| aa) Bekanntgabe der eigenen Telefonnummer als konkludente Einwilligung | 185 | ||
| bb) Deliktische Verantwortlichkeit | 186 | ||
| cc) Rechtsfolge: Unterlassungsanspruch und kostenpflichtige Abmahnung | 186 | ||
| c) Verstoß gegen datenschutzrechtliche Regelungen | 187 | ||
| 2. Änderungen der AGB von WhatsApp | 188 | ||
| 3. Ergebnis | 189 | ||
| V. Werbung in sozialen Netzwerken | 190 | ||
| 1. Behavioral Targeting | 191 | ||
| a) Funktionsweise | 191 | ||
| b) Rechtliche Bewertung | 193 | ||
| aa) Einsatz der Technologie und Erhebung der Daten | 193 | ||
| bb) Werbegestaltung | 195 | ||
| cc) Rechtliches Schicksal von Verträgen, die aufgrund von personalisierter Werbung geschlossen wurden | 196 | ||
| (1) Wirksamkeit des Vertrags | 196 | ||
| (2) Widerruf des Vertrags | 197 | ||
| (3) Aufhebung des Vertrags nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB | 198 | ||
| (a) Vorvertragliches Schuldverhältnis | 198 | ||
| (b) Pflichtverletzung | 199 | ||
| (c) Schaden | 202 | ||
| (d) Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden | 203 | ||
| c) Bedeutung für Minderjährige | 203 | ||
| d) Ergebnis | 204 | ||
| 2. Influencer Marketing | 205 | ||
| a) Minderjährige als Follower | 206 | ||
| aa) Vorrangige Spezialvorschriften zur Kennzeichnungspflicht | 207 | ||
| bb) Unzulässigkeit von Influencer-Beiträgen nach § 3 Abs. 3 UWG | 208 | ||
| (1) Geschäftliche Handlung i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG | 209 | ||
| (2) Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis | 211 | ||
| (3) Die im Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG aufgeführten unzulässigen geschäftlichen Handlungen im Einzelnen | 212 | ||
| (a) Tarnung von Werbung als redaktioneller Inhalt, Nr. 11 UWG | 212 | ||
| (b) Unmittelbare Aufforderung an Kinder, Nr. 28 UWG | 215 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 217 | ||
| cc) Unzulässigkeit mangels Kenntlichmachung des kommerziellen Zwecks gemäß § 5a Abs. 4 S. 1 UWG | 217 | ||
| (1) Kommerzieller Zweck | 218 | ||
| (2) Fehlende Erkennbarkeit des kommerziellen Zwecks | 219 | ||
| (3) Veranlassung des Verbrauchers zu einer geschäftlichen Entscheidung | 221 | ||
| (4) Beurteilungsmaßstab für den minderjährigen Adressatenkreis | 222 | ||
| (5) Anforderungen an die Kennzeichnungspflicht | 223 | ||
| dd) Ergebnis | 225 | ||
| b) Minderjährige als Influencer | 226 | ||
| aa) Eigenständige Vornahme von Rechtsgeschäften | 226 | ||
| (1) Erwerbsgeschäft | 227 | ||
| (2) Selbständiger Betrieb | 228 | ||
| (3) Ermächtigung durch den gesetzlichen Vertreter und deren Genehmigung durch das Familiengericht | 229 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 229 | ||
| bb) Anwendbarkeit von Verbrauchervorschriften | 230 | ||
| cc) Haftung | 231 | ||
| dd) Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetzes | 232 | ||
| (1) Beschäftigungsverbot | 232 | ||
| (2) Behördliche Ausnahme | 234 | ||
| ee) Fazit | 235 | ||
| c) Ergebnis | 236 | ||
| VI. Fazit zu den rechtlichen Schranken der Nutzbarkeit sozialer Netzwerke und Ausblick | 237 | ||
| E. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Abbildungen in sozialen Netzwerken | 241 | ||
| I. Internationale Zuständigkeit | 242 | ||
| 1. Gerichtsstände nach der EuGVVO | 242 | ||
| a) Allgemeiner Gerichtsstand | 242 | ||
| b) Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung | 244 | ||
| aa) Klageerhebung am Handlungsort | 245 | ||
| bb) Klageerhebung am Erfolgsort | 247 | ||
| (1) Die Geltendmachung von Teilschäden | 247 | ||
| (2) Einklagbarkeit des Gesamtschadens am Mittelpunkt der Interessen | 249 | ||
| (3) Übertragbarkeit der Lösungsansätze auf Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche | 251 | ||
| c) Ergebnis | 253 | ||
| 2. Internationale Zuständigkeiten nach dem Lugano-Übereinkommen II | 254 | ||
| 3. Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte nach der ZPO | 254 | ||
| a) Allgemeiner Gerichtsstand | 255 | ||
| b) Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung | 255 | ||
| aa) Gerichtszuständigkeit am Ort der ursächlichen Handlung | 256 | ||
| bb) Gerichtszuständigkeit am Ort des Schadenseintritts | 256 | ||
| (1) Abrufbarkeit der Inhalte | 257 | ||
| (2) Deutlicher Inlandsbezug als Einschränkungskriterium | 257 | ||
| (a) Erhöhte Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme im Inland | 258 | ||
| (b) Ort der sozial engsten Verbindung | 259 | ||
| c) Ergebnis | 260 | ||
| 4. Zusammenfassung | 260 | ||
| II. Anwendbares Recht | 261 | ||
| 1. Ort der Einspeisung als Handlungsort | 262 | ||
| 2. Bestimmung des Erfolgsorts | 262 | ||
| 3. Ergebnis | 262 | ||
| III. Abweichungen bei der Bestimmung des Verfahrens- und Kollisionsrechts | 263 | ||
| 1. Kein Anpassungsbedarf hinsichtlich der Schwerpunktbildung | 263 | ||
| 2. Anpassungsbedarf hinsichtlich der Mosaiktheorie | 264 | ||
| 3. Stellungnahme | 264 | ||
| 4. Ergebnis | 266 | ||
| IV. Fazit | 266 | ||
| F. Zusammenfassung in Thesen | 268 | ||
| Literaturverzeichnis | 278 | ||
| Stichwortverzeichnis | 303 |
