»Copyleft« im deutschen Urheberrecht
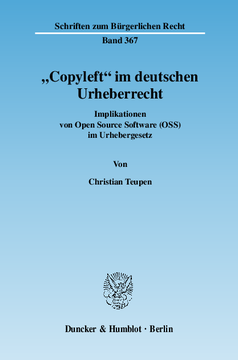
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
»Copyleft« im deutschen Urheberrecht
Implikationen von Open Source Software (OSS) im Urhebergesetz
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 367
(2007)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Open Source Software ist im deutschen Urheberrecht angekommen. Der Gesetzgeber hat mit der Regelung in § 32 Abs. 3 Satz 3 UrhG die besonderen Bedürfnisse von Copyleft-Lizenzierungsmodellen berücksichtigt. Eine Verknüpfung von eingeräumten Nutzungsrechten und den in der GPL festgelegten Nutzungspflichten erfolgt im Wege der Vereinbarung einer auflösenden Bedingung gem. § 158 Abs. 2 BGB. Bei dem der Nutzungsrechtseinräumung zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäft handelt es sich um einen atypischen "Open Source"-Vertrag, wobei sich der Vertragsinhalt im Wesentlichen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen entnehmen lässt, die als AGB einzuordnen sind.Der in Open Source-Verträgen formulierte Gewährleistungs- und Haftungsausschluss verstößt gegen §§ 305 ff. BGB. Somit lässt sich die Haftung allein auf leichte Fahrlässigkeit beschränken - Grund genug, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 9 | ||
| Inhaltsübersicht | 11 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| § 1 Grundlagen | 21 | ||
| Einführung | 21 | ||
| II. Gang der Darstellung | 28 | ||
| III. Inhaltliche Beschränkung der Arbeit | 30 | ||
| IV. Terminologie | 31 | ||
| V. Definition der Kernbegriffe | 31 | ||
| § 2 Herkunft und ökonomische Grundlagen von Open Source Software | 36 | ||
| I. Historische Entwicklung von Open Source Software | 36 | ||
| II. Ökonomische Bedeutung von Open Source Software | 43 | ||
| 1. Open Source Software in der Wirtschaft | 45 | ||
| a) Vorteile von Open Source Software | 45 | ||
| b) Nachteile von Open Source Software | 46 | ||
| c) Betätigungsfelder | 47 | ||
| 2. Open Source Software in der Öffentlichen Verwaltung | 50 | ||
| § 3 Urheberrecht und "Copyleft" | 53 | ||
| I. Inhalt und Bedeutung des Urheberrechts im Informationszeitalter | 53 | ||
| II. Der Open Source-Gedanke im Spannungsfeld von Urheberrechtsschutz und Informationsfreiheit | 55 | ||
| 1. Das Copyleft-Modell | 56 | ||
| 2. Die Free Software-Definition/Open Source-Definition | 57 | ||
| a) Free Software-Definition | 58 | ||
| b) Open Source-Definition | 58 | ||
| 3. Motive für das Copyleft-Modell | 60 | ||
| a) Altruistische Ideologie | 60 | ||
| b) Open Source als Entwicklungsmethode | 62 | ||
| c) Gebrauch fremder Programmierergebnisse für eigene Softwareanwendungen | 62 | ||
| d) Spaßfaktor und Reputation | 63 | ||
| e) Schaffung eines unabhängigen Softwaresektors | 63 | ||
| f) Lerneffekte | 64 | ||
| g) Fazit | 64 | ||
| § 4 Rechtlicher Schutz von Computerprogrammen in Deutschland | 65 | ||
| I. Rechtsschutz von Computerprogrammen | 65 | ||
| 1. Rechtslage in Deutschland vor dem Zweiten Änderungsgesetz zum Urheberrecht | 66 | ||
| 2. Europäische Entwicklung des Rechtsschutzes von Computerprogrammen | 67 | ||
| 3. Rechtsentwicklung in Deutschland aufgrund der Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen | 68 | ||
| 4. Überblick über den Rechtsschutz von Computerprogrammen in Deutschland | 69 | ||
| a) Schutz durch relative Rechte | 69 | ||
| aa) Vertragsrecht | 69 | ||
| bb) Wettbewerbsrecht | 70 | ||
| cc) Markenrecht | 73 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 75 | ||
| b) Schutz durch absolute Rechte | 75 | ||
| aa) Patentrecht | 75 | ||
| (1) Schutzvoraussetzungen | 76 | ||
| (2) Aktuelle Entwicklungen im Patentrecht | 79 | ||
| (3) Open Source Software und Patentrecht | 81 | ||
| bb) Urheberrecht | 83 | ||
| (1) Computerprogramm als "Sprachwerk" | 84 | ||
| (2) Schutzgegenstand | 84 | ||
| (a) Entwurfsmaterial | 85 | ||
| (b) Schutz als Ausdrucksform | 86 | ||
| (c) Ideen und Grundsätze | 91 | ||
| (3) Schutzvoraussetzungen gem. § 69a III UrhG | 96 | ||
| (4) Urheberschaft | 98 | ||
| (a) Alleinurheberschaft | 98 | ||
| (b) Der angestellte Urheber | 99 | ||
| (c) Miturheberschaft | 99 | ||
| (d) Urheberschaft in Arbeits- und Dienstverhältnissen | 105 | ||
| (5) Verwertungsrechte an Computerprogrammen | 108 | ||
| (a) Die einzelnen Verwertungsrechte | 108 | ||
| (b) Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen | 111 | ||
| (c) Dekompilierung | 112 | ||
| (d) Rechtsverletzungen | 113 | ||
| (e) Anwendung sonstiger Vorschriften | 114 | ||
| II. Fazit | 114 | ||
| III. Die urheberrechtliche Lizenz | 115 | ||
| § 5 Open Source Software im deutschen Urheberrecht | 118 | ||
| I. Open Source Software als Schutzgegenstand des UrhG | 118 | ||
| II. Open Source Software und Anwendbarkeit des UrhG/Internationales Urheberrecht und kollisionsrechtliche Einordnung von Freier Software | 119 | ||
| 1. Internationales Urheberrecht als Fremdenrecht | 120 | ||
| a) Entstehung, Inhaberschaft, Inhalt und Dauer des Urheberrechts | 120 | ||
| b) Internationales Urhebervertragsrecht | 124 | ||
| aa) Trennungsprinzip | 125 | ||
| bb) Verpflichtungsgeschäft | 125 | ||
| cc) Urheberrechtliches Verfügungsgeschäft | 126 | ||
| dd) Anzuwendendes Recht bei Open Source-Lizenzen | 127 | ||
| (1) Vertragliche Rechtswahl gem. Art. 27 EGBGB | 127 | ||
| (2) Anknüpfung gem. Art. 28 EGBGB | 129 | ||
| (3) Verbraucherkollisionsrecht gem. Art. 29 EGBGB | 134 | ||
| c) Persönlicher Anwendungsbereich des UrhG bei Sachverhalten mit Auslandsbezug | 139 | ||
| 2. Zuständigkeit und prozessuale Gesichtspunkte bei Open Source Software/Internationales Zivilverfahrensrecht | 140 | ||
| a) Zuständigkeit | 141 | ||
| aa) Rechtsstreitigkeiten ohne Auslandsbezug | 141 | ||
| (1) Die Zuständigkeiten | 141 | ||
| (2) Gerichtsstandvereinbarung | 142 | ||
| bb) Rechtsstreitigkeit mit Auslandsbezug | 144 | ||
| (1) Zuständigkeit nach der EuGVO bzw. nach der LugÜ | 144 | ||
| (2) Besondere Gerichtsstände | 146 | ||
| (3) Gerichtsstandvereinbarung | 147 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 148 | ||
| dd) Rechtsstreitigkeiten mit Bezug zum amerikanischen Rechtsraum | 148 | ||
| ee) Fazit | 149 | ||
| b) Anerkennung ausländischer Urteile | 149 | ||
| III. Urheberschaft bei Open Source Software | 151 | ||
| 1. Einzelurheberschaft bei Open Source Software | 152 | ||
| a) Urheber gem. § 7 UrhG | 152 | ||
| b) Bearbeitung durch den Einzelurheber | 153 | ||
| aa) Entstehen eines Bearbeiterurheberrechts | 153 | ||
| (1) Verhältnis des Urhebers des Originalwerkes zu dem Urheber der Bearbeitung | 154 | ||
| (a) BGB-Gesellschaft | 154 | ||
| (b) Stellungnahme | 154 | ||
| (c) Entwicklergemeinschaft | 155 | ||
| (2) Stellungnahme | 156 | ||
| bb) Fazit | 157 | ||
| 2. Entwicklungsgemeinschaften von Open Source Software | 157 | ||
| a) Miturheberschaft an Open Source Software | 158 | ||
| aa) Gemeinsame Gesamtidee | 158 | ||
| bb) Aktivlegitimation | 160 | ||
| b) Werkverbindung gem. § 9 UrhG | 164 | ||
| c) Fazit | 165 | ||
| 3. Open Source-Programmierer im Angestelltenverhältnis | 165 | ||
| § 6 Open Source-Lizenzen und Verwertungsrechte | 166 | ||
| I. Einleitung | 166 | ||
| II. Open Source Softwarelizenzen | 167 | ||
| 1. Open Source Softwarelizenzen ohne Copyleft-Effekt | 167 | ||
| 2. Open Source Softwarelizenzen mit strengem Copyleft-Effekt | 167 | ||
| 3. Open Source-Lizenzen mit beschränktem Copyleft-Effekt | 168 | ||
| 4. Verbreitung einzelner Open Source-Lizenzen | 168 | ||
| III. Verwertungsrechte in Open Source Softwarelizenzverträgen | 168 | ||
| 1. Einleitung | 168 | ||
| 2. Verwertungsrechte in Open Source-Lizenzen | 169 | ||
| a) Einräumung von Nutzungsrechten an Open Source Software | 169 | ||
| aa) Schuldrechtliche Einwilligung in die Nutzung von Open Source Software | 169 | ||
| bb) Rechtseinräumung gem. § 31 UrhG | 170 | ||
| (1) Ausschließliches Nutzungsrecht | 170 | ||
| (2) Einfaches Nutzungsrecht | 171 | ||
| (a) Der Streit um das einfache Nutzungsrecht | 171 | ||
| (b) Keine Verwertungsketten bei Open Source Softwarelizenzen | 173 | ||
| b) Die einzelnen Verwertungsrechte | 174 | ||
| aa) Das Vervielfältigungsrecht i.S.v. §§ 16, 69c Nr. 1 UrhG | 174 | ||
| (1) Befugnisse des Nutzers | 174 | ||
| (2) Pflichten und Bedingungen | 176 | ||
| bb) Das Verbreitungsrecht i.S.d. §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG | 177 | ||
| (1) Befugnisse des Nutzers | 177 | ||
| (a) Problem der Online-Übermittlung | 178 | ||
| (b) GPL und § 69c Nr. 4 UhrG | 179 | ||
| (aa) Der Meinungsstand | 179 | ||
| (bb) Stellungnahme | 180 | ||
| (c) Open Source als bekannte Nutzungsart gem. § 31 IV UrhG | 180 | ||
| (d) Einräumung des Nutzungsrechts gem. § 69c Nr. 4 durch die GPL | 183 | ||
| (e) Zwischenergebnis | 185 | ||
| (f) Vermietrecht | 185 | ||
| (aa) Meinungsstand | 185 | ||
| (bb) Stellungnahme | 185 | ||
| (g) Application Service Providing von Open Source Software | 187 | ||
| (2) Pflichten und Bedingung | 189 | ||
| (3) Problem der Erschöpfung bei der Verbreitung von Open Source Software | 190 | ||
| cc) Das Veränderungsrecht gem. §§ 69c Nr. 2, 23 UrhG | 190 | ||
| (1) Befugnisse des Nutzers | 190 | ||
| (2) Pflichten und Bedingungen | 191 | ||
| (3) Kollision der Veränderungsfreiheit mit Urheberpersönlichkeitsrechten | 192 | ||
| § 7 Rechtliche Dogmatik des Copyleft-Modells | 193 | ||
| I. Einleitung | 193 | ||
| II. Lösungsmodelle | 193 | ||
| 1. Schuldrechtliche Lösung | 193 | ||
| 2. Schenkung unter Auflage gem. §§ 516, 525 BGB | 195 | ||
| 3. Open Source Software als eigene Nutzungsart | 196 | ||
| a) Herausbildung einer technisch-wirtschaftlichen Nutzungsart | 197 | ||
| b) Verknüpfung von Rechten und Pflichten durch Einräumung eines inhaltlich beschränkten Nutzungsrechts bei Open Source Software | 198 | ||
| aa) Technisch-wirtschaftliche Eigenständigkeit | 198 | ||
| bb) Kritik an der Annahme einer technisch-wirtschaftlichen Nutzungsart | 200 | ||
| (1) Fehlende technische Eigenständigkeit | 201 | ||
| (2) Annahme einer wirtschaftlichen Eigenständigkeit | 202 | ||
| (3) Ziff. 4 GPL | 206 | ||
| (4) LG München I | 206 | ||
| c) Zwischenergebnis | 206 | ||
| 4. Dinglich wirkender Vorbehalt | 207 | ||
| a) Meinungsstand | 207 | ||
| b) Stellungnahme | 209 | ||
| III. Ergebnis | 211 | ||
| § 8 Vereinbarkeit der GPL mit dem Erschöpfungsgrundsatz | 213 | ||
| I. Allgemeines | 213 | ||
| II. Erschöpfungsgrundsatz im Rahmen der Verbreitung von Open Source Software | 215 | ||
| 1. Anwendungsvoraussetzungen des § 69c Nr. 3 UrhG bei Open Source Software | 215 | ||
| 2. Generelle Anwendbarkeit des § 69c Nr. 3 UrhG auf Open Source Software | 216 | ||
| 3. Verhinderung der Erschöpfung bei Open Source Software | 217 | ||
| a) Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes bei Online-Verbreitung von Open Source Software | 217 | ||
| b) Umgehung des Erschöpfungsgrundsatzes durch eine inhaltliche Beschränkung des Verbreitungsrechts | 217 | ||
| aa) Erschöpfung beschränkter Verbreitungsrechte | 217 | ||
| bb) Inhaltlich beschränktes Verbreitungsrecht bei Open Source Software | 218 | ||
| c) Umgehung einer Erschöpfungswirkung durch Ausschluss von Erwerbskette bei der Lizenzeinräumung | 220 | ||
| aa) Beschränkte Bindungswirkung der GPL in der Vertriebskette | 220 | ||
| bb) Stellungnahme | 221 | ||
| d) Ergebnis | 224 | ||
| § 9 Vertragliche Einordnung der Softwareüberlassung bei Open Source Software | 225 | ||
| I. Nicht durch Distributoren vertriebene Software | 225 | ||
| 1. Vorbemerkung | 226 | ||
| 2. Vertragsbeziehungen als BGB-Gesellschaft | 226 | ||
| 3. "Open Source-Entwicklervertrag" als Vertrag sui generis | 228 | ||
| 4. Open Source Software-Überlassung als Kaufvertrag gem. § 433 I BGB | 229 | ||
| 5. Software-Download als Auftrag gem. § 662 BGB | 230 | ||
| 6. Ausgestaltung des Grundgeschäfts als Leihe gem. §§ 598 ff. | 231 | ||
| 7. Open Source Software-Überlassung als Schenkung gem. §§ 516 ff. BGB | 232 | ||
| a) Zuwendung | 232 | ||
| b) Entreicherung | 233 | ||
| c) Bereicherung des Beschenkten | 234 | ||
| d) Unentgeltlichkeit | 234 | ||
| e) Ergebnis | 235 | ||
| 8. Dingliche Verfügung ohne schuldrechtliches Grundgeschäft | 235 | ||
| 9. Eigene Stellungnahme | 236 | ||
| a) Schenkungsrecht | 236 | ||
| b) Open Source Software-Überlassung als dingliche Verfügung aufgrund eines Open Source-Vertrages gem. § 311 I BGB | 240 | ||
| aa) Einleitung | 240 | ||
| bb) Eigener Lösungsvorschlag | 241 | ||
| (1) Der Open Source-Vertrag | 242 | ||
| (2) Open Source-Lizenzen als AGB | 242 | ||
| (a) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB auf Open Source-Lizenzen | 242 | ||
| (b) Open Source-Lizenzen als Allgemeine Geschäftsbedingungen | 243 | ||
| (c) Wirksame Einbeziehung der AGB in den Lizenzvertrag gem. § 305 II BGB | 244 | ||
| (d) Inhaltskontrolle der AGB hinsichtlich des generellen Gewährleistungs- und Haftungsausschlusses bei Open Source Software-Überlassung | 247 | ||
| ( aa) Vorbemerkung | 248 | ||
| (bb) Inhalt der Regelungen | 249 | ||
| (cc) Gewährleistungsausschluss Ziff. 11 GPL als Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit gem. § 309 Nr. 8b aa) BGB | 250 | ||
| (dd) Gewährleistungsausschluss Ziff. 11 GPL als Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit gem. § 309 Nr. 7b BGB | 251 | ||
| (ee) Die vertragliche Gewährleistung von Open Source Verträgen | 252 | ||
| (ff) Haftungsregelung Ziff. 12 GPL als Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit gem. § 309 Nr. 7a BGB | 254 | ||
| (gg) Die vertragliche Haftung bei Open Source Verträgen | 255 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 255 | ||
| 10. Ergebnis | 256 | ||
| II. Vertragliche Einordnung von Softwareüberlassung bei Vertrieb von Open Source Software durch Distributoren | 256 | ||
| 1. Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte am Computerprogramm | 256 | ||
| 2. Abschluss eines Distributorenvertrages | 256 | ||
| III. Die Ankunft des Open Source-Gedankens im UrhG | 257 | ||
| § 10 Fazit und Ausblick | 258 | ||
| Literaturverzeichnis | 260 | ||
| Sachwortverzeichnis | 266 |
