CO2-Vermeidung und Brennstoffwahl in der Elektrizitätserzeugung
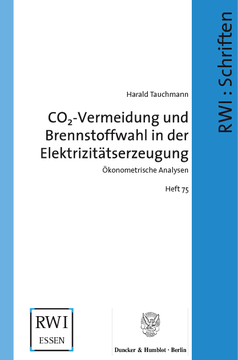
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
CO2-Vermeidung und Brennstoffwahl in der Elektrizitätserzeugung
Ökonometrische Analysen
Schriften des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Vol. 75
(2004)
Additional Information
Book Details
Abstract
Angesichts einer drohenden Veränderung des Weltklimas wurde die Notwendigkeit erkannt, den Ausstoß klimarelevanter Spurengase, insbesondere CO2, zu reduzieren. Ein Weg dazu könnte in der Substitution von Energieträgern bestehen, wobei sich der Elektrizitätserzeugungssektor als größter CO2-Emittent anbietet. Differenzierte Energiesteuern könnten als umweltpolitisches Instrument dienen, um solche Substitutionsvorgänge auszulösen. Wie stark der Energieträgermix darauf reagieren würde bzw. wie hoch entsprechende Steuersätze gewählt werden müssten, stellt dabei eine empirische Frage dar. Harald Tauchmann versucht diese am Beispiel Deutschlands und der USA zu beantworten.In methodischer Hinsicht werden überwiegend mikroökonometrische Verfahren angewendet. Das Ergebnis ist ernüchternd: Keine der durchgeführten Untersuchungen lieferte Hinweise auf starke Effekte von Brennstoffpreisänderungen auf die Energieträgerwahl. Konnte diese für Deutschland noch mit auf die hier hohe Regulierungsintensität zurückgeführt werden, vermittelte die Analyse für die USA, dass auch technologische Gründe verantwortlich sind. Die ökologische Effektivität differenzierter Energiesteuern muss daher zurückhaltend beurteilt werden. Damit erscheint die nunmehr von der EU getroffene Entscheidung für ein Emissionshandelssystem als vermutlich geeigneteres Politikinstrument.
