Zukunftsprobleme der Europäischen Wirtschaftsverfassung
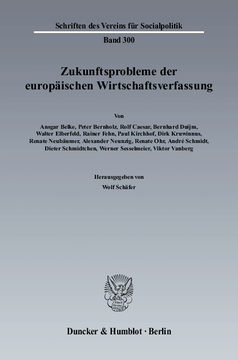
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Zukunftsprobleme der Europäischen Wirtschaftsverfassung
Editors: Schäfer, Wolf
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 300
(2004)
Additional Information
Book Details
Abstract
Die Europäische Union steht vor großen Herausforderungen. Erweiterung und Vertiefung der Union stehen auf der Politikagenda. Ob die Vorschläge des Europäischen Verfassungskonvents für eine grundlegende Erneuerung des Unionsvertrages diesbezüglich zukunftsfähig sind, bedarf einer intensiven Diskussion. In den Beiträgen des vorliegenden Bandes stehen Probleme speziell der europäischen Wirtschaftsverfassung im Mittelpunkt. Obwohl der Begriff der Wirtschaftsverfassung nicht eindeutig definiert ist, sind juristische und vor allem verfassungs- und institutionenökonomische Analysen von Belang. Dabei spannen die Beiträge einen Bogen über die wichtigsten Problembereiche.Grundsätzliche Überlegungen zu einer europäischen Verfassung führen zu den Fragen: Benötigen wir überhaupt eine Verfassung für Europa? Wie ist das Verhältnis zwischen den Nationalstaaten und der Union zu regeln? Freiheit, Bürgersouveränität und Subsidiarität - als eine spezielle Ausprägung des Prinzips der komparativen Wettbewerbsvorteile - spielen in der europäischen Wirtschaftsverfassung eine zentrale Rolle. Sie ergänzen sich mit Überlegungen zur europäischen Finanzverfassung, in der auch die Frage nach den institutionellen Ebenen gestellt wird, die für die Bereitstellung und Finanzierung unterschiedlicher Güter in der Union verantwortlich sind. Gefragt wird auch, ob eine Koordination der nationalen Arbeitsmarktpolitiken auf EU-Ebene sinnvoll ist, oder ob die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im nationalen Politikbereich verbleiben sollte. Zudem: Welche konstitutionen- und institutionenökonomischen Dimensionen hat der Stabilitäts- und Wachstumspakt? Behandelt wird auch das Problem, ob im europäischen Strukturwandel ein Konflikt existiert zwischen ökonomischer Effizienz und sozialer Sicherheit. Vor dem Hintergrund der Theorie optimaler Jurisdiktionen stellt sich die Frage nach der optimalen Länderzahl für die EU-Erweiterung. Optimalitätsprobleme aufgrund der Erweiterung des Euro-Raumes werden hinsichtlich der Entscheidungseffizienz des Rats der Europäischen Zentralbank erörtert. Schließlich behandelt der Band spezielle Aspekte der Subsidiarität sowie der kollektiven Marktbeherrschung in der Wettbewerbspolitik innerhalb der Union.
