Gute Regeln oder Wirtschaftslenkung?
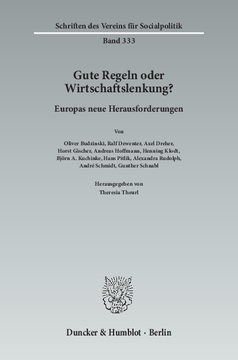
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Gute Regeln oder Wirtschaftslenkung?
Europas neue Herausforderungen
Editors: Theurl, Theresia
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 333
(2011)
Additional Information
Book Details
Abstract
Einmal mehr zeigt sich die Heterogenität der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in ihren wirtschaftlichen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen ebenso wie in ihren wirtschaftspolitischen Präferenzen und in ihren Vorstellungen, wie auf Herausforderungen reagiert werden sollte. Herausforderungen sind zahlreiche zu bewältigen und weitere zeichnen sich ab. Sie kommen nicht nur von außen, sondern sie bilden sich auch durch ordnungspolitische Divergenzen innerhalb der Europäischen Union heraus, so in der Einschätzung einer regelorientierten Wirtschaftspolitik im Vergleich zu einer Wirtschaftslenkung. Diese Kontroverse ist zwar nicht neu, gewinnt aktuell jedoch große Bedeutung und wird daher in den Beiträgen dieses Tagungsbandes aufgegriffen. Sie setzen sich mit den zahlreichen und vielfältigen Facetten auseinander, die mit der Frage "Gute Regeln oder Wirtschaftslenkung" verbunden sind. Die Entwicklungen in der Europäischen Währungsunion und die Verhandlungen über geeignete Reaktionen auf die aufgetretenen Probleme lassen erwarten, dass uns genau diese Thematik auch in den kommenden Jahren begleiten wird.
