Der Erlaß von Berufsordnungen durch die Kammern der freien Berufe
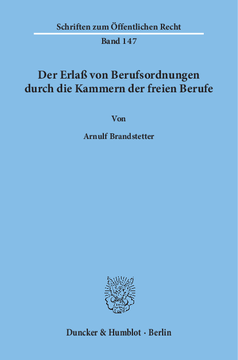
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Erlaß von Berufsordnungen durch die Kammern der freien Berufe
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 147
(1971)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| ERSTER TEIL: Die vorhandenen Regelungen, der Meinungsstand, Abgrenzung | 14 | ||
| Erster Abschnitt: Die vorhandenen Regelungen | 14 | ||
| I. Regelungen der Berufspflichten | 14 | ||
| 1. Informelle Kontrollen der Berufspflichten | 14 | ||
| 2. Regelungen durch den Gesetzgeber, Verordnungsgeber und kommunalen Satzungsgeber | 15 | ||
| 3. Regelungen durch Verbände | 16 | ||
| 4. Regelungen durch Kammern | 17 | ||
| II. Rechtsgrundlagen für die Berufsordnungen der Kammern | 18 | ||
| III. Kammerorgane, die über den Erlaß von Berufsordnungen beschließen | 20 | ||
| IV. Staatliche Beteiligung am Zustandekommen der Berufsordnungen | 23 | ||
| Zweiter Abschnitt: Abgrenzungen und Überschneidungen | 25 | ||
| I. Berufsordnungen und Berufsgerichtsbarkeit | 25 | ||
| II. Berufsordnungen und Sanktionen | 28 | ||
| III. Berufsordnungen und materielle Berufspflichten | 29 | ||
| Dritter Abschnitt: Meinungsstand | 30 | ||
| I. Stellungnahmen zu den Berufsordnungen generell | 30 | ||
| II. Stellungnahmen zu einzelnen Berufsordnungen | 32 | ||
| ZWEITER TEIL: Grundsätzliche verfassungsrechtliche Beurteilung des Erlasses von Berufsordnungen | 36 | ||
| Erster Abschnitt: Das Grundgesetz als Prüfungsmaßstab für Berufsordnungen | 36 | ||
| A. Die Rechtsverbindlichkeit von Berufsordnungen | 36 | ||
| I. Meinungsstand | 36 | ||
| II. Kriterien für die Rechtsverbindlichkeit von Regelungen | 39 | ||
| III. Anwendung dieser Grundsätze auf Berufsordnungen | 42 | ||
| 1. Rechtsanwälte | 42 | ||
| 2. Heilberufe | 47 | ||
| 3. Andere Kammerberufe | 47 | ||
| B. Vorverfassungsrechtliche Regelungsbefugnis der Kammern | 48 | ||
| I. Fragestellung | 48 | ||
| II. Meinungsstand | 49 | ||
| III. Kritik der Auffassung einer originären Regelungsgewalt der Kammern | 52 | ||
| Zweiter Abschnitt: Parlamentarische Gesetzgebung und Berufsordnungen | 54 | ||
| A. Unterschiedlichkeit der Rechtsetzungstätigkeit von Parlament und Kammern | 54 | ||
| B. Vereinbarkeit des Erlasses von Berufsordnungen mit den Gesetzesvorbehalten | 56 | ||
| I. Arten von Gesetzesvorbehalten | 56 | ||
| II. Der organisationsrechtliche Gesetzesvorbehalt | 57 | ||
| III. Der Allgemeinvorbehalt | 58 | ||
| IV. Der Gesetzesvorbehalt von Art. 12 Abs. 1 GG | 60 | ||
| 1. Verhältnis des Allgemein Vorbehalts zum Vorbehalt von Art. 12 GG | 60 | ||
| 2. Die Auslegung des Vorbehalts in Art. 12 Abs. 1 a. F. GG | 61 | ||
| 3. Die Entstehungsgeschichte des Art. 12 Abs. 1 n. F. GG | 63 | ||
| 4. Vergleich mit anderen Gesetzesvorbehalten im Grundrechtsteil | 65 | ||
| 5. Die Auslegung des Vorbehalts in Art. 12 Abs. 1 Satz 2 n. F. GG | 66 | ||
| C. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG als Grundlage bzw. als Ausschlußnorm für den Erlaß von Berufsordnungen | 71 | ||
| I. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG als verfassungsrechtliche Legitimation für den Erlaß von Berufsordnungen | 71 | ||
| 1. Art. 80 GG als Ermächtigung für den Erlaß von Rechtsverordnungen | 72 | ||
| 2. Art. 80 GG als Ermächtigung für Berufsordnungen der Kammern | 72 | ||
| II. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 GG als abschließende Bestimmung für die Übertragung rechtsetzender Gewalt | 74 | ||
| Dritter Abschnitt: Grundrechtsträgerschaft der Kammern | 75 | ||
| A. Anwendbarkeit von Art. 19 Abs. 3 GG auf Juristische Personen des öffentlichen Rechts | 75 | ||
| I. Meinungsstand und Kritik | 76 | ||
| 1. Organismustheorie | 76 | ||
| 2. Rechtsform der Juristischen Person | 76 | ||
| 3. Sachwaltertheorie (Dürig) | 77 | ||
| 4. Aufgabentheorie | 78 | ||
| 5. Subjektionstheorie | 78 | ||
| II. Eigene Lösung | 79 | ||
| B. Sachwalterschaft der Kammern für Mitgliedergrundrechte | 81 | ||
| I. Mitgliedergrundrechte | 81 | ||
| II. Die Kammern als Sachwalter des Grundrechts von Art. 12 GG | 82 | ||
| Vierter Abschnitt: Berufsordnungen und Einrichtungsgarantien des Grundgesetzes | 83 | ||
| A. Einrichtungsgarantie „freie Berufe" | 83 | ||
| I. Die freien Berufe als soziologischer Begriff und als Rechtsbegriff | 83 | ||
| 1. Soziologischer Begriff | 83 | ||
| 2. Rechtsbegriff | 85 | ||
| II. Berufsbildtheorie | 85 | ||
| III. Einrichtungsgarantie durch die Aufgabenbestimmung für einzelne Berufe | 87 | ||
| IV. Art. 12 Abs. 1 GG als Einrichtungsgarantie für die freien Berufe | 89 | ||
| 1. Der individual- und objektivrechtliche Aspekt von Art. 12 Abs. 1 GG | 89 | ||
| 2. Inhalt der Einrichtungsgarantie von Art. 12 Abs. 1 GG | 90 | ||
| 3. Folgerungen für die Kammern der freien Berufe und deren Kompetenzen | 90 | ||
| B. Stand und „ständischer Gedanke" | 92 | ||
| I. Modelle für eine organisatorische Verwirklichung des ständischen Gedankens | 92 | ||
| 1. Korporativistisches Modell | 93 | ||
| 2. Genossenschaftliches Modell | 94 | ||
| II. Grundgesetz und ständischer Gedanke | 95 | ||
| C. Kammer und Körperschaft | 97 | ||
| I. Kammern | 97 | ||
| II. Körperschaften | 98 | ||
| 1. Anerkennung von Körperschaften durch das GG | 98 | ||
| 2. Einrichtungsgarantie des Kompetenzbereiches von Körperschaften | 99 | ||
| III. Organisationsgewalt der Kammer | 101 | ||
| 1. Meinungsstand und Abgrenzung | 101 | ||
| 2. Kammern als Träger der Organisationsgewalt | 102 | ||
| 3. Regelungen für Kammerangehörige als Organisationsakte | 102 | ||
| D. Staatlich gebundener Beruf | 104 | ||
| I. Bei Triepel und in der Rechtsprechung des BVerfG | 104 | ||
| II. Bedeutung der Theorie vom staatlich gebundenen Beruf für die Regelungskompetenz der Kammern | 106 | ||
| E. Besonderes Gewaltverhältnis zwischen Kammern und Mitgliedern | 107 | ||
| I. Arten von besonderen Gewaltverhältnissen | 107 | ||
| II. Begründung und Kritik | 108 | ||
| 1. Parallele zu den herkömmlichen Statusverhältnissen | 108 | ||
| 2. Das Kammerverhältnis als verfassungsrechtlicher Sonderstatus | 109 | ||
| III. Die Beziehung der Kammer zu ihren Mitgliedern als „unechtes Statusverhältnis" | 110 | ||
| F. Selbstverwaltung und Autonomie | 111 | ||
| I. Begriffsabgrenzung Selbstverwaltung-Autonomie | 111 | ||
| II. Berufsständische Autonomie im Grundgesetz | 112 | ||
| III. Analogie zu anderen Autonomiegewährleistungen im Grundgesetz | 113 | ||
| Fünfter Abschnitt: Folgerungen | 113 | ||
| DRITTER TEIL: Die näheren Voraussetzungen für den Erlaß von Berufsordnungen | 117 | ||
| Erster Abschnitt: Rechtsgrundlage | 117 | ||
| A. Gesetzliche Grundlage | 117 | ||
| I. Die gesetzliche Grundlage der einzelnen Berufsordnungen | 117 | ||
| II. Umgehung durch die Gründung privatrechtlicher Dachverbände | 119 | ||
| B. Bestimmtheit der Ermächtigungsnorm | 121 | ||
| I. Meinungsstand | 121 | ||
| II. Anwendbarkeit von Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG auf Berufsordnungen | 122 | ||
| III. Anwendbarkeit von Art. 103 Abs. 2 GG auf Berufsordnungen | 125 | ||
| IV. Das Maß der erforderlichen Bestimmtheit des ermächtigenden Gesetzes | 126 | ||
| Zweiter Abschnitt: Das Legislativorgan der Kammer | 128 | ||
| I. Die funktionalen Bereiche der Berufskammern | 128 | ||
| 1. Kammern als Organe der Staatsverwaltung | 128 | ||
| 2. Autonomer Bereich der Kammer | 128 | ||
| 3. Verhältnis beider Bereiche | 129 | ||
| 4. Einordnung der Berufsordnungen | 130 | ||
| II. Modelle für die kammerinterne Willensbildung | 130 | ||
| 1. Modell der staatlichen Verwaltung | 130 | ||
| 2. Modell des bürgerlichen Vereinsrechts | 131 | ||
| 3. Demokratisches Modell („innerkörperschaftliche Demokratie | 131 | ||
| a) Demokratische Willensbildung bei anderen Verbänden und bei Parteien | 132 | ||
| b) Kriterien für die Anwendbarkeit des demokratischen Modells | 133 | ||
| c) Anwendung des demokratischen Modells auf die Beschlußfassung der Kammern | 133 | ||
| d) Die plebiszitäre und die repräsentative Komponente bei der „innerkörperschaftlichen Demokratie" | 134 | ||
| aa) Betonung des plebiszitären Elements | 135 | ||
| bb) Betonung des repräsentativen Elements | 135 | ||
| cc) Anwendung auf Berufsordnungen | 136 | ||
| III. Auswirkungen der innerkörperschaftlichen Demokratie auf den Erlaß von Berufsordnungen | 137 | ||
| Dritter Abschnitt: Staatliche Beteiligung am Zustandekommen der Berufsordnungen | 140 | ||
| I. Grundlagen einer staatlichen Beteiligung | 140 | ||
| 1. Unbeschränkte Kompetenz des Gesetzgebers im Rahmen der Verfassung | 140 | ||
| 2. Ministerverantwortlichkeit | 140 | ||
| 3. Integrationserfordernis heutiger Staatlichkeit | 141 | ||
| 4. Rechtspolitische Bedeutung der Staatsaufsicht | 141 | ||
| II. Minimalumfang der Staatsaufsicht | 142 | ||
| III. Maximalumfang der Staatsaufsicht | 143 | ||
| 1. Zweckmäßigkeitsprüfung | 143 | ||
| 2. Kernbereich und „eigener Wirkungskreis" | 144 | ||
| 3. Weisungsrecht | 145 | ||
| 4. Genehmigung der Berufsordnung | 146 | ||
| 5. Organe der Staatsaufsicht | 148 | ||
| 6. Mittel der Staatsaufsicht | 148 | ||
| Vierter Abschnitt: Der persönliche Umfang der Regelungegewalt | 148 | ||
| I. Kammermitglieder | 148 | ||
| II. Außenseiter-, Minderheitenschutz | 150 | ||
| III. Nichtmitglieder | 151 | ||
| Fünfter Abschnitt: Der zeitliche Umfang der Regelungegewalt | 153 | ||
| I. Wirkung für die Zeit vor der Berufsaufnahme | 153 | ||
| II. Wirkung während der Berufstätigkeit | 154 | ||
| III. Wirkung für den Verlust der Berufszulassung | 155 | ||
| IV. Wirkung für die Zeit nach Beendigung der Berufszulassung | 156 | ||
| Sechster Abschnitt: Der sachliche Umfang der Regelungsgewalt | 157 | ||
| I. Generelle und spezifizierte Aufgabenumschreibung im ermächtigenden Gesetz | 157 | ||
| II. „öffentliche" und „staatliche" Aufgaben | 158 | ||
| III. „Gemeinschaftsgut" | 159 | ||
| Thesen | 163 | ||
| Verzeichnis der Gesetze und Berufsordnungen | 165 | ||
| Literaturverzeichnis | 170 |
