Berufliche Weiterbildung in europäischer Perspektive
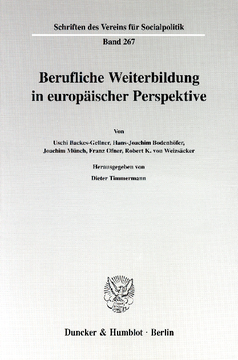
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Berufliche Weiterbildung in europäischer Perspektive
Editors: Timmermann, Dieter
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 267
(1999)
Additional Information
Book Details
Abstract
Berufliche Weiterbildung ist selten Gegenstand bildungsökonomischer Analysen gewesen. Die Autoren des vorliegenden Bandes widmen sich dieser Thematik in europäischer Perspektive.J. Münch stellt die Frage, ob von einem »europäischen System« der Weiterbildung die Rede sein könne. Er analysiert die Weiterbildungsstrukturen verschiedener europäischer Länder sowie deren Finanzierungsmuster und fragt nach den Kostenstrukturen der beruflichen Weiterbildung. H.-J. Bodenhöfer und F. Ofner untersuchen, welche Optionen jungen Österreichern im Anschluß an eine erfolgreiche Lehre offen stehen und welcher Stellenwert beruflicher Weiterbildung zukommt. Sie fragen dabei nach den Wechselwirkungen zwischen Lebenssituation, Motivation und Weiterbildungserfolg unter den Jugendlichen. U. Backes-Gellner beobachtet, daß evidente Differenzen in den Berufsausbildungsarrangements der europäischen Länder bestehen und leitet daraus die Frage nach Konvergenztendenzen zwischen den Berufsausbildungssystemen der europäischen Länder ab. Dabei sucht die Autorin nach betrieblichen Bildungsstrategien, die für Konvergenz- oder Divergenztendenzen verantwortlich sein könnten. R. v. Weizsäcker nimmt das fundamentale Problem des Zusammenhangs von Chancengleichheit, Statusmobilität und öffentlichen Bildungsinvestitionen in den Blick. Ihm geht es vorrangig um die Frage, ob hinter stabilen Einkommensverteilungsrelationen ein hohes oder niedriges Maß an individueller und sozialer Mobilität steht, d.h. ob das Chancengleichheitsziel mit dem Mobilitätsziel kompatibel ist. Alle vier Beiträge gelangen zu interessanten und z. T. überraschenden Ergebnissen.
