Wirtschaftsethische Perspektiven VI
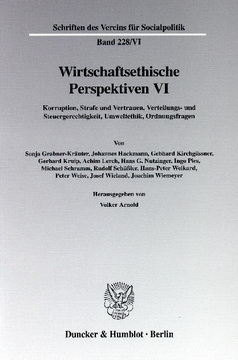
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Wirtschaftsethische Perspektiven VI
Korruption, Strafe und Vertrauen, Verteilungs- und Steuergerechtigkeit, Umweltethik, Ordnungsfragen
Editors: Arnold, Volker
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 228/VI
(2002)
Additional Information
Book Details
Abstract
Der vorliegende Band "Wirtschaftsethische Perspektiven VI" enthält die überarbeiteten Beiträge des Großteils der Vorträge, die während zweier Sitzungen des Ausschusses "Wirtschaftswissenschaften und Ethik" im Verein für Socialpolitik in Regensburg (2000) und in Hamburg (2001) gehalten worden sind. In diesem Ausschuss, dem Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen und Theologen der beiden großen christlichen Kirchen angehören, werden seit vielen Jahren sowohl theoretische wie auch praktische Problemstellungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik aus den verschiedenen Blickwinkeln heraus interdisziplinär diskutiert. Die Ergebnisse der vorangegangenen Diskussionen sind in den "Wirtschaftsethischen Perspektiven I-V" dokumentiert.Die Beiträge des neuesten Bandes der "Wirtschaftsethischen Perspektiven" enthalten mit Themen zu "Korruption, Bestechung und Strafe" einen ersten Schwerpunkt. Probleme der Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit werden sodann aus der Sicht der Finanzwissenschaft und der katholischen Soziallehre diskutiert. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Abhandlungen über wichtige Fragen der Umweltethik. Wie weit darüber hinaus das Spektrum der im Ausschuss diskutierten Problemfelder ist, zeigen die Beiträge zu den Wurzeln des Besitzindividualismus, die bereits in der Spätscholastik zu finden sind, zur Frage nach einer Verbesserung der Marktchancen der Katholischen Kirche durch ein identitätsorientiertes Kirchenmarketing und zum Spannungsfeld zwischen Individual- und Institutionenethik, das unter dem zentralen Gesichtspunkt der Abwanderungskosten analysiert wird.Alle Beiträge haben ein ausschussinternes Gutachterverfahren durchlaufen.
