Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat
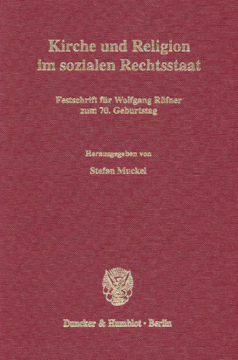
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat
Festschrift für Wolfgang Rüfner zum 70. Geburtstag
Editors: Muckel, Stefan
Staatskirchenrechtliche Abhandlungen, Vol. 42
(2003)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Fragen von "Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat" eröffnen ein Themenspektrum, das gleichermaßen vielfältig wie aktuell ist. Nicht selten werden scheinbare Antworten so tagesaktuell und daher oft emotional präsentiert, dass es einer begleitenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Maß und Mitte bedarf. Die Basis für den fundierten Umgang mit den in Zahl und Art vielgestaltigen Einzelfragen bildet dabei die Verankerung im Verfassungsrecht. Das Verhältnis von Staat und Kirche findet hier seine Grundlage ebenso wie die grundrechtlich verbürgten Rechte des Einzelnen und der einzelnen Religionsgemeinschaft. Das vom Grundgesetz gewährte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen eröffnet zudem die Betrachtung des Kirchenrechts als autonomes Recht innerhalb der Gemeinschaft, das seinerseits jedoch nicht losgelöst steht, sondern in Fragen etwa der innerkirchlichen Demokratie, des staatlichen Rechtsschutzes sowie des Dienst-, Arbeits- und Sozial(versicherungs)rechts an das staatliche Recht anknüpft.Den so verstandenen Fragen von Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat widmet sich Wolfgang Rüfner. Sinn für Maß und Mitte zog und zieht er in seinem Wirken aus der Fähigkeit zur wissenschaftlich kritischen Reflexion. Dieser Sinn ist leitend für seine Arbeit im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, im Sozialrecht und insbesondere auf dem Gebiet des Staatskirchenrechts, das seinerseits durch das Schaffen Wolfgang Rüfners seine Prägung erfahren hat. Seine wissenschaftlichen Leistungen sind auf vielen Gebieten zu würdigen; er selbst hat das Staatskirchenrecht in den zurückliegenden Jahren zu einem besonderen Schwerpunkt seines Wirkens gemacht.Der 70. Geburtstag Wolfgang Rüfners am 8. September 2003 gibt 51 Autorinnen und Autoren Anlass, ihrerseits einen weiteren Teil zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat beizutragen und die in dieser Festschrift gebündelten Gedanken und Erkenntnisse dem Jubilar in Hochachtung und Dankbarkeit zu überreichen.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Peter Axer: Die Kirchensteuer als gemeinsame Angelegenheit von Staat und Kirche | 13 | ||
| I. Kirchensteuer in der Kritik | 14 | ||
| II. Die Kirchensteuer vor den Gerichten | 16 | ||
| III. Die Kirchensteuer als Thema von staatlichem und kirchlichem Recht | 17 | ||
| 1. Kirchensteuererhebung aufgrund verfassungsrechtlicher Beleihung | 17 | ||
| 2. Die historischen Grundlagen der Kirchensteuer | 20 | ||
| 3. Kirchensteuer aufgrund bürgerlicher Steuerlisten nach Maßgabe des Landesrechts | 21 | ||
| 4. Die kirchlichen Regelungen | 23 | ||
| 5. Vereinbarkeit unterschiedlicher Hebesätze mit Art. 3 Abs. 1 GG? | 24 | ||
| 6. Kirchensteuereinzug im Lohnsteuerabzugsverfahren? | 27 | ||
| IV. Die Kirchensteuer - Auslaufmodell oder Finanzierungsinstrument der Zukunft? | 29 | ||
| Manfred Baldus: Katholische Freie Schulen im Kontext der europäischen Rechtsangleichung | 33 | ||
| I. Aktuelle europarechtspolitische Diskussion | 33 | ||
| II. Übersicht zur Rechtslage des katholischen Freien Schulwesens in Europa | 37 | ||
| 1. Verfassungs- und konkordatsrechtliche Grundlagen | 37 | ||
| 2. Kurzbericht zur Rechtslage der katholischen Schulen in den EU-Mitgliedstaaten | 40 | ||
| a) Belgien | 40 | ||
| b) Dänemark | 42 | ||
| c) Deutschland | 42 | ||
| d) Finnland | 43 | ||
| e) Frankreich | 44 | ||
| f) Griechenland | 44 | ||
| g) Großbritannien u. Nordirland | 45 | ||
| h) Irland | 46 | ||
| i) Italien | 47 | ||
| j) Luxemburg | 48 | ||
| k) Niederlande | 48 | ||
| l) Österreich | 49 | ||
| m) Portugal | 50 | ||
| n) Schweden | 51 | ||
| o) Spanien | 51 | ||
| III. Bezugsfelder zwischen EU-Recht und mitgliedstaatlichem Privatschulrecht katholischer Schulen | 52 | ||
| 1. Stellungnahmen und schulrechtliche Vorgaben der katholischen Kirche | 52 | ||
| 2. Bildungsrechtliche Elemente des Europarechts | 56 | ||
| a) Gemeinsame Verfassungsüberlieferung | 56 | ||
| b) Privatschulfreiheit als Merkmal der nationalen Identität | 57 | ||
| c) Privatschulfreiheit als Ausfluß des Elternrechts (Art. 14 Abs. 3 EuGrRCh) | 58 | ||
| d) Privatschulfreiheit als Ausdruck der unternehmerischen Freiheit? (Art. 16 EuGrRCh) | 58 | ||
| e) Rechte und Pflichten aus konkordatsrechtlichen Beziehungen der Mitgliedstaaten | 58 | ||
| f) Bildungsrechtliche Zuständigkeiten der Union (Art. 3 Abs. 1 lit. q, 149 [ex Art. 126] EG-V) | 59 | ||
| 3. Auswirkungen des allgemeinen Gemeinschaftsrechts auf den Status katholischer Schulen im mitgliedstaatlichen Schulrecht | 60 | ||
| IV. Perspektiven | 64 | ||
| Axel Freiherr: Rechtsprobleme der Grundrechtsförderung jüdischer Gemeinden durch staatliche Leistungen | 67 | ||
| Gerhard Czermak: Öffentliche Schule, Religion und Weltanschauung in Geschichte und Gegenwart der Bundesrepublik Deutschland | 79 | ||
| I. Einleitung und Vorgeschichte | 79 | ||
| II. Schule in der Adenauer-Ära | 81 | ||
| 1. Zur Situation nach 1945 | 81 | ||
| 2. Vom Parlamentarischen Rat zum Grundgesetz | 82 | ||
| 3. Das Konfessionsschulwesen in der Phase staatskirchenrechtlicher Euphorie | 84 | ||
| III. Probleme der Christlichen Gemeinschaftsschule | 88 | ||
| 1. Die Schulentscheidungen des BVerfG von 1975 | 88 | ||
| 2. Folgeprobleme | 90 | ||
| 3. Einzelfragen | 91 | ||
| a) Schulgebet | 91 | ||
| b) Zur Unzulässigkeit ideologischer Beeinflussung der Schüler | 92 | ||
| 4. Missionierung als Erziehungsmittel? | 96 | ||
| IV. Religion und Weltanschauung als aktuelles schulisches Konfliktfeld | 99 | ||
| 1. Unterrichtsbefreiung aus religiösen Gründen | 99 | ||
| 2. Das Kreuz/Kruzifix im Klassenzimmer | 100 | ||
| 3. Religionsunterricht (RU) | 102 | ||
| 4. Ethikunterricht (EU) | 103 | ||
| 5. Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde (LER) | 106 | ||
| 6. Islam in der Schule | 107 | ||
| V. Religiös-weltanschauliche Neutralität als nur verbale oder wirkliche Kategorie des Verfassungsrechts? | 108 | ||
| Otto Depenheuer: Auf der Suche nach der verlorenen Einheit. Carl Ernst Jarcke und die religiöse Fundierung von Recht und Staat | 111 | ||
| I. Staat und Kirche zwischen Einheit und Differenz | 111 | ||
| II. Ein konservativer Konvertit im Kampf gegen die Revolution | 113 | ||
| III. Die Wahrheit des Glaubens als Grundlage politischer Einheit | 115 | ||
| IV. Jarcke und das Dilemma der Kirche in der pluralistischen Gesellschaft | 120 | ||
| V. Einheit in Differenz: der Ort und die Aufgabe der Kirche | 125 | ||
| Johannes Dietlein: Das Feiertagsrecht in Zeiten des religiösen Wandels | 131 | ||
| I. Einführung | 131 | ||
| II. Entwicklungsgeschichte der verfassungsrechtlichen Feiertagsgarantie | 132 | ||
| III. Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV als institutionelle Garantie | 135 | ||
| IV. Verfassungsrechtliche Direktiven im Hinblick auf die Bestimmung staatlich anerkannter Feiertage | 137 | ||
| 1. Der formelle Gewährleistungsgehalt: Form und Zuständigkeit | 137 | ||
| 2. Der materielle Gewährleistungsgehalt des Art. 140 GG i. V. m. Art. 139 WRV | 139 | ||
| 3. Schutzberechtigung der institutionellen Garantie | 144 | ||
| Christoph Grabenwarter: Die korporative Religionsfreiheit nach der Menschenrechtskonvention | 147 | ||
| I. Einleitung | 147 | ||
| II. Das Recht auf Gründung und rechtliche Anerkennung religiöser Vereinigungen als Ausgangspunkt der korporativen Religionsfreiheit | 149 | ||
| III. Das Selbstbestimmungsrecht von Kirchen und Religionsgemeinschaften | 153 | ||
| IV. Das Leitbild eines säkularen demokratischen Rechtsstaats | 156 | ||
| Felix Hammer: Kirchenbauten in Staatseigentum unter dem Grundgesetz und kirchliche Veränderungs- und Umgestaltungswünsche hieran | 159 | ||
| I. Kirchenbauten und Kirchenräume in Staatseigentum im Kontext der religionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen und des Verwaltungsrechts von Bund und Ländern | 159 | ||
| II. Vorkommen von Kirchengebäuden und Kirchenräumen in Staatseigentum in Deutschland | 162 | ||
| 1. Säkularisierte Kirchengebäude | 162 | ||
| 2. Kirchenräume in Justizvollzugsanstalten, in Krankenhäusern, in militärischen Anlagen und vergleichbare Fälle | 166 | ||
| III. Bestimmungsrecht über die Gestaltung von Kirchenräumen in Staatseigentum | 167 | ||
| 1. Eigentumsrecht des Staates | 167 | ||
| 2. Staatliches Denkmalschutzrecht | 171 | ||
| 3. Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen | 174 | ||
| IV. Kostenlast für Veränderungen von Kirchenräumen in Staatseigentum aufgrund kirchlicher Vorstellungen | 175 | ||
| Peter Hanau: Neue Wege zur Verbindung von Flexibilität und Sicherheit in der Beschäftigung | 177 | ||
| I. Alternative Wege | 177 | ||
| 1. Der bisherige deutsche Weg: Sicherheit vor Flexibilität im Arbeitsverhältnis | 177 | ||
| 2. Der amerikanische Weg: Flexibilität vor Sicherheit | 177 | ||
| 3. Der neue europäische Weg: Flexibilität und Sicherheit (Flexicurity) | 178 | ||
| II. Zehn Wegweiser des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) | 178 | ||
| III. Die Wegweisungen der Hartz-Kommission | 179 | ||
| 1. Grundsätzliche Wendung zu Flexicurity, insbesondere durch Anerkennung der beschäftigungshemmenden Wirkungen des Kündigungsschutzes | 179 | ||
| 2. Mängel des Konzepts | 180 | ||
| IV. Enttäuschungen durch die Neuregelung | 180 | ||
| 1. Arbeitnehmerüberlassung | 180 | ||
| 2. Befristungsfreiheit bei Einstellung von Arbeitnehmern, die das 52. Lebensjahr bereits vollendet haben | 181 | ||
| 3. Neue Selbstständigkeit durch Ich- und Familien- AGs | 182 | ||
| V. Beseitigung von Beschäftigungshemmnissen im Normalarbeitsverhältnis und in der Betriebsverfassung | 183 | ||
| 1. Abschwächung der Konkurrenz zwischen Normalarbeitsverhältnissen einerseits, flexibilisierten und subventionierten Beschäftigungsverhältnissen andererseits | 183 | ||
| 2. Kündigungsschutz durch Abfindung statt durch gerichtliche Klage | 184 | ||
| 3. Längere Beschäftigung durch längere Befristung | 184 | ||
| 4. Erhöhte interne Flexibilität von Arbeitsverhältnissen | 185 | ||
| 5. Beseitigung eines systemwidrigen und schädlichen Hindernisses für die Berufsausbildung im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) | 185 | ||
| VI. Soziale Überbrückung verschiedener Beschäftigungsund Nichtbeschäftigungszeiten | 185 | ||
| 1. Die Aufgabe | 185 | ||
| 2. Zusätzliche Altersversorgung | 186 | ||
| 3. Insolvenzsicherung von Wertguthaben | 186 | ||
| 4. Einbeziehung Selbstständiger in die Sozialversicherung? | 187 | ||
| VII. Ausblick | 187 | ||
| Martin Heckel: Thesen zum Staat-Kirche-Verhältnis im Kulturverfassungsrecht | 189 | ||
| I. Bedeutungswandel des Weimarer Staatskirchenrechts? | 189 | ||
| II. Säkularisierung des Staates - ohne Säkularisierung religiöser Gehalte | 192 | ||
| III. Religionsfreiheit als positive und negative Rahmengarantie | 194 | ||
| IV. Der Gleichheitssatz der Verfassung und das Verbot religiöser Privilegierung | 198 | ||
| V. Religiöse Neutralität: Ignorierung oder Respektierung konfessioneller Momente? | 200 | ||
| VI. Trennung und Kooperation von Staat und Kirche | 201 | ||
| VII. Kulturverfassungsrecht und Staatskirchenrecht: Spannung und Übereinstimmung | 202 | ||
| VIII. Ausgleich durch die Maßstabklausel in den gemeinsamen Angelegenheiten | 204 | ||
| IX. Zu Kultur und Religion in der Erziehung | 206 | ||
| X. Die theologischen Fakultäten | 209 | ||
| Jochen Heide: Zuwendungs- und Testierverbote gemäß § 14 Heimgesetz | 217 | ||
| I. Einführung | 217 | ||
| II. Das Testierverbot des § 14 HeimG in der Rechtsprechung | 218 | ||
| III. Verfassungsrechtliche Einwände | 220 | ||
| IV. Genehmigungsverfahren | 221 | ||
| V. Besonderheiten bei kirchlicher Trägerschaft | 223 | ||
| VI. Stellungnahme | 224 | ||
| VII. Zusammenfassung | 226 | ||
| Ansgar Hense: Das Schicksal der Kirchenglocken im Ersten und Zweiten Weltkrieg | 227 | ||
| I. Einleitende Fragestellung und Anlaß | 227 | ||
| II. Die Glockenabnahmen im Ersten und Zweiten Weltkrieg | 229 | ||
| 1. Modalitäten der Glockenablieferung zu Kriegszwecken im Jahre 1917 | 230 | ||
| 2. Die systematische Ablieferungspflicht von Kirchenglocken im Zweiten Weltkrieg | 235 | ||
| a) Rechtsgrundlage: Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans vom 15. März 1940 | 235 | ||
| b) Durchführungsbestimmungen zur Glockenablieferung, die kirchlichen Reaktionen und der Beginn der systematischen Glockenabnahme 1941 /1942 | 236 | ||
| c) Die Praxis der Glockenablieferung | 243 | ||
| 3. Die Glockenrückführung nach dem Zweiten Weltkrieg | 244 | ||
| a) Akteur und Motor der Glockenrückgabe: Ausschuß für die Rückführung der Glocken e.V. | 245 | ||
| b) Die Rückgabe der erhaltenen Glocken | 246 | ||
| c) Die sog. Leihglocken | 247 | ||
| d) Die Glockenscherben | 248 | ||
| e) Exkurs: Kriegsfolgenrechtliche Entschädigungsansprüche wegen der Glockenablieferung | 249 | ||
| III. Rechtliche Qualifikation der Glockenablieferung im Zweiten Weltkrieg | 250 | ||
| 1. Das Beurteilungsdilemma | 250 | ||
| 2. Stellungnahmen zur Rechtsnatur der Glockenablieferung im Überblick | 251 | ||
| a) Rechtsqualifikation aus der Zeit des Nationalsozialismus | 251 | ||
| b) Das Rechtsgutachten Hans Peter Ipsens vom 22. Mai 1949 zum Eigentum an den Glockenscherben | 252 | ||
| c) Die Glocken-Prozesse in den 1950er Jahren als juristische Referenz | 255 | ||
| d) Innerkirchliche Stellungnahmen | 256 | ||
| e) Zwischenfazit | 257 | ||
| 3. Die Glockenablieferung in der nationalsozialistischen Herrschaftsordnung | 258 | ||
| a) Kein Schutz der Glocken durch Art. 153 WRV | 258 | ||
| b) Nationalsozialistischer Umbau der Eigentumsverfassung | 260 | ||
| aa) Grundsätzliches im Überblick | 260 | ||
| bb) Zwischenschritt: Rechtsqualifikation der Glockenablieferung vor diesem Hintergrund | 262 | ||
| c) Schutz der Kirchenglocken durch Art. 138 Abs. 2 WRV und kirchenvertragliche Bestimmungen? | 266 | ||
| d) Der Rechtsstatus der Kirchenglocken als res sacrae und die Glockenabnahme | 268 | ||
| aa) Die Widmung der Kirchenglocken zu einer kirchlich-"öffentlichen Sache" | 268 | ||
| bb) Entwidmung der Kirchenglocken zwischen Abnahme und Einschmelzung? | 270 | ||
| 4. Resümee: Bundesrepublik Deutschland als „ eingeschränkter Eigentümer " der Leihglocken | 273 | ||
| IV. Mit der Rückübertragung verbundene Rechtsprobleme | 276 | ||
| 1. Die Rückgabe katholischer Kirchenbücher im Jahre 2001 als Referenz | 277 | ||
| 2. Rückgabeverpflichtung der Bundesrepublik Deutschland | 279 | ||
| a) Vorbedingung: Friedensvertrag | 279 | ||
| b) Eigenständige Rückverschaffungspflicht oder bloßer Retraktanspruch hinsichtlich der Leihglocken | 280 | ||
| 3. Das rechtliche Schicksal der Kirchengemeinden in den Vertreibungsgebieten und deren Auswirkung auf die Leihglockenproblematik | 281 | ||
| a) Leihglocken aus evangelischen Kirchengemeinden in den Ostgebieten | 282 | ||
| b) Leihglocken aus katholischen Kirchengemeinden in den Ostgebieten | 287 | ||
| aa) Grundsätzliches zum kirchlichen Eigentumsrecht | 287 | ||
| bb) Fortbestand der katholischen Kirchengemeinden? | 289 | ||
| cc) Mögliche Bedeutung der Diözesanregelung 1972 für die ortskirchliche Rechtsstruktur | 290 | ||
| dd) Erlöschen der Kircheninstitute als Eigentümer nach kirchlichem und staatlichem Recht zwischen 1945 bis 1989? | 291 | ||
| 4. Die Rückgabe katholischer Leihglocken als konzertierte Aktion - rechtliche und praktische Gesichtspunkte | 293 | ||
| a) Mögliche Rückerstattungsdestinatäre | 293 | ||
| aa) Die ortskirchliche Lösung | 294 | ||
| bb) Die Diözesan-Lösung | 294 | ||
| b) Glockenrückgabe als res mixta | 295 | ||
| V. Vorläufiger Schluß | 296 | ||
| Christian Hillgruber: Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und die Jurisdiktionsgewalt des Staates | 297 | ||
| I. Einleitung | 297 | ||
| II. Das Verhältnis des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgesellschaften zur staatlichen Justizhoheit | 300 | ||
| III. Die (ausschließlich) eigenen Angelegenheiten der Religionsgesellschaften | 306 | ||
| IV. Die Letztverantwortung des Rechtsstaates für das Gemeinwohl als Begründung einer Reservekompetenz für staatliche Jurisdiktion in kircheneigenen Angelegenheiten | 309 | ||
| V. Das vorzeitige Ende des seelsorgerischen Dienstes eines Priesters auf Mallorca: Ein Fall für die staatlichen Gerichte? | 312 | ||
| VI. Freiheitsgewährleistung und Rechtsmissbrauch | 314 | ||
| Stephan Hobe: Die Verbürgung der Religionsfreiheit in der EU-Grundrechtecharta | 317 | ||
| I. Einleitung | 317 | ||
| II. Die Gewährleistungsgehalte der Grundrechtecharta im Bereich der Religionsfreiheit - Schutzbereich und Schranken | 318 | ||
| 1. Schutzbereich (inkl. Präambel) | 318 | ||
| 2. Schrankenregelung | 320 | ||
| a) Dogmatik | 320 | ||
| b) Bisherige Rechtsprechung | 322 | ||
| c) Bewertung | 323 | ||
| III. Einige vorläufige Schlussfolgerungen und Fragen | 324 | ||
| 1. Zur Verbindlichkeit der Grundrechtecharta | 324 | ||
| 2. Probleme durch die Schrankenregelung | 325 | ||
| 3. Die ungeklärte Frage des Rechtsschutzes und der Rechtswege in Europa | 326 | ||
| IV. Ausblick | 327 | ||
| Wolfram Höfling: Kopernikanische Wende rückwärts? Zur neueren Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts | 329 | ||
| I. Problemaufriß | 329 | ||
| II. Das Schächt-Urteil und der Osho-Beschluß - eine kritische Analyse | 330 | ||
| 1. Das Schächt-Urteil | 330 | ||
| 2. Der Osho-Beschluß | 332 | ||
| III. Das neue „Konzept": Schwächung der grundrechtlichen Maßstabskraft | 334 | ||
| 1. Die Figur der Schutzbereichs „Verstärkung" | 335 | ||
| 2. Zum Tatbestandsverständnis | 336 | ||
| 3. Grundrechtstatbestand, Schutzgutbeeinträchtigung und Eingriffsrechtfertigung: Rechtsstaatliche Rationalität der Grundrechtsdogmatik | 338 | ||
| IV. Schlussbemerkungen | 340 | ||
| Alexander Hollerbach: Zum staatskirchenrechtlichen Diskurs im deutschen Katholizismus der Nachkriegszeit | 341 | ||
| I. | 341 | ||
| II. | 343 | ||
| III. | 347 | ||
| IV. | 350 | ||
| V. | 353 | ||
| Josef Isensee: Private islamische Bekenntnisschulen. Zur Ausnahme vom Verfassungsprinzip der für alle gemeinsamen Grundschule | 355 | ||
| I. Eine vergessene staatskirchenrechtliche Option: Art. 7 Abs. 5. GG | 355 | ||
| II. Grundlagen und Grenzen der Privatschulfreiheit im Grundgesetz | 356 | ||
| 1. Ersatz- und Ergänzungsschulen (Art. 7 Abs. 4 GG) | 356 | ||
| 2. Private Volksschulen | 357 | ||
| III. Der verfassungsrechtliche Vorrang der öffentlichen Grundschule | 359 | ||
| 1. Der Weimarer Schulkompromiß | 359 | ||
| a) Bildung „durch öffentliche Anstalten" | 359 | ||
| b) „Für alle gemeinsame Grundschule" | 359 | ||
| 2. Der grundsätzliche Vorrang der öffentlichen Grundschule unter dem Grundgesetz | 360 | ||
| 3. Verfassungsstaatlicher Sinn des Vorrangs der öffentlichen Grundschule | 361 | ||
| 4. Politische Tendenz zur Ausweitung der Grundschulzeit | 363 | ||
| IV. Die Ausnahmetatbestände des Art. 7 Abs. 5 GG im System der Verfassung | 363 | ||
| V. Die private Bekenntnisschule im Lichte der Judikatur | 365 | ||
| 1. Antrag der Erziehungsberechtigten | 366 | ||
| 2. Projekt einer Bekenntnisschule | 367 | ||
| a) Prägung durch ein Bekenntnis | 367 | ||
| b) Formale Strukturen des Bekenntnisses und seiner Organisation | 368 | ||
| aa) Was ist ein Bekenntnis? | 368 | ||
| bb) Organisatorische Konsistenz des Bekenntnisses | 369 | ||
| cc) Ergebnis | 371 | ||
| VI. Kompatibilität der islamischen Bekenntnisschule mit dem Konzept des Ausnahmetatbestandes nach Art. 7 Abs. 5 GG | 373 | ||
| 1. Grundrechtliche Öffnung des Schulartikels? | 373 | ||
| a) Deutung aus der Religionsfreiheit | 373 | ||
| b) Institutioneller Überhang des Art. 7 Abs. 5 GG | 375 | ||
| 2. Historische Reduktion | 376 | ||
| 3. Staatskirchenrecht unter Kulturvorbehalt | 377 | ||
| 4. Private Grundschulen unter Integrationsvorbehalt | 378 | ||
| Josef Jurina: Der Status von Kirchen und Religionsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Alltag | 381 | ||
| I. | 382 | ||
| II. | 383 | ||
| III. | 389 | ||
| IV. | 396 | ||
| Burkhard Kämper: Eingetragene Lebenspartnerschaft und kirchlicher Dienst | 401 | ||
| I. Die Lebenspartnerschaft im internationalen Kontext | 402 | ||
| II. Grundzüge der eingetragenen Lebenspartnerschaft | 403 | ||
| III. Vereinbarkeit mit Art. 6 Abs. 1 GG | 404 | ||
| 1. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts | 404 | ||
| 2. Positionen in der Literatur | 406 | ||
| IV. Kirchliche Standpunkte | 410 | ||
| 1. Evangelische Kirche | 411 | ||
| 2. Katholische Kirche | 414 | ||
| V. Arbeitsrechtliche Folgen im kirchlichen Dienst | 415 | ||
| 1. Rechtlicher Rahmen | 415 | ||
| 2. Kirchliche Ansatzpunkte | 417 | ||
| 3. Öffentliche Diskussion | 420 | ||
| VI. Ausblick | 421 | ||
| Karl-Hermann Kästner: Entscheidungsmaßstäbe und Prüfungsbefugnis kirchlicher Gerichte in den evangelischen Kirchen | 423 | ||
| I. Kirchliche Judikatur als Rechtsanwendung | 424 | ||
| 1. Die Anwendung von Kirchenrecht | 425 | ||
| 2. Die Bindung an Schrift und Bekenntnis | 428 | ||
| 3. Die Anwendung von Normen und Prinzipien staatlichen Rechts | 433 | ||
| II. Die Kontrolle kirchlichen Rechts | 437 | ||
| Paul Kirchhof: Die Kirchensteuer in der Entwicklung des staatlichen Steuerrechts | 443 | ||
| I. Der kirchliche Beitrag zur Freiheitsfähigkeit der Gesellschaft | 444 | ||
| II. Freigebige Spende oder steuerliche Pflicht | 447 | ||
| III. Der Gegenstand der Kirchensteuer | 448 | ||
| IV. Die Berücksichtigung familiären Bedarfs bei der Kirchensteuer | 451 | ||
| V. Kirchensteuer bei entindividualisierter Maßstabsteuer | 452 | ||
| VI. Kirchensteuer oder Staatsfinanzierung? | 455 | ||
| VII. Kirchensteuer als Teil des Staatskirchenrechts | 457 | ||
| Winfried Kluth: Der Preis der Gewissensfreiheit im weltanschaulich pluralen Leistungsstaat | 459 | ||
| I. Gewissensfreiheit und Verantwortungsverschränkungen im modernen Leistungsstaat | 459 | ||
| II. Gewissenskonflikte in staatlich organisierten Lebensbereichen | 462 | ||
| 1. Konfliktsituationen und Konflikttypen | 462 | ||
| 2. Beispiele aus dem Bereich des Gesundheitswesens | 464 | ||
| a) Die Zunahme ethisch umstrittener Maßnahmen im Gesundheitswesen | 464 | ||
| b) Auswirkungen auf den Ärztestand | 468 | ||
| c) Auswirkungen auf die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen | 470 | ||
| d) Zusammenfassende Würdigung | 470 | ||
| III. Der Streit um den Schutzbereich der Gewissensfreiheit | 471 | ||
| 1. Die einzelnen Positionen | 471 | ||
| 2. Grundrechtdogmatische Verortung der Problematik | 472 | ||
| IV. Wege zu einem neuen Lösungsansatz | 474 | ||
| 1. Schwächen herkömmlicher Lösungsmodelle | 474 | ||
| 2. Die Problematik der „lästigen und zumutbaren Alternativen" | 475 | ||
| 3. Zurechnungskriterien in Solidargemeinschaften | 478 | ||
| 4. Differenzierung nach Konfliktarten | 479 | ||
| V. Zusammenfassung und Ausblick | 480 | ||
| Martin Kriele: Die Kirchen und die Menschenwürde | 481 | ||
| I. Menschenwürde und weltanschauliche Neutralität | 481 | ||
| 1. Warum der Konsens brüchig ist | 481 | ||
| 2. Die allgemein-religiöse Perspektive | 482 | ||
| 3. Der esoterische Kern des Christentums | 484 | ||
| 4. Die Lehre aus der nationalsozialistischen Katastrophe | 485 | ||
| 5. Art. 4 IGG gegen Art. 1 I GG | 486 | ||
| 6. Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht | 487 | ||
| II. Die Kirchen und das Persönlichkeitsrecht | 488 | ||
| 1. Die neuen Weltanschauungskampagnen | 488 | ||
| 2. Beispiele | 489 | ||
| 3. Die Alternative: Wissenschaft oder Glaube? | 491 | ||
| 4. Die kirchliche Mitwirkung | 493 | ||
| 5. Schluß | 495 | ||
| Joachim Lang: Staatsloyalität kirchensteuerberechtigter Religionsgemeinschaften | 497 | ||
| I. Einleitung | 497 | ||
| II. Kirchensteuerberechtigung und kooperative Rechtsetzungskompetenz der Religionskörperschaften | 498 | ||
| III. Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts | 500 | ||
| IV. Kirchensteuerberechtigung und staatliche Rechtsordnung | 506 | ||
| V. Staatsloyalität als innere Rechtstreue | 507 | ||
| VI. Resümee | 509 | ||
| Christoph Link: Grundrechtsschutz für Sozialversicherungsträger? Aktuelle Anmerkungen zu einem alten Problem | 511 | ||
| I. Die Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen des öffentlichen Rechts | 512 | ||
| 1. Die „klassische Trias" der Ausnahmen | 513 | ||
| 2. Die prozessualen Grundrechte | 514 | ||
| 3. Differenzierungen in der neueren Judikatur des BVerfG? | 515 | ||
| II. Grundrechtsschutz für Allgemeine Ortskrankenkassen? | 518 | ||
| 1. Sozialversicherung im Grenzhereich von Staat und Gesellschaft | 518 | ||
| a) Solidargemeinschaft und Selbstverwaltung | 519 | ||
| b) Personales Substrat, nicht Sachwalter der Versicherteninteressen | 521 | ||
| 2. Die Wettbewerbssituation | 522 | ||
| 3. Mögliche Grundrechtsbeeinträchtigungen | 522 | ||
| 4. Art. 3 Abs. 1 GG | 523 | ||
| a) § 140 SGB V | 524 | ||
| b) § 311 Abs. 2 SGB V | 525 | ||
| 5. Eigentumsgarantie | 525 | ||
| a) Grundrechtsfähigkeit | 525 | ||
| b) Eingriff in das Eigentum | 527 | ||
| c) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eigentumseingriffs | 527 | ||
| 6. Sonstige Grundrechte | 528 | ||
| a) Art. 12 Abs. 1 GG | 528 | ||
| b) Art. 2 Abs. 1 GG | 529 | ||
| III. Objektivrechtliche Gehalte der Grundrechtsverbürgungen | 530 | ||
| 1. Die Eigentumsgarantie | 530 | ||
| 2. Der Gleichheitssatz | 531 | ||
| IV. Schluß | 532 | ||
| Wolfgang Loschelder: Der Kampf um das Berufsbeamtentum - zum wievielten Mal? | 535 | ||
| I. | 535 | ||
| II. | 537 | ||
| III. | 540 | ||
| IV. | 542 | ||
| V. | 547 | ||
| VI. | 550 | ||
| Heiner Marré: Der Islam in Deutschland - Historische, politische und rechtliche Überlegungen zu einem komplexen Thema | 553 | ||
| I. Historische Aspekte | 553 | ||
| II. Christen und Muslime in gemeinsamer Verantwortung für die Zukunft der Menschheit | 558 | ||
| III. Christen als Minderheiten in muslimischen Ländern | 559 | ||
| IV. Die religionsrechtliche Ordnung in der Verfassung Deutschlands und die Anwesenheit einer muslimischen Minderheit | 561 | ||
| 1. Die individuelle Religionsfreiheit | 563 | ||
| a) Kopftuch einer muslimischen Lehrerin im öffentlichen Schuldienst | 565 | ||
| b) Teilnahme muslimischer Mädchen am koedukativen Sportunterricht in der Schule | 567 | ||
| c) Der Gebetsruf des Muezzin | 567 | ||
| d) Bestattung nach islamischen Vorstellungen | 568 | ||
| 2. Korporative Religionsfreiheit, öffentlich-rechtlicher Status und Religionsunterricht für islamische Gemeinschaften | 569 | ||
| a) Muslimische Gemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Recht | 570 | ||
| b) Islamischer Religionsunterricht | 572 | ||
| V. Der Islam in Deutschland - Integration statt Konfrontation | 575 | ||
| Stefan Muckel: Der Heilige Stuhl und die Säkularisation in Deutschland | 579 | ||
| I. Einführung | 579 | ||
| II. Die päpstliche Reaktion | 580 | ||
| III. Die Motive des Papstes | 582 | ||
| 1. Die Stellung der Kirche auf der Reichsebene | 583 | ||
| 2. Die Verfassung der geistlichen Fürstentümer | 583 | ||
| 3. Kirchenrechtliche Vorgaben | 586 | ||
| 4. Politische Strömungen innerhalb der Kirche | 587 | ||
| IV. Schluss | 591 | ||
| Janbernd Oebbecke: Das „islamische Kopftuch" als Symbol | 593 | ||
| I. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts | 593 | ||
| II. Begriff und Funktionsweise von Symbolen | 594 | ||
| III. Kleidungsstück oder Symbol? | 596 | ||
| IV. Der Inhalt des Symbols | 599 | ||
| V. Rechtliche Folgerungen | 602 | ||
| Heinz-Joachim Pabst: Fallpauschalengesetz und Spielräume kirchlicher Krankenhäuser | 607 | ||
| I. Einleitung | 607 | ||
| II. Das bisherige System der Krankenhausfinanzierung auf Grundlage des KHG | 608 | ||
| 1. Das KHG im Überblick | 608 | ||
| a) Zwecksetzung des KHG | 609 | ||
| b) Durchsetzung des Gesetzeszwecks | 609 | ||
| c) Die Reichweite des KHG | 609 | ||
| 2. Die Aufbringung der Investitionskosten | 610 | ||
| 3. Die Grundsätze der Abgeltung von Krankenhausleistungen nach bisherigem Recht | 611 | ||
| a) Fallpauschalen und Sonderentgelte nach bisherigem Recht | 611 | ||
| b) Gesamtbudget und Pflegesätze als wichtigste Instrumente der bisherigen Krankenhausfinanzierung | 612 | ||
| aa) Arten der vereinbarten Pflegesätze | 613 | ||
| bb) Pflegesatzfähige Kosten | 613 | ||
| III. Die Auswirkungen des Fallpauschalengesetzes | 614 | ||
| 1. Überblick über das Fallpauschalengesetz | 614 | ||
| 2. Festlegung der Entgelte für Krankenhausleistungen | 615 | ||
| 3. Zuschläge und Abschläge | 616 | ||
| 4. Zeitplan und Fortentwicklung des Fallpauschalensystems | 617 | ||
| 5. Die zukünftige Aufbringung der Investitionskosten | 619 | ||
| IV. Das kirchliche Krankenhaus im bisherigen und zukünftigen Finanzierungssystem | 619 | ||
| 1. Das kirchliche Krankenhaus im bisherigen Finanzierungssystem | 620 | ||
| a) Abgestufte Wirkung des kirchlichen Selbstverständnisses | 620 | ||
| b) Bedenken gegen das bestehende System der Krankenhausfinanzierung und Grundsätze kirchlicher Krankenpflege | 621 | ||
| 2. Die Stellung des kirchlichen Krankenhauses unter Geltung des FPG | 623 | ||
| V. Fazit | 625 | ||
| Dietrich Pirson: Zur Mitwirkung von Laien an kirchlichen Entscheidungen | 627 | ||
| I. Kirchenrechtliche Ausgangslage | 627 | ||
| II. Entscheidungsbildung im Rahmen kirchlichen Handelns | 629 | ||
| III. „Potestas" als Vollmacht zur Entscheidungsbildung | 631 | ||
| IV. Selbständige Entscheidung durch Laien innerhalb und außerhalb der potestas | 633 | ||
| 1. Grundsätzliche Zulässigkeit | 633 | ||
| 2. Bleibende Verantwortung der Inhaber von potestas | 635 | ||
| V. Wahrnehmung der potestas durch Aufsicht | 636 | ||
| VI. Mitwirkung von Laien an Wahlen | 637 | ||
| Helmuth Pree: Der Grundlagenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staat Israel (1993) im Kontext der neueren Konkordate | 639 | ||
| I. Zur faktischen Ausgangslage und Vorgeschichte des Grundlagenvertrages | 639 | ||
| II. Der Inhalt des Abkommens | 643 | ||
| III. Das Abkommen über die Rechtspersönlichkeit katholischer Einrichtungen (1997) | 646 | ||
| IV. Der Grundlagenvertrag im Kontext der jüngeren Konkordate | 647 | ||
| V. Ausblick: Palästinaproblem und Jerusalemfrage | 649 | ||
| 1. Reaktionen in der arabischen Welt | 649 | ||
| 2. Das Basisabkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und der PLO (2000) | 650 | ||
| 3. Die Jerusalemfrage | 651 | ||
| Ulrich Preis / Stefan Greiner: Religiöse Symbole und Arbeitsrecht | 653 | ||
| I. Einleitung | 653 | ||
| II. Verfassungsrechtliche Vorfragen | 654 | ||
| 1. Schutzbereich der Religions- und Gewissensfreiheit | 654 | ||
| 2. Arbeitsrechtliche Konsequenzen | 658 | ||
| 3. Gebotene Differenzierungen | 660 | ||
| III. Das Tragen religiöser Symbole als Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht | 661 | ||
| 1. Ausdrückliche vertragliche Vereinbarung | 662 | ||
| a) Individualvereinbarung | 662 | ||
| b) Allgemeine Vertragsbedingungen | 663 | ||
| 2. Kleidung als Gegenstand ungeschriebener Nebenpflichten | 665 | ||
| 3. Begründung durch Kollektivvereinbarung | 667 | ||
| IV. Ausübung des Direktionsrechts | 670 | ||
| V. Kündigung | 671 | ||
| 1. Die vertragliche Nebenpflicht als Voraussetzung kündigungsrechtlicher Konsequenzen | 672 | ||
| 2. Kündigung bei berechtigter Leistungsverweigerung | 672 | ||
| 3. Kündigung bei unberechtigter Leistungsverweigerung | 674 | ||
| VI. Besonderheiten für bestimmte Berufsgruppen und Tätigkeiten | 675 | ||
| 1. Tendenzunternehmen | 675 | ||
| 2. Erzieherische Berufe | 676 | ||
| VII. Resümee | 679 | ||
| Wilhelm Rees: Der Kirchenbegriff in katholischem und evangelischem Verständnis - Verbindendes und Trennendes aus kanonistischer Sicht | 681 | ||
| I. Das Selbstverständnis der Kirche in der Geschichte | 682 | ||
| II. Aussagen über das Wesen der Kirche | 685 | ||
| 1. Kirche in katholischer Sicht | 685 | ||
| 2. Kirche im evangelischen Verständnis | 688 | ||
| III. Einzelne Bereiche | 692 | ||
| 1. Das Zueinander von katholischer Kirche und anderen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften | 692 | ||
| 2. Die Frage von Kirchenmitgliedschaft und -Zugehörigkeit und die damit verbundenen Rechte | 693 | ||
| 3. Gemeinsames Priestertum, Amt, Weihe und Apostolische Sukzession | 696 | ||
| 4. Hierarchische Verfassungs- und Organisationsstruktur | 700 | ||
| 5. Verkündigung und Lehramt | 705 | ||
| 6. Sakramente, insbesondere Eucharistie | 706 | ||
| IV. Ausblick | 709 | ||
| Ludwig Renck: Wissenschaftsfreiheit und theologische Fakultäten | 711 | ||
| I. Lokalisierung eines Konflikts | 711 | ||
| II. Bekenntnisrecht und Grundrechte | 712 | ||
| 1. Verfassungsrechtliche Priorität | 712 | ||
| 2. Rechtspolitische Aktualität und rechtsdogmatische Regelwidrigkeit | 713 | ||
| 3. Vorklärung | 714 | ||
| a) Begriffsbildung | 714 | ||
| b) Lösungsspektrum | 715 | ||
| III. Keine Grundrechtskollision | 715 | ||
| 1. Kritik vom Ergebnis her | 716 | ||
| 2. Institutionelles Bekenntnisrecht als Grundrechtsgrenze | 716 | ||
| a) Prinzipielle Schwäche der Position des Theologen | 717 | ||
| b) Das maßgebliche Rechtsverhältnis | 717 | ||
| IV. Institutionelles Ausnahmerecht | 718 | ||
| 1. Perspektivenwechsel | 718 | ||
| 2. Zulässigkeit theologischer Fakultäten | 718 | ||
| 3. Anstellungsrechtliche und kirchenrechtliche Beurteilung | 719 | ||
| a) Funktionsfähigkeit der theologischen Fakultäten | 720 | ||
| b) Keine konfessionellen Unterschiede | 720 | ||
| c) Konfessionsgebundenes Staatsamt | 721 | ||
| 4. Die Beanstandung aus individualgrundrechtlicher Sicht des Theologen | 722 | ||
| a) Ausübungsverzicht, Einwilligung des Theologen | 722 | ||
| b) Tendenzbetrieb | 723 | ||
| V. Vorrang des konstitutionellen Bekenntnisrechts | 723 | ||
| 1. Bindung an die Kirche | 724 | ||
| 2. Bindung an das Anstellungsrecht im Übrigen | 724 | ||
| VI. Ausblick | 724 | ||
| Reinhard Richardi: Die Dienstgemeinschaft als Grundprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts | 727 | ||
| I. Begriff der Dienstgemeinschaft | 727 | ||
| 1. Legaldefinition in der Grundordnung für das Arbeitsrecht der katholischen Kirche | 727 | ||
| 2. Abgrenzung von Missdeutungen der Dienstgemeinschaft | 727 | ||
| 3. Rechtliche Festlegung in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern | 728 | ||
| II. Bedeutung der Dienstgemeinschaft für die kirchenrechtliche Ordnung der Arbeitsverhältnisse | 729 | ||
| 1. Selbstverständnis der Kirchen | 729 | ||
| 2. Sonderstellung in einem marktwirtschaftlich organisierten Arbeitslehe | 731 | ||
| 3. Bedeutungsgehalt der Dienstgemeinschaft für die arbeitsrechtliche Ordnung des kirchlichen Dienstes | 732 | ||
| III. Anerkennung der Dienstgemeinschaft als Leitbild kirchlicher Ordnung durch den Staat | 734 | ||
| 1. Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts | 734 | ||
| 2. Zuordnung rechtlich verselbständigter Einrichtungen | 735 | ||
| 3. Kircheneigene Kompetenz zur Festlegung der Loyalitätsanforderungen | 737 | ||
| 4. Arbeitskampf und „Dritter Weg " | 738 | ||
| IV. Ergebnis der Untersuchung | 742 | ||
| Gerhard Robbers: Das europäische Volk, die Kirchen und die Demokratie: Eine Skizze | 743 | ||
| Ralf Röger: Die Aberkennung des Körperschaftsstatus von Religionsgemeinschaften im Lichte der Schutzpflichtlehre | 749 | ||
| I. Der Körperschaftsstatus im Spannungsfeld zwischen grundrechtlicher Freiheit und organisationsrechtlicher Bindung | 749 | ||
| II. Konsequenzen für die Verleihung des Körperschaftsstatus | 753 | ||
| 1. Das geschriebene Tatbestandsmerkmal der „Gewähr der Dauer" | 753 | ||
| 2. Das ungeschriebene, aber selbstverständliche Merkmal der Rechtstreue | 754 | ||
| 3. Die ungeschriebene Notwendigkeit eines „Mehr " an Solidarität | 755 | ||
| a) Verstärkte staatsorganisationsrechtliche Anforderungen als Korrektiv des grundrechtlichen Verleihungsanspruchs | 755 | ||
| b) Versuche einer näheren Definition dieses „solidarischen Plus" | 757 | ||
| III. Konsequenzen für die Aberkennung des Körperschaftsstatus | 759 | ||
| 1. Die Aufhebung des Körperschaftsstatus bei staatlichen Körperschaften | 760 | ||
| 2. Die Aberkennung des Körperschaftsstatus bei korporierten Religionsgemeinschaften | 763 | ||
| a) Die Lehre von der staatlichen Schutzpflicht | 763 | ||
| b) Die Aberkennung des Körperschaftsstatus als Schutzpflicht-Realisierung | 766 | ||
| aa) Qualität des gefährdeten Rechtsguts | 766 | ||
| bb) Intensität der Gefahr | 768 | ||
| cc) Art und Qualität der zur Gefahrenabwehr gegebenen Möglichkeiten | 769 | ||
| dd) Die Bedeutung der Rechtsposition der „sanktionierten" Religionsgemeinschaft | 771 | ||
| (1) Ausnutzung der Wirkkraft des Körperschaftsstatus | 772 | ||
| (2) Schwerwiegende und wiederholte Verletzung grundrechtlicher Positionen | 773 | ||
| ee) Keine Erfüllung der Schutzpflicht | 774 | ||
| ff) Aufhebung nur aufgrund eines eigenen Gesetzes oder durch eigenes Gesetz | 775 | ||
| IV. Fazit | 777 | ||
| Wolfgang Rombach: Versicherungspflicht und Versicherungsfreiheit für Mitglieder geistlicher Gemeinschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung | 779 | ||
| I. Grundzüge der Versicherungspflicht für Mitglieder von Gemeinschaften | 779 | ||
| 1. Kreis der Versicherten | 779 | ||
| a) Die geistliche Genossenschaft | 779 | ||
| b) Diakonissen | 780 | ||
| c) Ähnliche Gemeinschaften | 781 | ||
| d) Mitgliedschaft während der Ausbildung | 781 | ||
| 2. Konkurrenzverhältnis verschiedener Versicherungspflichttatbestände | 782 | ||
| a) Abgrenzung der Mitgliedschaft zum Beschäftigungsverhältnis | 782 | ||
| b) Sonderfall Gestellungsvertrag | 785 | ||
| c) Konkurrenzsituation zwischen Beschäftigung und Mitgliedschaft | 786 | ||
| 3. Beitragspflicht und -tragung | 786 | ||
| 4. Nachversicherung bei Ausscheiden aus der geistlichen Gemeinschaft | 787 | ||
| a) Grundtatbestand - Ausscheiden | 787 | ||
| b) Zeitraum der Nachversicherung | 787 | ||
| c) Beitragszahlung | 788 | ||
| d) Fälligkeit der Beiträge und Aufschub | 789 | ||
| e) Bewertung der nachentrichteten Beiträge bei der Rentenberechnung | 789 | ||
| II. Grundzüge der Versicherungsfreiheit für Mitglieder von Gemeinschaften | 790 | ||
| 1. Hintergrund der Versicherungsfreiheit | 790 | ||
| 2. Gewährleistungsbescheid | 791 | ||
| III. Historische Entwicklung | 792 | ||
| IV. Exkurs: Anspruch auf staatlich geförderte Alters Vorsorge („Riester-Rente") | 793 | ||
| V. Zulässigkeit der Versicherungspflicht für Mitglieder von Gemeinschaften | 794 | ||
| 1. Versorgungsregelungen als Gegenstand verfassungsrechtlicher Prüfung aus Art. 4 GG und Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV | 794 | ||
| 2. Grenzen der eigenständigen Regelungsbefugnis der Versorgung durch die Gemeinschaft | 796 | ||
| 3. Notwendigkeit der konditionierten Versicherungsfreiheit für Mitglieder von Gemeinschaften | 797 | ||
| VI. Zusammenfassung | 798 | ||
| Hartmut Schiedermair: Pisa und die Folgen. Eine Anmerkung zum Bildungs- und Kulturauftrag der Schule | 799 | ||
| Karl Eugen Schlief: Zukunft kirchlicher Finanzen unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen | 809 | ||
| I. Vorbemerkungen | 809 | ||
| II. Vorbehalte gegen das kirchliche Finanzwesen, insbesondere gegen Staatsleistungen und die Kirchensteuer | 810 | ||
| 1. Parteipolitische Vorbehalte | 811 | ||
| 2. Kritische Medienberichte | 811 | ||
| 3. Einwände in der wissenschaftlichen Literatur | 811 | ||
| III. Ablösung der Staatsleistungen? | 813 | ||
| IV. Perspektiven der Kirchensteuer | 813 | ||
| 1. Die Rechtsgrundlagen der Kirchensteuer | 814 | ||
| 2. Die Annexität der Kirchensteuer | 815 | ||
| 3. Der Kirchensteuerzahler | 817 | ||
| V. Die Rolle des Staates als Gesetzgeber der Maßstabsteuer | 818 | ||
| VI. Ausblick | 819 | ||
| Christian Starck: Die Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche 2000 | 821 | ||
| I. Werkzeug oder Gefäß | 821 | ||
| II. Das Wunder der orthodoxen Sozialdoktrin | 824 | ||
| III. Kirche und Staat | 827 | ||
| IV. Religion und moderne Welt | 832 | ||
| V. Perspektiven | 834 | ||
| Dieter Strauch: 750 Jahre kleiner Schied (17. April 1252-17. April 2002) | 837 | ||
| I. Historische Einführung: 750 Jahre Kleiner Schied | 837 | ||
| II. Das historische Umfeld | 837 | ||
| III. Die beteiligten Personen | 838 | ||
| 1. Erzbischof Konrad von Hochstaden (1238-1261) | 838 | ||
| 2. Die Vertreter der Stadt Köln | 841 | ||
| 3. Albertus Magnus (1193(?) - 1280) | 843 | ||
| 4. Kardinal Hugo von St. Cher (Ende 12. Jh. - 1263) | 844 | ||
| IV. Der Streitgegenstand | 845 | ||
| 1. Seine historische Entwicklung | 845 | ||
| 2. Das Schiedsgericht | 850 | ||
| 3. Rechtsgrundlagen des Schiedsgerichts | 852 | ||
| V. Der Inhalt des Schiedsspruches | 854 | ||
| 1. Münzfragen | 854 | ||
| 2. Zollfragen | 856 | ||
| 3. Wechselseitige Unterstützung | 860 | ||
| 4. Kein Schadensausgleich | 861 | ||
| 5. Rechtsgrundlagen des Schiedsspruchs | 862 | ||
| 6. Sicherung der Durchführung des Schiedes | 863 | ||
| VI. Die päpstliche Bestätigung | 864 | ||
| VII. Ergebnis | 865 | ||
| Quellen und Literatur | 867 | ||
| Peter J. Tettinger: Anmerkungen zu aktuellen Akzentuierungen staatlichen Rechtsschutzes in kirchlichen Angelegenheiten | 887 | ||
| I. Ausgangspunkt: Die gängige Rechtsprechung zur Reichweite staatlicher Kontrolle | 888 | ||
| II. Zur Berührung der kirchlichen mit der „staatlichen Ebene" | 890 | ||
| III. Speziell zum Rechtsschutz im Bereich des kirchlichen Amtsrechts | 892 | ||
| IV. Jüngere Judikatur zu kirchenrechtlichen „Vorfragen" | 894 | ||
| 1. | 894 | ||
| 2. | 895 | ||
| 3. | 899 | ||
| V. Ausblick | 899 | ||
| Gregor Thüsing: Das kirchliche Arbeitsrecht und die Grundrechte des Arbeitnehmers | 901 | ||
| I. Zwei Fälle zur Einführung | 901 | ||
| II. Der erste Ausgangspunkt: Die Grundrechte des Arbeitnehmers | 903 | ||
| III. Der zweite verfassungsrechtliche Ausgangspunkt: Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 3 WRV | 904 | ||
| 1. Eigenständigkeit im Rahmen der „für alle geltenden Gesetze" | 904 | ||
| 2. Mehr als nur Tendenzschutz | 905 | ||
| V. Die Kollision | 906 | ||
| 1. Die Rechtsprechung des BVerfG außerhalb des Arbeitsrechts | 906 | ||
| 2. Die bestätigte Rechtsprechung des BVerfG zum kirchlichen Arbeitsrecht | 907 | ||
| 3. Die abweichende Auffassung der jüngsten Kammerentscheidungen | 908 | ||
| 4. Gründe, die für die bisherige Rechtsprechung sprechen | 909 | ||
| 5. Versuch einer Präzisierung ausgehend vom ordre public | 910 | ||
| 6. Eine rechtsvergleichende Kontrollwertung: Ein Blick nach Osterreich | 911 | ||
| VI. Konsequenzen | 912 | ||
| 1. Streikrecht | 913 | ||
| 2. Kündigungsschutz | 914 | ||
| VII. Ausblick | 917 | ||
| Reiner Tillmanns: Kirchensteuer kein Mittel zur Entfaltung grundrechtlicher Religionsfreiheit | 919 | ||
| I. Paradigmenwechsel im Staatskirchenrecht | 919 | ||
| II. Zu den Konsequenzen einer grundrechtlichen Deutung des Staatskirchenrechts | 920 | ||
| III. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine grundrechtliche Deutung des Staatskirchenrechts | 925 | ||
| 1. Art 137 Abs. 6 WRV im Kontext der Weimarer Reichsverfassung | 925 | ||
| 2. Art. 137 Abs. 6 WRV im Kontext des Grundgesetzes | 930 | ||
| a) Die Figur des Bedeutungswandels | 932 | ||
| b) Bedeutungswandel durch Änderung des rechtstatsächlichen Hintergrundes | 934 | ||
| c) Bedeutungswandel durch Auswechselung des verfassungsrechtlichen Hintergrundes | 936 | ||
| Heinrich de Wall: Der Gleichheitssatz im Kirchensteuerrecht - zum Kammerbeschluss des BVerfG vom 19. 8. 2002 | 945 | ||
| I. Zur Bindung der Kirche an den Grundsatz der steuerlichen Belastungsgleichheit | 946 | ||
| 1. Das Besteuerungsrecht als Sonderfall einer „Beleihung" | 946 | ||
| 2. Kirchensteuern als besondere Form von Mitgliedsbeiträgen | 948 | ||
| 3. Grenzen hoheitlicher Befugnisse als „für alle geltende Gesetze" | 950 | ||
| II. Die Anwendung des Gleichheitssatzes | 953 | ||
| 1. Gleichheitssatz, Selbstbestimmung und Föderalismus | 953 | ||
| 2. Staatliche Kirchensteuerverwaltung und kirchliche Selbstbestimmung | 956 | ||
| 3. Besteuerungsgleichheit bei der Kirchensteuer nach Staatskirchen- und nach Kirchenrecht | 957 | ||
| Hermann Weber: Die „Anerkennung" von Religionsgemeinschaften durch Verleihung von Körperschaftsrechten in Deutschland | 959 | ||
| I. Einleitung | 959 | ||
| II. Das zweistufige System religiöser Vereinigungsfreiheit in Deutschland | 960 | ||
| 1. Der Erwerb der Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Rechts | 961 | ||
| 2. Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts | 963 | ||
| III. Das Zeugen Jehovas-Urteil des Bundesverfassungsgerichts | 966 | ||
| 1. Die Voraussetzungen für die Verleihung der Korporationsqualität | 966 | ||
| 2. Inhalt und Bedeutung der Korporationsqualität | 969 | ||
| IV. Resümee | 973 | ||
| Jörg Winter: Zum Amtsverständnis der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche | 975 | ||
| I. Zum Amtsverständnis der römisch-katholischen Kirche | 975 | ||
| II. Zum Amtsverständnis in der evangelischen Kirche | 978 | ||
| III. Das Amt im ökumenischen Gespräch | 980 | ||
| IV. Die Ordination im Recht der Evangelischen Landeskirche in Baden | 981 | ||
| V. Schluss | 985 | ||
| Diana Zacharias: Schutz vor religiösen Symbolen durch Art. 4 GG? Ein Beitrag zu den negativen religiösen Freiheitsrechten | 987 | ||
| I. Einführung | 987 | ||
| II. Zum Begriff der negativen religiösen Freiheitsrechte | 988 | ||
| III. Negative Glaubensfreiheit | 992 | ||
| IV. Negative Bekenntnisfreiheit | 1000 | ||
| V. Negative Religionsausübungsfreiheit | 1004 | ||
| VI. Fazit | 1007 | ||
| Hans F. Zacher: Eine „Predigt aus dem Alltag" | 1009 | ||
| Ein Vorwort | 1009 | ||
| Die Predigt | 1010 | ||
| I. Der verborgene Gott - der vielfältige Gott | 1010 | ||
| II. Der Gott unseres Lebens | 1012 | ||
| III. Der dreifaltige Gott | 1017 | ||
| Wissenschaftliche Bibliografie Wolfgang Rüfner bis Februar 2003 | 1019 | ||
| Verzeichnis der Autoren | 1033 |
