Die unternehmensinterne Befragung von Mitarbeitern im Zuge repressiver Compliance-Untersuchungen aus strafrechtlicher Sicht
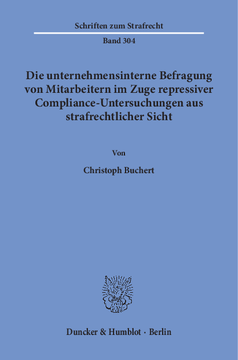
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die unternehmensinterne Befragung von Mitarbeitern im Zuge repressiver Compliance-Untersuchungen aus strafrechtlicher Sicht
Schriften zum Strafrecht, Vol. 304
(2017)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Prof. Dr. Christoph Buchert ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Eingriffsrecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Köln. Daneben ist er Strafverteidiger mit Schwerpunkt im Wirtschaftsstrafrecht. Vor seiner Tätigkeit als Hochschullehrer war er Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart (Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafsachen) und Richter am Landgericht Stuttgart (Wirtschaftsstrafkammer / Pressesprecher des Landgerichts). Er studierte Rechtswissenschaften in Mainz und Speyer und war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Herrn Prof. Dr. Volker Erb.Abstract
Die unternehmensinterne Befragung von Mitarbeitern ist Herzstück repressiver Compliance-Untersuchungen. Die privat ermittelten Erkenntnisse werden nicht selten Grundlage staatlicher Strafverfahren. Einheitliche Standards konnten bislang aber weder für den Prozess der Befragung von beschuldigten Mitarbeitern noch für den Transfer der privat ermittelten Erkenntnisse in das staatliche Strafverfahren entwickelt werden. Vor allem die Rolle der Staatsanwaltschaft und der gerichtliche Umgang mit intern erlangten Unterlagen sind wenig beleuchtet. Das Strafverfahrensrecht enthält klare Handlungsvorgaben für die staatlichen Akteure. Das Handeln der privaten Ermittler wird demgegenüber durch die privatrechtlichen Vorschriften des Arbeitsrechts bestimmt, grundrechtliche und speziell datenschutzrechtliche Konkretisierungen eingeschlossen. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen unternehmensinterner Befragungen und zeigt praxisgerechte Lösungen auf.Ausgezeichnet mit dem Förderpreis der Peregrinus-Stiftung 2018.»The Company-Internal Survey of Employees in the Course of Repressive Compliance Investigations from a Criminal Law Perspective«The company-internal survey of employees is the heart of repressive compliance investigations. Privately determined findings are often basis of state criminal proceedings. The paper analyzes the legal frameworks which are to be considered by private investigators and state actors when conducting such a survey and transferring private knowledge into the official criminal procedure.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 16 | ||
| Einleitung | 21 | ||
| I. Zum Phänomen unternehmensinterner Untersuchungen | 21 | ||
| II. Gang der Untersuchung | 22 | ||
| 1. Kapitel: Bestandsaufnahme: Die unternehmensinterne Befragung als repressives Herzstück eines effektiven Compliancesystems | 25 | ||
| A. Compliance – Begriff und Wirklichkeit | 25 | ||
| I. Primärziel: Haftungsvermeidung | 26 | ||
| 1. Das moderne Wirtschaftsstrafrecht | 27 | ||
| a) Schutz des Kollektivs | 27 | ||
| b) Allgemeine Verschärfung des strafrechtlichen Risikos im Wirtschaftsleben | 28 | ||
| 2. Konkrete Strafbarkeitsrisiken | 30 | ||
| a) Geschäftsherrenhaftung | 30 | ||
| aa) Bestehen von Garantenpflichten | 31 | ||
| bb) Die revolutionäre (?) Nebenbemerkung des BGH | 34 | ||
| b) Aufsichtspflichtverletzung und Unternehmensgeldbuße | 35 | ||
| aa) Die Vorschrift des § 130 OWiG | 36 | ||
| bb) Die Regelung des § 30 OWiG | 37 | ||
| cc) Rechtsfolgen | 38 | ||
| dd) Einführung eines Unternehmensstrafrechts | 39 | ||
| c) Der Tatbestand der Untreue | 41 | ||
| aa) Führungspersonen als potentielle Untreuetäter | 41 | ||
| bb) Pflichtverletzung | 41 | ||
| cc) Instrumentalisierung der Untreue für die Strafverfolgung | 43 | ||
| d) Pflicht zur Einführung von Compliance-Systemen? | 43 | ||
| aa) Herleitung über § 91 Abs. 2 AktG? | 44 | ||
| bb) Compliance-Pflicht durch Gesamtanalogie | 45 | ||
| cc) Faktische Pflicht und zunehmende Verstrafrechtlichung | 45 | ||
| e) Vermögensabschöpfung und Verfall | 46 | ||
| f) Extension durch Internationalisierung des Wirtschaftsstrafrechts | 48 | ||
| aa) Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 48 | ||
| bb) Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (UK) | 50 | ||
| cc) Internationale Harmonisierung durch nationales Strafrecht | 51 | ||
| dd) Einfluss auf nationales Recht: Maßstab für eine deutsche „best practice“ | 52 | ||
| 3. Außerstrafrechtliche Risiken | 53 | ||
| a) Ausschluss von öffentlichen Aufträgen („Blacklisting“) | 53 | ||
| b) Behinderung der Geschäftstätigkeit durch behördliche Ermittlungen | 53 | ||
| c) Imageschaden/Reputationsverlust | 54 | ||
| d) Zivilrechtliche Haftung | 54 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 55 | ||
| II. Das repressive Element | 55 | ||
| 1. Betriebswirtschaftliche Aspekte | 56 | ||
| 2. Wahrung der Unternehmenskultur | 56 | ||
| a) Betriebliche Verhaltenskodizes | 57 | ||
| b) Konsequente Ahndung von Compliance-Verstößen | 57 | ||
| 3. Rechtlicher Zwang | 58 | ||
| 4. Eigene Ermittlungen als Basis eines effektiven Krisenmanagements | 60 | ||
| 5. Kooperation mit den staatlichen Strafverfolgungsbehörden | 62 | ||
| III. Folge: Erweiterung des traditionellen Compliance-Begriffs | 65 | ||
| B. Die unternehmensinterne Untersuchung | 67 | ||
| I. Begriff der unternehmensinternen Untersuchung | 67 | ||
| 1. Abgrenzung zum Begriff der „Internal Investigations“ nach US-Recht | 68 | ||
| 2. Begriffsweite der unternehmensinternen Untersuchungen | 70 | ||
| II. Ablauf einer unternehmensinternen Untersuchung | 71 | ||
| 1. Informationsgewinn als Ausgangspunkt: Die Bedeutung von Insiderwissen | 71 | ||
| 2. Auswertung und ggf. Einleitung einer unternehmensinternen Untersuchung | 73 | ||
| 3. Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung | 74 | ||
| III. Die Befragung als Herzstück unternehmensinterner Maßnahmen | 75 | ||
| 1. Bedeutung der Befragung im Kontext repressiver Compliance-Maßnahmen | 75 | ||
| 2. Struktur der Befragungen: Kategorisierung nach der Stoßrichtung der Befragung | 76 | ||
| 3. Inhaltliche Ausgestaltung der Mitarbeiterbefragung | 77 | ||
| C. Die Rolle der Staatsanwaltschaft | 80 | ||
| I. Interne Aufklärung als Element des staatlichen Ermittlungsverfahrens | 81 | ||
| II. Vorteile interner Aufklärungsmaßnahmen aus Sicht der Staatsanwaltschaft | 82 | ||
| III. Kooperation als „win-win-Situation“ | 83 | ||
| IV. Gezielter Drang zur Kooperation | 84 | ||
| D. Zusammenfassung | 85 | ||
| 2. Kapitel: Unternehmensinterne Befragungen als Handeln durch Private? | 87 | ||
| A. Vorüberlegungen zur Abgrenzung von privatem und staatlichem Handeln | 88 | ||
| I. Die Vernehmung des Mitarbeiters als Ausgangspunkt | 88 | ||
| 1. Der Begriff der Vernehmung in der StPO | 89 | ||
| 2. Stellungnahme | 90 | ||
| II. Abgrenzungskriterien in Rechtsprechung und Literatur | 92 | ||
| 1. Aushorchen eines Mitgefangenen (BGHSt 34, 362 – sog. „Zellenkumpanenfall“) | 93 | ||
| a) Sachverhalt | 93 | ||
| b) Entscheidung der Rechtsprechung und Bewertung in der Literatur | 94 | ||
| c) Bewertung | 95 | ||
| 2. Polizeilich veranlasstes Telefongespräch (BGHSt 42, 139 – sog. „Hörfalle“) | 96 | ||
| a) Sachverhalt | 96 | ||
| b) Entscheidung der Rechtsprechung und Bewertung in der Literatur | 97 | ||
| c) Bewertung | 99 | ||
| 3. Aushorchen einer Mitgefangenen (BGHSt 44, 129 – sog. „Wahrsagerinnenfall“) | 103 | ||
| a) Sachverhalt | 103 | ||
| b) Entscheidung der Rechtsprechung und Bewertung in der Literatur | 103 | ||
| c) Bewertung | 105 | ||
| 4. Gesamtbewertung: Generelle Anforderungen für ein zurechenbares Verhalten | 106 | ||
| III. Herrschaftsmomente bei der Durchführung unternehmensinterner Befragungen | 107 | ||
| 1. Darlegung der Herrschaftsmomente im aktiven Befragungsprozess | 108 | ||
| 2. Herrschaftsmomente durch Unterlassen | 109 | ||
| B. Kategorisierung bei unternehmensinternen Befragungen | 111 | ||
| I. Privates Handeln als Regelfall | 111 | ||
| II. Bewertung der staatlichen Mitwirkung | 111 | ||
| 1. Erfordernis einer Mitwirkung in der Planungs- und Ausführungsphase | 112 | ||
| 2. Auswirkungen eines staatlichen Kooperationszwangs | 114 | ||
| 3. Kooperation von Unternehmen und Staatsanwaltschaft | 116 | ||
| III. Ergebnis | 118 | ||
| 3. Kapitel: Zulässigkeit unternehmensinterner Befragungen | 119 | ||
| A. Die Interessenlagen der Beteiligten | 119 | ||
| I. Situation des Unternehmens | 120 | ||
| II. Situation des Mitarbeiters | 121 | ||
| III. Zwischenergebnis | 121 | ||
| B. Verfassungsrechtliche Grundlagen | 122 | ||
| I. Das staatliche Gewaltmonopol als verfassungsrechtliche Schranke | 122 | ||
| II. Die Grundrechte als Schranken-Schranken des Gewaltmonopols | 124 | ||
| C. Zulässigkeit privater Ermittlungen im Strafprozess | 124 | ||
| I. Das Ermittlungsrecht des Privaten als grundrechtlich geschütztes Verhalten | 125 | ||
| 1. Zulässigkeit von Ermittlungshandlungen durch den Beschuldigten | 125 | ||
| 2. Zulässigkeit von Ermittlungshandlungen durch den Verletzten | 127 | ||
| II. Zur Übertragbarkeit privater Ermittlungsrechte auf Unternehmen | 129 | ||
| 1. Berücksichtigung der prozessualen Doppelrolle des Unternehmens | 130 | ||
| 2. Keine unmittelbare Übertragbarkeit von Beschuldigtenrechten | 131 | ||
| D. Zulässigkeit von Ermittlungshandlungen durch Unternehmen | 132 | ||
| I. Grundrechtsschutz des ermittelnden Unternehmens | 132 | ||
| II. Umfang der Ermittlungsbefugnis | 133 | ||
| 1. Implementierung von Compliance-Systemen | 133 | ||
| 2. Der zivilprozessuale Beibringungsgrundsatz | 134 | ||
| 3. Arbeitsrechtliche Regelungen | 134 | ||
| 4. Systematische Einbindung Privater in die staatliche Strafverfolgung | 134 | ||
| 5. Der Erlaubnistatbestand des § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG | 135 | ||
| III. Ermittlungen durch beauftragte Rechtsanwälte | 136 | ||
| E. Ergebnis | 137 | ||
| 4. Kapitel: Grenzen unternehmensinterner Befragungen | 138 | ||
| A. Strafprozessrechtliche Rahmenbedingungen | 138 | ||
| I. Die Bedeutung der Offizialmaxime | 139 | ||
| 1. Kein Ausschluss privater Mitwirkung | 139 | ||
| 2. Verbot eines „Outsourcings“ von Ermittlungshandlungen | 140 | ||
| 3. Verbot der Beeinträchtigung staatlicher Ermittlungshandlungen | 141 | ||
| II. Die Bedeutung des Legalitätsprinzips | 142 | ||
| 1. Das Legalitätsprinzip im Strafverfahren | 142 | ||
| 2. Die Einbeziehung privater Erkenntnisse vor dem Hintergrund des Legalitätsprinzips | 144 | ||
| a) Berücksichtigung von Ressourcenbegrenztheit und praktischen Aufklärungshürden | 144 | ||
| b) Pflicht zur Einbeziehung privat erlangter Erkenntnisse | 146 | ||
| c) Die Pflicht zur eigenständigen Tatsachenermittlung als Grundlage einer besonderen Nachermittlungspflicht | 146 | ||
| d) § 170 Abs. 1 StPO als mittelbare Inhaltsbestimmung der Legalitätspflicht | 148 | ||
| e) Der Verlust der Entscheidungshoheit als absolute Grenze | 149 | ||
| III. Die Bedeutung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit | 151 | ||
| IV. Die Bedeutung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung | 155 | ||
| 1. Gesetzliches Regulativ zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens | 155 | ||
| 2. Pflicht zur sorgfältigen Beweiswürdigung | 156 | ||
| V. Die Bedeutung des Fairnessgebots | 158 | ||
| 1. Unternehmensinterne Untersuchungen als von der StPO nicht vorgesehene Sonderkonstellation | 159 | ||
| 2. Auswirkungen des Fairnessgebots im Falle einer Einbeziehung privat ermittelter Erkenntnisse | 160 | ||
| a) Pflicht zur Ausübung der Leitungsbefugnis im Ermittlungsverfahren | 160 | ||
| b) Begrenzte Kooperationsmöglichkeiten | 161 | ||
| c) Transparenz- und Dokumentationsgebot | 162 | ||
| d) Gewährleistung einer Waffengleichheit | 163 | ||
| e) Konsequenzen von Verstößen | 164 | ||
| VI. Grenzen der Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaften | 165 | ||
| 1. Grenzen bei der Vernehmung von Mitarbeitern, Organen und Beratern | 166 | ||
| a) Vernehmung von Mitarbeitern | 166 | ||
| b) Vernehmung von Organmitgliedern | 167 | ||
| c) Vernehmung von ermittelnden Rechtsanwälten | 169 | ||
| 2. Zugriff auf die schriftlich dokumentierten Ergebnisse einer unternehmensinternen Untersuchung | 170 | ||
| a) Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen aus Unternehmensverteidigungen | 172 | ||
| aa) Nebenbeteiligung des Unternehmens | 173 | ||
| bb) Übertragbarkeit des Beschlagnahmeprivilegs | 174 | ||
| cc) Zeitliche Geltung des Beschlagnahmeverbots von Verteidigungsunterlagen | 176 | ||
| b) Beschlagnahmefreiheit von Unterlagen außerhalb einer Vertrauensbeziehung zum Beschuldigten | 178 | ||
| aa) Zur Bedeutung und Reichweite des § 160a StPO | 179 | ||
| bb) Reichweite eines Beschlagnahmeschutzes nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO | 181 | ||
| cc) Sonderfall: Beschlagnahmefreiheit bei überlassenen Gegenständen | 183 | ||
| c) Zwischenergebnis | 186 | ||
| VII. Beweiserhebungsvorschriften der StPO auch als Grenze privaten Handelns? | 187 | ||
| B. Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen | 189 | ||
| I. Teilnahmepflicht des Arbeitnehmers | 191 | ||
| II. Auskunftspflichten des Arbeitnehmers | 191 | ||
| 1. Auskunftserteilung als Bestandteil der Arbeitspflicht | 192 | ||
| 2. Auskunftspflichten als Nebenleistungspflichten der vertraglichen Arbeitsaufgabe | 193 | ||
| 3. Auskunft als arbeitsvertragliche Nebenpflicht | 194 | ||
| 4. Auskunftspflicht gegenüber externen Dritten | 196 | ||
| 5. Durchsetzbarkeit der Auskunftspflicht | 198 | ||
| III. Der Schutz der Selbstbelastungsfreiheit als Grenze einer arbeitsrechtlichen Mitwirkungspflicht | 200 | ||
| 1. Der Grundsatz nemo tenetur se ipsum accusare | 200 | ||
| 2. Schutz der Selbstbelastungsfreiheit im Falle außerstrafprozessualer Aussagepflichten | 203 | ||
| a) Alternative Schutzmöglichkeiten und deren Leistungsfähigkeit | 204 | ||
| b) Verwaltungsrechtliche Ausgestaltung des Schutzes | 205 | ||
| c) Privatrechtliche Ausgestaltung des Schutzes | 207 | ||
| aa) Ausstrahlungswirkung der Grundrechte im Privatrecht | 207 | ||
| bb) Der Gemeinschuldnerbeschluss des BVerfG | 209 | ||
| 3. Übertragbarkeit der Wertungen des Gemeinschuldnerbeschlusses auf arbeitsrechtliche Auskunftspflichten | 211 | ||
| a) Die fehlende Entscheidungsfreiheit als Kriterium | 212 | ||
| b) Berücksichtigung der privatrechtlichen Ausgangslage | 213 | ||
| c) Vergleichbare Interessenlage | 215 | ||
| 4. Anwendung der Grundsätze des Gemeinschuldnerbeschlusses | 217 | ||
| a) Bedeutungsrelevanz der alternativen Schutzmodelle | 218 | ||
| b) Die gefahrenabwehrbezogene Betrachtung als Bewertungsmaßstab des Schutzniveaus der Selbstbelastungsfreiheit | 219 | ||
| c) Kritische Würdigung der Gefahrenlage des Unternehmens im Sinne der h.M. | 222 | ||
| d) Interessenabwägung | 224 | ||
| aa) Der Rechtsgedanke der §§ 666, 675 BGB als Wertungsprämisse | 224 | ||
| bb) Berücksichtigung der gesetzlichen Wertungen im Arbeitsrecht | 226 | ||
| cc) Beachtung der repressiven Stoßrichtung der Ermittlungen | 230 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 233 | ||
| e) Weitergehende Differenzierung nach dem Zweck der Befragung | 233 | ||
| aa) Differenzierung zwischen repressiven und präventiven Zwecken im Wirtschaftsverwaltungsrecht | 233 | ||
| bb) Übertragbarkeit dieser Differenzierung auf die Konstellation unternehmensinterner Befragungen | 234 | ||
| cc) Relativierung durch untrennbare Verbindung von Prävention und Repression? | 238 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 242 | ||
| IV. Flankierende Rechte | 243 | ||
| 1. Aufklärungs- und Belehrungspflichten des Arbeitgebers | 243 | ||
| 2. Hinzuziehung eines Rechtsanwalts | 246 | ||
| a) Anspruch auf Rechtsbeistand | 246 | ||
| b) Anwesenheits- und Beistandsrecht eines Betriebsratsmitglieds | 250 | ||
| 3. Anspruch auf Einsichtnahme und Berichtigung von Untersuchungsprotokollen | 250 | ||
| a) Anspruch auf Einsichtnahme in Befragungsprotokolle | 251 | ||
| b) Anspruch auf Berichtigung von Befragungsprotokollen/Unterzeichnungspflicht | 255 | ||
| 4. Beteiligungsrechte des Betriebsrates | 256 | ||
| 5. Folgen von Verstößen gegen die privatrechtlichen Pflichtenstellungen | 256 | ||
| C. Reichweite eines Beweisverwertungsverbotes und Sonderkonstellationen | 258 | ||
| I. Freie Verwertbarkeit (vermeintlich) freiwillig erteilter Auskünfte | 258 | ||
| II. Verwertbarkeit bei Auskunftserteilung infolge einer Täuschung oder unzulässigen Drohung | 260 | ||
| III. Fernwirkung des Beweisverwertungsverbotes | 264 | ||
| D. Ergebnis | 266 | ||
| Schlussbetrachtung | 268 | ||
| Literaturverzeichnis | 271 | ||
| Sachwortverzeichnis | 299 |
