»Rote Karte« gegen »Spinner«?
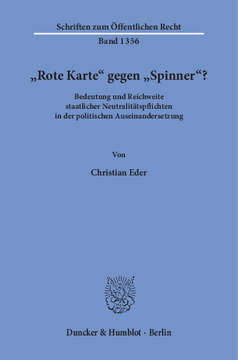
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
»Rote Karte« gegen »Spinner«?
Bedeutung und Reichweite staatlicher Neutralitätspflichten in der politischen Auseinandersetzung
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 1356
(2017)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Christian Eder studierte als Stipendiat der Hanns-Seidel-Stiftung Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und absolvierte währenddessen u.a. ein Praktikum beim Europäischen Parlament in Brüssel. Anschließend arbeitete er an seiner Dissertation, die von Prof. Dr. Jens Kersten betreut wurde, und war im Examinatorium der Juristischen Fakultät der LMU sowie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Er ist Wirtschaftsmediator und absolviert derzeit sein Referendariat am Oberlandesgericht München, in dessen Rahmen er auch im Dezernat von Prof. Dr. Peter M. Huber am Bundesverfassungsgericht tätig sein wird.Abstract
Die Arbeit beleuchtet die Neutralitätspflichten, die den Bundespräsidenten und die Mitglieder der Bundesregierung in der Auseinandersetzung mit politischen Parteien treffen. Ausgehend von den aktuellen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Äußerungsbefugnisse von Staatsorganen im politischen Diskurs entwickelt der Autor drei Anknüpfungspunkte für eine Neutralitätspflicht: Erstens die parteipolitische Neutralität als allgemeines Rechts- und Verfassungsprinzip, zweitens die Freiheit der Wahl und drittens die verfassungsmäßigen Rechte politischer Parteien. Auf dieser Grundlage kommt er zu dem Ergebnis, dass das Grundgesetz - entgegen der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts - die untersuchten Staatsorgane gleichermaßen an die Neutralitätspflicht gebunden sieht. Schließlich zeigt der Autor die unter den dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen verbleibenden Handlungsmöglichkeiten der Staatsorgane auf und schlägt so die Brücke zur Verfassungspraxis.»›Red Card‹ against ›Weirdos‹?«The thesis examines the duties of political neutrality the German Constitution imposes on the Federal President and the Government. Based on recent rulings by the Federal Constitutional Court, the dissertation identifies several constitutional foundations for the state's duty of neutrality and concludes that both, the President and the Government, are obliged to exercise restraint against political parties. Finally, the thesis points out the in so far remaining scopes of actions for the state authorities.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 15 | ||
| A. Einleitung | 17 | ||
| B. Staatliche Neutralitätspflichten als aktuelle verfassungsrechtliche Problematik | 20 | ||
| I. „Spinner“-Entscheidung | 20 | ||
| II. Exkurs: Weitere Äußerungen Joachim Gaucks | 22 | ||
| III. „Schwesig“-Entscheidung | 23 | ||
| IV. „Wanka“-Entscheidung | 24 | ||
| V. Landesverfassungsgerichtliche Entscheidungen | 25 | ||
| 1. „Dreyer“-Entscheidung | 25 | ||
| 2. „Commerçon“-Entscheidung | 26 | ||
| 3. „Taubert“-Entscheidung | 27 | ||
| 4. „Ramelow“-Entscheidung | 28 | ||
| 5. „Lauinger“-Entscheidung | 30 | ||
| C. Das Prinzip staatlicher Neutralität im Kontext parteipolitischer Auseinandersetzungen | 32 | ||
| I. Parteipolitische Neutralität als Rechts- und Verfassungsprinzip | 32 | ||
| 1. Der Begriff der Neutralität | 32 | ||
| 2. Ausprägungen des Neutralitätsgebots im geltenden Recht | 33 | ||
| 3. Parteipolitische Neutralität im verfassungsrechtlichen Kontext | 34 | ||
| a) Grundwerte des Staates | 35 | ||
| b) Konkrete politische Gestaltung | 37 | ||
| 4. Neutralität als Rechtspflicht | 38 | ||
| II. Die Freiheit der Wahl | 39 | ||
| 1. Wahlen als Legitimationsbasis | 39 | ||
| 2. Inhalt des Prinzips freier Wahlen | 40 | ||
| III. Verfassungsmäßige Rechte politischer Parteien | 42 | ||
| 1. Funktionale Stellung der Parteien im Grundgesetz | 43 | ||
| a) Historischer Hintergrund | 43 | ||
| b) Die Rolle politischer Parteien in der Bundesrepublik | 44 | ||
| (1) Parteien als zentraler Bestandteil der Verfassungsordnung | 44 | ||
| (2) Parteien als Mittler zwischen Volk und Staat | 45 | ||
| (a) Unterscheidbarkeit staatlicher und gesellschaftlicher Willensbildung | 45 | ||
| (b) Parteien als staatsnaher Teil der Gesellschaft | 46 | ||
| (c) Parteien als Bindeglieder | 47 | ||
| (3) Parteien als Förderer der aktiven Teilnahme am Willensbildungsprozess | 47 | ||
| (4) Parteien als Integrationsfaktoren | 48 | ||
| (5) Anforderungen an die innere Struktur | 48 | ||
| 2. Sedes materiae der Parteirechte | 48 | ||
| a) Rechtsnatur des Art. 21 GG | 49 | ||
| (1) Art. 21 GG als Grundrecht | 49 | ||
| (2) Art. 21 GG als Bestandsgarantie mit subjektiver Komponente | 50 | ||
| b) Grundrechte politischer Parteien | 51 | ||
| 3. Gewährleistungen des Art. 21 GG | 51 | ||
| a) Gründungsfreiheit | 52 | ||
| b) Betätigungsfreiheit | 52 | ||
| (1) Programmfreiheit | 53 | ||
| (2) Wettbewerbsfreiheit | 54 | ||
| c) Gleichheit | 54 | ||
| (1) Verfassungsrechtliche Verortung | 55 | ||
| (2) Inhaltliche Ausgestaltung | 56 | ||
| d) Ausstrahlung auf die Grundrechte der Parteien | 57 | ||
| (1) Generelle Bedeutung für den Grundrechtsschutz | 58 | ||
| (2) Keine Differenzierung zu Wahlkampfzeiten | 59 | ||
| (3) Potential der Beeinflussung des Volkes als Gradmesser für die Intensität der Ausstrahlungswirkung | 61 | ||
| IV. Die Begründung der parteipolitischen Neutralität von Staatsorganen | 62 | ||
| D. Adressaten der Neutralitätspflicht | 63 | ||
| I. Der Bundespräsident als Adressat der Neutralitätspflicht | 64 | ||
| 1. Aufgaben und Funktionen des Bundespräsidenten | 64 | ||
| a) Stellung des Bundespräsidenten im Verfassungsgefüge | 64 | ||
| b) Die Wahl des Bundespräsidenten | 67 | ||
| (1) Die Bundesversammlung als den Parteieinfluss verringerndes Organ | 68 | ||
| (a) Faktischer Einfluss der Parteien | 68 | ||
| (b) Reduktion des Parteieinflusses | 69 | ||
| (2) Exkurs: Der Vorschlag einer Direktwahl des Bundespräsidenten | 69 | ||
| c) Verfassungsmäßige Aufgaben des Bundespräsidenten | 70 | ||
| (1) Historischer Hintergrund | 71 | ||
| (2) Geschriebene Kompetenzen | 72 | ||
| (a) Aufgaben mit Entscheidungsbefugnissen | 72 | ||
| (aa) Befugnisse in der dritten Phase der Wahl des Bundeskanzlers | 73 | ||
| (bb) Befugnisse bei gescheiterter Vertrauensfrage | 74 | ||
| (cc) Geschäftsführende Bundesregierung | 75 | ||
| (dd) Gänzlich ungebundene Entscheidungskompetenzen | 76 | ||
| (b) Reserveaufgaben | 76 | ||
| (c) Kontrollaufgaben und Legalitätsreserve | 77 | ||
| (aa) Vorschlag zur Wahl des Bundeskanzlers | 78 | ||
| (bb) Ernennung der Bundesminister | 79 | ||
| (cc) Genehmigung der Geschäftsordnung der Bundesregierung | 79 | ||
| (dd) Abschluss völkerrechtlicher Verträge | 80 | ||
| (ee) Ausfertigung und Verkündung von Bundesgesetzen | 80 | ||
| (ff) Ernennungen nach Art. 60 Abs. 1 GG | 82 | ||
| (d) Beurkundungsaufgaben | 83 | ||
| (e) Gegenzeichnungspflicht | 83 | ||
| (3) Ungeschriebene Aufgaben | 85 | ||
| (a) Repräsentation | 85 | ||
| (b) Integration | 86 | ||
| (aa) Pluralismus als desintegrierender Faktor | 87 | ||
| (bb) Politische Dimensionen des Präsidentenamtes | 87 | ||
| (cc) Der Bundespräsident als unabhängiges Integrationsorgan | 88 | ||
| (c) Klassische Prärogativrechte | 90 | ||
| (4) Rolle des Bundespräsidenten nach dem Grundgesetz | 91 | ||
| d) Bedeutung der Verfassungstradition | 91 | ||
| e) Theorien zur Beschreibung der Funktionen des Bundespräsidenten | 92 | ||
| (1) Der Bundespräsident als „Staatsnotar“ | 93 | ||
| (2) Der Bundespräsident als „pouvoir neutre“ | 93 | ||
| (3) Der Bundespräsident als „Hüter der Verfassung“ | 96 | ||
| (4) Der Bundespräsident als „Kustos“ | 98 | ||
| 2. Maßstab der Neutralitätspflicht des Bundespräsidenten | 100 | ||
| a) Konsequenzen aus der funktionalen Stellung | 100 | ||
| (1) Verfassungsmäßige Aufgaben und Funktionen | 100 | ||
| (2) Wahlverfahren | 104 | ||
| (3) Voraussetzungen der Präsidentenanklage nach Art. 61 GG | 104 | ||
| (4) Moralisches Vertrauen in den Bundespräsidenten | 105 | ||
| b) Keine Absenkung des Maßstabs | 107 | ||
| (1) Fehlender Wettbewerb mit politischen Parteien | 107 | ||
| (2) Geringe Mittelausstattung | 108 | ||
| (3) Prägung des Amtes durch die Person | 108 | ||
| c) Inkohärenzen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 109 | ||
| (1) Inkohärenzen in der „Spinner“-Entscheidung | 110 | ||
| (2) Widersprüche zu anderen Entscheidungen | 111 | ||
| (a) Die Entscheidung zur Bundesversammlung | 112 | ||
| (b) Die „Schwesig“-Entscheidung | 113 | ||
| 3. Der Bundespräsident als parteipolitisch neutraler „Kustos“ | 115 | ||
| II. Die Bundesregierung als Adressatin der Neutralitätspflicht | 116 | ||
| 1. Funktionale Stellung der Bundesregierung | 117 | ||
| a) Verfassungsmäßige Aufgaben der Bundesregierung | 117 | ||
| (1) Geschriebene Kompetenzen | 117 | ||
| (a) Zuständigkeiten des Bundeskanzlers | 118 | ||
| (aa) Intraorgankompetenzen | 118 | ||
| (bb) Interorgankompetenzen | 120 | ||
| (b) Beispielhafte Zuständigkeiten einzelner Bundesminister | 121 | ||
| (c) Zuständigkeiten des gesamten Kabinetts | 121 | ||
| (aa) Rechtsetzung und Gesetzesvollzug | 121 | ||
| (bb) Auswärtige Gewalt | 122 | ||
| (cc) Krisenbewältigung | 123 | ||
| (dd) Beteiligung und Information | 124 | ||
| (2) Ungeschriebene Aufgabenzuweisungen | 124 | ||
| (a) Initiativaufgaben | 124 | ||
| (b) Planungsaufgaben | 125 | ||
| (c) Informationstätigkeit | 125 | ||
| b) Stellung der Bundesregierung im Verfassungsgefüge | 126 | ||
| (1) Politisches Leitorgan | 127 | ||
| (2) Verwaltungsorgan | 129 | ||
| c) Die Bundesregierung zwischen Parteipolitik und Staatshandeln | 130 | ||
| 2. Maßstab der Neutralitätspflicht der Bundesregierung | 130 | ||
| a) Konsequenzen aus der funktionalen Stellung | 130 | ||
| (1) Parteipolitische Verpflichtungen der Bundesregierung | 131 | ||
| (2) Pflichten der parteipolitischen Zurückhaltung | 132 | ||
| b) Die Bundesregierung als Ergebnis parteipolitischer Auseinandersetzungen | 132 | ||
| c) Wettbewerb mit den Parteien | 134 | ||
| d) Umfängliche Mittelausstattung | 134 | ||
| e) Geringe persönliche Amtsausfüllungsmöglichkeiten | 135 | ||
| f) Fachliches Vertrauen in die Bundesregierung | 135 | ||
| 3. Die Bundesregierung als parteipolitisch neutrales Staatsorgan | 136 | ||
| III. Strikte parteipolitische Neutralität als Pflicht für den Bundespräsidenten und die Bundesregierung | 138 | ||
| E. Wirkungsmöglichkeiten | 139 | ||
| I. Nicht rechtfertigbare Äußerungen | 139 | ||
| II. Einzelne Wirkungsmöglichkeiten | 140 | ||
| 1. Das Handeln als Privatperson | 140 | ||
| a) Existenz einer höchstpersönlichen und einer parteipolitischen Sphäre | 141 | ||
| (1) Kernbereich privater Lebensgestaltung | 141 | ||
| (2) Parteipolitische Sphäre | 143 | ||
| b) Sonderstellung des Bundespräsidenten | 143 | ||
| c) Bestimmung der aktiven Sphäre | 144 | ||
| (1) Fälle klarer Zuordnung mittels Typisierungen | 144 | ||
| (2) Zweifelsfälle | 145 | ||
| (a) Grundsatz des parteipolitischen Handelns | 145 | ||
| (b) Grundsatz des staatlichen Handelns | 146 | ||
| d) Bedeutung des Kontextes einer politischen Äußerung | 147 | ||
| e) Verbleibende Pflichten des „parteipolitischen Organs“ | 148 | ||
| 2. Zulässige Öffentlichkeitsarbeit | 150 | ||
| a) Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeit | 150 | ||
| b) Sonderstellung des Bundespräsidenten | 150 | ||
| c) Bedeutung und Gebotenheit staatlicher Öffentlichkeitsarbeit | 151 | ||
| d) Voraussetzungen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit | 152 | ||
| (1) Vorliegen einer staatlichen Aufgabe und Zuständigkeit | 152 | ||
| (a) Keine Notwendigkeit zur Einzelfallermächtigung | 152 | ||
| (b) Aufgabeneröffnung | 154 | ||
| (c) Einhaltung der Zuständigkeitsgrenzen | 155 | ||
| (aa) Verbandskompetenz | 156 | ||
| (bb) Organkompetenz | 156 | ||
| (2) Sachlichkeit | 157 | ||
| (3) Verhältnismäßigkeit | 158 | ||
| (4) Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf Wahlen | 160 | ||
| e) Abgrenzung von parteipolitischer Einflussnahme und zulässiger Öffentlichkeitsarbeit | 161 | ||
| 3. Vertretung des gesellschaftlichen Konsenses oder Teilnahme des Staatsorgans am politischen Diskurs | 162 | ||
| 4. „Wehrhafte Demokratie“ und Staatsschutz | 163 | ||
| a) Reichweite und Inhalt der „wehrhaften Demokratie“ | 163 | ||
| (1) Schutzauftrag des Grundgesetzes | 163 | ||
| (2) Inhaltliche Ausgestaltung | 165 | ||
| (a) Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung | 165 | ||
| (b) Bestandsschutz der Bundesrepublik Deutschland | 166 | ||
| b) „Wehrhafte Demokratie“ und parteipolitische Äußerungen | 167 | ||
| (1) Anwendungsbereich | 167 | ||
| (2) Bedeutung und Reichweite des „Parteienprivilegs“ | 168 | ||
| (a) Objektiver Maßstab | 168 | ||
| (b) Begriff des „Parteienprivilegs“ | 171 | ||
| (c) Erstreckung des „Parteienprivilegs“ auf parteipolitische Äußerungen | 172 | ||
| (aa) Keine bloße Willkürkontrolle | 174 | ||
| (bb) Rechtfertigungsbedürftigkeit mittelbar-faktischer Grundrechtsbeeinträchtigungen | 175 | ||
| (cc) Bedeutung politischer Parteien | 175 | ||
| (dd) Parteiverbot als Präventivmaßnahme | 177 | ||
| (ee) Gebotenheit eines weiten Verständnisses des „Parteienprivilegs“ | 177 | ||
| (d) Pflicht zur Stellung eines Verbotsantrags | 178 | ||
| 5. Antinationalsozialistisches Sonderrecht | 179 | ||
| a) Eigenes Auftreten der Partei | 179 | ||
| b) Öffentliche Ordnung | 180 | ||
| c) Das Grundgesetz als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Schreckensherrschaft | 181 | ||
| F. Zusammenfassung | 185 | ||
| I. Begründung der Neutralitätspflicht | 185 | ||
| II. Der Bundespräsident als Adressat der Neutralitätspflicht | 188 | ||
| III. Die Bundesregierung als Adressatin der Neutralitätspflicht | 190 | ||
| IV. Handlungsmöglichkeiten | 192 | ||
| V. Ausblick | 196 | ||
| Literaturverzeichnis | 197 | ||
| Sachwortverzeichnis | 214 |
