Kartellrechtliche Konzernhaftung
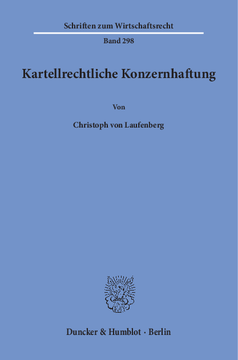
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Kartellrechtliche Konzernhaftung
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 298
(2018)
Additional Information
Book Details
Pricing
About The Author
Christoph von Laufenberg schloss sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Passau 2014 ab. Im Anschluss folgte bis 2016 eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht von Prof. Dr. Dörte Poelzig, M.jur. (Oxon). Den rechtsvergleichenden Teil seiner Dissertation erstellte Christoph von Laufenberg unter Betreuung von Prof. Dr. Enchelmaier an der Universität Oxford (Lincoln College) im Jahr 2015. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete er von 2016 bis 2017 in einer internationalen Großkanzlei im Bereich Kartellrecht. Seit Oktober 2016 ist er Rechtsreferendar am Landgericht Ingolstadt.Abstract
Der kartellrechtliche Unternehmensbegriff, der auf einer funktional wirtschaftlichen Betrachtung basiert, gerät vielerorts in Konflikt mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem konzernrechtlichen Trennungsprinzip. Spannungen und ungelöste Fragen entstehen insbesondere bei der Bußgeld- und Schadensersatzhaftung für Kartellverstöße. So ist Anlass der Arbeit die »Calciumcarbid II«-Entscheidung des BGH (BGHZ 203, 193), worin es um den Gesamtschuldnerinnenausgleich nach Zahlung einer Geldbuße durch die Muttergesellschaft wegen eines kartellrechtswidrigen Verhaltens der Tochtergesellschaft ging. Die Arbeit beleuchtet diese und weitere Fragen um die kartellrechtliche Konzernhaftung aus unterschiedlichen rechtlichen Perspektiven. Sie behandelt Themen des deutschen und europäischen Kartellrechts, des Gesellschaftsrechts sowie des IPR und enthält Bezüge zum englischen und amerikanischen Recht. Angesichts der erheblichen Bußgeld- und auch Schadensersatzsummen, die im Falle eines Kartellverstoßes drohen, ist Rechtssicherheit in diesen Fragen von erheblicher Bedeutung.»Corporate Group Liability for Competition Law Infringements«The work examines current issues of mainly competition law, European law and company law. It analyses the consequences of fines set by the European Commission and by the Bundeskartellamt on corporate groups. It focuses on the question of whether and how parent companies can receive reimbursement by its subsidiaries for paid fines or damages.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 3 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 23 | ||
| A. Ausgangspunkt | 23 | ||
| B. Fragestellung und Zielsetzung | 24 | ||
| C. Gang der Untersuchung | 25 | ||
| Teil 1: Konzerne im Kartellrecht | 28 | ||
| § 1 Allgemeiner Konzernbegriff | 28 | ||
| A. Historische Entwicklung | 28 | ||
| B. Struktu | 29 | ||
| I. Beherrschung zwischen Unternehme | 30 | ||
| 1. Einflussnahme | 30 | ||
| 2. Abhängigkeit | 30 | ||
| 3. Vermutung der Abhängigkeit | 31 | ||
| 4. Ergebnis | 31 | ||
| II. Unterordnungskonzer | 31 | ||
| 1. Einheitliche Leitung | 32 | ||
| 2. Vertraglicher und faktischer Unterordnungskonzer | 32 | ||
| 3. Konzernvermutung | 33 | ||
| 4. Ergebnis | 33 | ||
| III. Gleichordnungskonzer | 33 | ||
| § 2 Kartellrechtlicher Konzernbegriff | 34 | ||
| A. Rechtslage nach Unionsrecht | 34 | ||
| I. Unternehmensbegriff | 34 | ||
| II. Wirtschaftliche Einheit | 35 | ||
| 1. Einflussnahme und Einflussmöglichkeit | 35 | ||
| 2. Definitionshoheit | 37 | ||
| III. Unternehmensprivileg | 38 | ||
| IV. Ergebnis | 38 | ||
| B. Rechtslage nach deutschem Recht | 39 | ||
| I. Zurechnungskriterie | 40 | ||
| 1. Verbundklausel (§ 36 Abs. 2 S. 1 GWB) | 40 | ||
| 2. Mehrmütterklausel (§ 36 Abs. 2 S. 2 GWB) | 41 | ||
| II. Wirtschaftliche Einheit gemäß § 81 Abs. 4 GWB | 41 | ||
| III. Konzernprivileg | 41 | ||
| IV. Neuerungen durch die 9. GWB-Novelle | 42 | ||
| V. Ergebnis | 43 | ||
| C. Vergleich des Konzernbegriffs im deutschen Recht und im Unionsrecht | 43 | ||
| I. Konzern und Unternehmensverständnis | 44 | ||
| II. Vermutunge | 45 | ||
| III. Konzernprivileg | 45 | ||
| § 3 Allgemeine Haftungsgrundsätze | 46 | ||
| A. Unionsrechtliche Konzernhaftung | 46 | ||
| B. Deutsche Konzernhaftung | 46 | ||
| I. Trennungsprinzip | 47 | ||
| II. Verschuldensprinzip | 48 | ||
| III. Zurechnung von Kartellverstöße | 48 | ||
| C. Spannungsfelde | 49 | ||
| D. Ergebnis | 50 | ||
| Teil 2: Bußgeldhaftung des Konzerns im Außenverhältnis | 51 | ||
| § 1 Haftungsgrundlage | 51 | ||
| A. Natur des Bußgeldes | 51 | ||
| B. Unionsrechtliche Haftungsgrundlage (Art. 23 VO (EG) Nr. 1/2003) | 53 | ||
| I. Historischer Zusammenhang | 53 | ||
| II. Tatbestand | 54 | ||
| 1. Allgemeines | 54 | ||
| 2. Normadressat | 54 | ||
| 3. Tatbestandsmerkmale | 55 | ||
| III. Bußgeldhöhe | 56 | ||
| IV. Verfahre | 57 | ||
| C. Deutsche Haftungsgrundlage | 57 | ||
| I. Grundlage | 58 | ||
| II. Haftung gemäß § 81 GWB | 58 | ||
| 1. Historischer Zusammenhang | 58 | ||
| 2. Tatbestand | 59 | ||
| a) § 81 Abs. 1 und 2 GWB | 59 | ||
| b) Bußgeldhöhe (§ 81 Abs. 4 GWB) | 60 | ||
| aa) Allgemeines | 60 | ||
| bb) Kriterien bei der Bußgeldbemessung | 60 | ||
| cc) Bußgeldobergrenze | 61 | ||
| c) Verfahre | 61 | ||
| III. Neuerungen durch die 9. GWB-Novelle | 62 | ||
| 1. Neue Bußgeldtatbestände | 62 | ||
| 2. Bußgeldhöhe | 63 | ||
| IV. Haftung nach dem OWiG | 63 | ||
| 1. § 130 Abs. 1 OWiG | 64 | ||
| 2. § 30 Abs. 1 OWiG | 64 | ||
| 3. § 9 OWiG | 65 | ||
| 4. Ergebnis | 65 | ||
| § 2 Außenhaftung des Konzerns | 65 | ||
| A. Haftung der Muttergesellschaft bei Zuwiderhandlung durch eine Tochtergesellschaft | 66 | ||
| I. Rechtslage nach Unionsrecht | 66 | ||
| 1. Haftungszurechnung im Konzer | 66 | ||
| a) Muttergesellschaft als Beteiligte | 66 | ||
| b) Organisationsverschulde | 67 | ||
| c) Fremdverschulde | 68 | ||
| d) Unternehmensbegriff | 68 | ||
| 2. Haftungsausformung | 69 | ||
| 3. Haftungsvermutung | 69 | ||
| a) Vermutung für das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit | 70 | ||
| aa) 100%ige Beteiligung | 70 | ||
| (1) Plusfaktore | 71 | ||
| (2) Begründung der Vermutung | 72 | ||
| (3) Beweislast für den Gegenbeweis | 72 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 73 | ||
| bb) Unter 100%ige Beteiligung | 73 | ||
| (1) Teleologische Begründung der Vermutung | 73 | ||
| (2) Entscheidung Commercial Solvents | 74 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 75 | ||
| b) Widerlegbarkeit | 75 | ||
| aa) Berufung auf das gesellschaftsrechtliche Trennungsprinzip | 76 | ||
| bb) Vertraglicher Verzicht auf Einflussrechte | 77 | ||
| cc) Berufung auf Unkenntnis | 77 | ||
| dd) Nicht ausgeführte Weisunge | 78 | ||
| ee) Dauer der Beteiligung | 78 | ||
| ff) Form der Beteiligung | 79 | ||
| gg) Geschäfte „at arm's length“ | 80 | ||
| hh) Compliance-Programm | 80 | ||
| (1) Begriffserklärung | 80 | ||
| (2) Tauglichkeit als Beweis gegen die tatsächliche Einflussnahme | 81 | ||
| ii) Zwischenergebnis | 81 | ||
| 4. Kritik an der Haftungspraxis | 82 | ||
| a) Vereinbarkeit mit rechtsstaatlichen und gesetzlichen Grundsätze | 82 | ||
| aa) Ne bis in idem | 82 | ||
| (1) Allgemei | 83 | ||
| (2) Gewährleistungsumfang | 83 | ||
| (a) Problemaufriss | 83 | ||
| (b) Einheit der Rechtsordnung und Telos des Doppelbestrafungsverbots | 84 | ||
| (c) Vergleich mit der EMRK | 85 | ||
| (d) Rechtsgutsidentität | 86 | ||
| (e) Zwischenergebnis | 86 | ||
| (3) Sanktionierung durch verschiedene Behörde | 87 | ||
| (a) Allgemeines | 87 | ||
| (b) Globale Kartelle | 88 | ||
| (c) Europäische Kartelle | 89 | ||
| (d) Zwischenergebnis | 90 | ||
| bb) Schuldprinzip und Unschuldsvermutung | 90 | ||
| (1) Grundlage | 90 | ||
| (2) Vereinbarkeit | 91 | ||
| (3) Unvereinbarkeit | 92 | ||
| (4) Stellungnahme | 94 | ||
| (5) Zwischenergebnis | 96 | ||
| cc) Gesetzmäßigkeit der Strafe und Bestimmtheitsgebot | 96 | ||
| (1) Grundlage | 97 | ||
| (2) Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgebot | 98 | ||
| (a) Bußgeldbemessung | 98 | ||
| (b) Unternehmensbegriff und Beteiligungsvermutung | 100 | ||
| (3) Bußgeldleitlinien und Wesentlichkeitsvorbehalt | 101 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 102 | ||
| dd) Trennungsprinzip | 103 | ||
| (1) Unvereinbarkeit | 103 | ||
| (2) Vereinbarkeit | 104 | ||
| (3) Stellungnahme | 104 | ||
| (a) Normhierarchie | 105 | ||
| (b) Effektive Normdurchsetzung | 106 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 108 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 109 | ||
| b) Widerlegbarkeit der Beteiligungsvermutung | 109 | ||
| aa) Rohtabak Spanie | 110 | ||
| bb) Kautschukchemikalie | 110 | ||
| (1) Sachverhalt | 110 | ||
| (2) Vortrag | 111 | ||
| (3) Bewertung | 111 | ||
| (a) Tagesgeschäft, Geschäftsführung und Protokolle | 111 | ||
| (b) Personelle Verflechtung, Aufgabenteilung und Abschlussberichte | 112 | ||
| (c) Unabhängige Preisbestimmung | 113 | ||
| (d) Zwischenergebnis | 114 | ||
| cc) MCAA | 114 | ||
| (1) Sachverhalt | 114 | ||
| (2) Vortrag | 114 | ||
| (3) Bewertung | 115 | ||
| (a) Vorgehen der Kommissio | 115 | ||
| (b) Eigenes Mitwirke | 116 | ||
| (c) Unabhängigkeit | 116 | ||
| (d) Holdingstruktu | 116 | ||
| (e) 98%-Beteiligung | 117 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 117 | ||
| dd) Cholinchlorid | 117 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 118 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 119 | ||
| II. Rechtslage nach deutschem Recht | 119 | ||
| 1. Kein eigenes Fehlverhalten der Muttergesellschaft | 120 | ||
| a) Haftung gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 GWB | 120 | ||
| b) Haftung gemäß § 81 Abs. 4 GWB | 121 | ||
| aa) Rechtsstaatliche Bedenke | 121 | ||
| bb) Haftung | 122 | ||
| c) Zwischenergebnis | 123 | ||
| 2. Fehlverhalten der Tochtergesellschaft und zusätzliches Fehlverhalten der Muttergesellschaft | 123 | ||
| a) Aktive Beteiligung | 124 | ||
| b) Haftung gemäß § 130 Abs. 1 OWiG | 124 | ||
| aa) Grundlage | 124 | ||
| bb) Konzernmutter als Unternehmensinhaberin mit Aufsichtspflicht | 126 | ||
| cc) Keine Unternehmensinhaberin und keine Aufsichtspflicht | 127 | ||
| dd) Stellungnahme | 129 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 131 | ||
| c) Haftung gemäß § 30 Abs. 1 OWiG | 131 | ||
| aa) Haftung aufgrund Handeln in Personalunio | 131 | ||
| (1) Interessentheorie | 132 | ||
| (2) Funktionstheorie | 133 | ||
| (3) Parallelität zu § 31 BGB | 134 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 135 | ||
| bb) Haftung als faktisches Organ der Tochtergesellschaft | 135 | ||
| (1) Grundlage | 135 | ||
| (2) Juristische Person als faktisches Orga | 137 | ||
| (a) Ansicht des BGH | 137 | ||
| (b) Bewertung | 137 | ||
| (aa) Stellungnahme zum BGH | 137 | ||
| (bb) Gesellschaftsrechtliches Trennungsprinzip | 138 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 139 | ||
| cc) Haftungsbegründung durch Analogie | 139 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 139 | ||
| d) Haftung aufgrund Unterlassens | 139 | ||
| aa) Unterlasse | 140 | ||
| bb) Garantenstellung | 140 | ||
| (1) § 130 Abs. 1 OWiG | 141 | ||
| (2) Gesellschaftsrechtliche Norme | 141 | ||
| (3) § 831 BGB | 142 | ||
| (4) Faktischer Einfluss der Konzernmutte | 143 | ||
| (5) Ingerenz | 144 | ||
| (a) Umstrukturierung und Konzernierung | 144 | ||
| (b) Nichteinführung eines Compliance-Programms | 144 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 146 | ||
| e) Zwischenergebnis | 146 | ||
| 3. Neuerungen durch die 9. GWB-Novelle | 146 | ||
| a) Rechtmäßigkeit der Neuregelung | 147 | ||
| aa) Vereinbarkeit mit dem gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzip | 147 | ||
| bb) Vereinbarkeit mit dem Schuldgrundsatz | 147 | ||
| cc) Vereinbarkeit mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz | 148 | ||
| b) Rechtswidrigkeit der Neuregelung | 148 | ||
| aa) Vereinbarkeit mit dem gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzip | 149 | ||
| bb) Vereinbarkeit mit dem Schuldgrundsatz | 149 | ||
| cc) Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatz | 150 | ||
| c) Bewertung | 150 | ||
| aa) Vereinbarkeit mit dem gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzip | 150 | ||
| bb) Vereinbarkeit mit dem Schuldgrundsatz | 151 | ||
| (1) Anwendbarkeit | 151 | ||
| (2) Verstoß | 153 | ||
| (3) Rechtfertigung | 154 | ||
| cc) Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatz | 156 | ||
| d) Zwischenergebnis | 156 | ||
| B. Haftung der Tochtergesellschaft bei Verstoß durch die Muttergesellschaft | 157 | ||
| I. Rechtslage nach Unionsrecht | 157 | ||
| II. Rechtslage nach deutschem Recht | 159 | ||
| 1. Fehlverhalten der Muttergesellschaft und zusätzliches Fehlverhalten der Tochtergesellschaft | 159 | ||
| 2. Kein zusätzliches Fehlverhalten der Tochtergesellschaft | 159 | ||
| III. Zwischenergebnis | 160 | ||
| C. Ergebnis | 160 | ||
| § 3 Enthaftungsmöglichkeite | 161 | ||
| A. Leniency-Programme | 162 | ||
| I. Hintergrund | 162 | ||
| II. Rechtslage nach Unionsrecht | 163 | ||
| 1. Entwicklung | 163 | ||
| 2. Allgemeines | 164 | ||
| 3. Probleme in Konzernsachverhalte | 164 | ||
| a) Antrag der Muttergesellschaft | 164 | ||
| aa) Wirkung | 164 | ||
| bb) Antragsbefugnis | 166 | ||
| b) Antrag der Tochtergesellschaft | 167 | ||
| aa) Wirkung | 167 | ||
| bb) Antragsbefugnis | 169 | ||
| c) Antrag von Mutter- und Tochtergesellschaft | 169 | ||
| aa) Zulässigkeit | 169 | ||
| bb) Divergierende Entscheidungen der Kommissio | 170 | ||
| cc) Zeitpunkt des Antrags | 171 | ||
| dd) Rangwirkung | 172 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 174 | ||
| III. Rechtslage nach deutschem Recht | 175 | ||
| 1. Grundlage | 175 | ||
| 2. Unterschiede zum Kronzeugenprogramm | 176 | ||
| 3. Probleme in Konzernsachverhalte | 177 | ||
| B. Vergleichsverfahre | 178 | ||
| I. Hintergrund | 178 | ||
| II. Verfahre | 179 | ||
| 1. Grundlage | 179 | ||
| 2. Überblick | 179 | ||
| 3. Zusammenhang mit der Kronzeugenmitteilung | 180 | ||
| III. Probleme in Konzernsachverhalte | 181 | ||
| 1. Zulässigkeit mehrerer Anträge | 181 | ||
| 2. Unternehmensverständnis | 181 | ||
| 3. Wirkung | 182 | ||
| C. Umstrukturierunge | 182 | ||
| I. Rechtslage nach Unionsrecht | 182 | ||
| 1. Firmen- oder Rechtsformänderung | 183 | ||
| 2. Veräußerung | 183 | ||
| a) Grundlage | 183 | ||
| b) Unterscheidung nach den Veräußerungsarte | 184 | ||
| aa) Anteilserwerb (Share Deal) | 184 | ||
| bb) Vermögenserwerb (Asset Deal) | 185 | ||
| 3. Verschmelzung | 186 | ||
| 4. Spaltung | 186 | ||
| 5. Enthaftende Umstrukturierunge | 187 | ||
| 6. Zwischenergebnis | 187 | ||
| II. Rechtslage nach deutschem Recht | 188 | ||
| 1. Grundlage | 189 | ||
| 2. Alte Rechtslage | 189 | ||
| a) Ausgangslage | 189 | ||
| b) Wirtschaftliche Identität | 190 | ||
| c) Europarechtlicher Einfluss | 191 | ||
| d) Enthaftende Umstrukturierunge | 192 | ||
| 3. Rechtslage bis zum Inkrafttreten der 9. GWB-Novelle | 193 | ||
| a) Grundlage | 193 | ||
| b) Haftung gemäß § 30 Abs. 2a OWiG | 193 | ||
| c) Regelungslücke | 194 | ||
| d) Enthaftende Umstrukturierunge | 195 | ||
| e) Bewertung | 197 | ||
| 4. Neuerungen durch die 9. GWB-Novelle | 199 | ||
| a) Bußgeldvorschriften (§§ 81 Abs. 3a, 3b, 3c GWB n.F.) | 199 | ||
| aa) Neuregelunge | 199 | ||
| (1) § 81 Abs. 3a GWB n.F. | 199 | ||
| (2) § 81 Abs. 3b GWB n.F. | 199 | ||
| (3) § 81 Abs. 3c GWB n.F. | 200 | ||
| bb) Bewertung | 200 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 201 | ||
| b) Ausfallhaftung im Übergangszeitraum (§ 81a Abs. 1 GWB n.F.) | 201 | ||
| aa) Neuregelung | 201 | ||
| bb) Bewertung | 202 | ||
| (1) Rückwirkungsverbot | 202 | ||
| (2) Wissenszurechnung | 203 | ||
| (3) Zweck der Geldbuße | 204 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 205 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 205 | ||
| D. Compliance-Programme | 206 | ||
| I. Rechtslage nach Unionsrecht | 206 | ||
| 1. Bußgelderlass | 206 | ||
| 2. Bußgeldbemessung | 207 | ||
| a) Entwicklung | 207 | ||
| b) Bewertung | 208 | ||
| aa) Präventive Funktio | 208 | ||
| bb) Wertungswiderspruch mit dem Kronzeugenprogramm | 210 | ||
| cc) Nachteile im Rahmen des Kronzeugenprogramms | 211 | ||
| dd) Nachteile im Rahmen des Unternehmensbegriffs | 212 | ||
| ee) Vereinbarkeit mit den Bußgeldleitlinie | 212 | ||
| c) Zwischenergebnis | 213 | ||
| II. Rechtslage nach deutschem Recht | 213 | ||
| 1. Bußgelderlass | 213 | ||
| a) Zuwiderhandlung der Tochtergesellschaft | 213 | ||
| b) Beteiligung der Konzernmutte | 214 | ||
| aa) Verschulde | 214 | ||
| bb) Aufsichtspflichtverletzung | 214 | ||
| 2. Bußgeldbemessung | 215 | ||
| a) Grundlage | 215 | ||
| b) Bemessung gemäß § 81 Abs. 4 GWB | 216 | ||
| c) Bemessung gemäß §§ 81 Abs. 4 S. 6 GWB, 17 Abs. 3 OWiG | 216 | ||
| d) Vereinbarkeit mit dem Telos der Geldbuße | 216 | ||
| e) Vereinbarkeit mit der Bonusregelung | 217 | ||
| f) Zwischenergebnis | 217 | ||
| E. Ergebnis | 217 | ||
| § 4 Zusammenfassung | 218 | ||
| Teil 3: Gesamtschuldnerinnenausgleich im Konzern bei einer Geldbuße | 220 | ||
| § 1 Anwendbares Recht | 220 | ||
| A. Unionsrecht | 221 | ||
| B. Bestimmung des anwendbaren nationalen Rechts durch die Rom II-VO | 222 | ||
| I. Anwendungsbereich der Rom II-VO | 222 | ||
| 1. Außervertragliches Schuldverhältnis | 222 | ||
| 2. Zivil- und Handelssache | 224 | ||
| 3. Sachlicher und räumlicher Anwendungsbereich | 225 | ||
| 4. Ausnahme aufgrund gesellschaftsrechtlicher Anknüpfung (Art. 1 Abs. 2 lit. d) Rom II-VO) | 225 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 227 | ||
| II. Mehrfache Haftung (Art. 20 Rom II-VO) | 228 | ||
| III. Ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 10 Rom II-VO) | 228 | ||
| IV. Den freien Wettbewerb einschränkendes Verhalten (Art. 6 Abs. 3 Rom I-VO) | 229 | ||
| 1. Anwendbarkeit des Art. 6 Abs. 3 lit. a) Rom II-VO | 229 | ||
| a) Systematik und Wortlaut | 229 | ||
| b) Teleologischer Vergleich | 230 | ||
| aa) Ziel des Art. 6 Abs. 3 lit. a) Rom II-VO | 230 | ||
| bb) Ziel des Gesamtschuldnerinnenausgleichs | 231 | ||
| cc) Schadensersatz und Gesamtschuldnerinnenausgleich | 233 | ||
| (1) Vergleichbarkeit | 233 | ||
| (2) Übertragbarkeit der Rechtsprechung | 234 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 235 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 235 | ||
| 2. Anwendung des Art. 6 Abs. 3 lit. a) Rom II-VO | 235 | ||
| 3. Anwendbarkeit des Art. 6 Abs. 3 lit. b) Rom II-VO | 237 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 237 | ||
| V. Rechtswahl (Art. 14 Rom II-VO) | 238 | ||
| C. Ergebnis | 239 | ||
| § 2 Zuständigkeit für die Festlegung der Ausgleichskriterie | 239 | ||
| A. Europäische Kommissio | 239 | ||
| B. Nationale Gerichte | 240 | ||
| C. Stellungnahme | 240 | ||
| § 3 Ausgleichskriterie | 241 | ||
| A. Spannungsverhältnis | 242 | ||
| B. Vorgaben durch die Unionsgerichte | 242 | ||
| I. Vorgaben durch das EuG | 243 | ||
| II. Vorgaben durch den EuGH | 243 | ||
| III. Zwischenergebnis | 244 | ||
| C. Bekannte Ausgleichskriterien im Sinne des § 426 Abs. 1 BGB | 244 | ||
| I. Anwendbarkeit des § 426 Abs. 1 BGB | 245 | ||
| II. Zulässigkeit einer Einzelfallbetrachtung | 246 | ||
| 1. Pauschalisierte Betrachtung | 246 | ||
| a) Pro-Kopf-Aufteilung | 246 | ||
| b) Alleinhaftung der Muttergesellschaft | 246 | ||
| 2. Einzelfallbetrachtung | 247 | ||
| 3. Stellungnahme | 248 | ||
| a) Effektive Durchsetzung des Kartellverbots | 248 | ||
| b) Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht und der gesamtschuldnerischen Haftung | 249 | ||
| c) Umgehungsgefah | 249 | ||
| d) Selbständigkeit der abhängigen Gesellschafte | 250 | ||
| e) Zwischenergebnis | 251 | ||
| III. Vertragliche Vereinbarunge | 252 | ||
| 1. Grundlage | 252 | ||
| 2. Gewinnabführungsvertrag | 253 | ||
| 3. Sonstige vertragliche Ausgleichsregelunge | 254 | ||
| IV. Gesetzliche Sonderregelung gemäß §§ 840 Abs. 2, 831 BGB analog | 255 | ||
| 1. Grundlage | 255 | ||
| 2. Analogie | 255 | ||
| 3. Effektive Normdurchsetzung | 256 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 257 | ||
| V. Gesetzliche Sonderregelung gemäß Art. 23 Abs. 4 UAbs. 4 VO (EG) Nr. 1/2003 analog | 257 | ||
| VI. Gesetzliche Sonderregelungen gemäß § 254 BGB analog | 258 | ||
| 1. Grundlage | 258 | ||
| 2. Anwendbarkeit auf den kartellrechtlichen Innenausgleich | 258 | ||
| a) Stimmen gegen die Anwendbarkeit | 258 | ||
| b) Stimmen für die Anwendbarkeit | 260 | ||
| c) Stellungnahme | 260 | ||
| aa) Zurechnung fremden Verhaltens | 260 | ||
| bb) Effektive Normdurchsetzung | 260 | ||
| cc) Schaden und Schadensersatz | 261 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 261 | ||
| VII. Anderweitige Bestimmungen aus der Natur der Sache: erwirtschafteter Gewi | 262 | ||
| 1. Grundlage | 262 | ||
| 2. Effektive Normdurchsetzung | 263 | ||
| 3. Exklusivität des Ausgleichskriteriums | 264 | ||
| 4. Anwendungsschwierigkeite | 265 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 266 | ||
| VIII. Haftungseinheit | 266 | ||
| 1. Grundlage | 266 | ||
| 2. Anwendbarkeit beim kartellrechtlichen Innenausgleich | 267 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 267 | ||
| IX. Zwischenergebnis | 267 | ||
| D. Weitere vom BGH in der Entscheidung Calciumcarbid II verwendete Ausgleichskriterie | 268 | ||
| I. Art der Tatbeiträge | 268 | ||
| II. An die Bußgeldbemessung der Kommission angelehnte Ausgleichskriterie | 270 | ||
| 1. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und tatbefangene Umsätze | 270 | ||
| a) Allgemeines | 270 | ||
| b) Effektive Normdurchsetzung | 271 | ||
| c) Zwischenergebnis | 272 | ||
| 2. Verhältnis der Umsätze und die jeweilige wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Gesamtschuldner für den Binnenmarkt | 272 | ||
| a) Anwendungsprobleme | 273 | ||
| b) Effektive Normdurchsetzung | 273 | ||
| c) Zwischenergebnis | 274 | ||
| 3. Beiträge der einzelnen Gesamtschuldner zum Umfang der relevanten Marktbeteiligung des Unternehmens | 274 | ||
| III. Gleichlauf von Außen- und Innenverhältnis | 275 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 276 | ||
| E. Neue Kriterien für den Innenausgleich | 276 | ||
| I. Bußgeldleitlinien der Kommissio | 277 | ||
| 1. Grundlage | 277 | ||
| 2. Tauglichkeit für den Innenausgleich | 278 | ||
| a) Allgemeine Umstände | 278 | ||
| b) Erschwerende Umstände | 278 | ||
| c) Mildernde Umstände | 279 | ||
| d) Sonstiges | 280 | ||
| e) Zwischenergebnis | 280 | ||
| II. Leitlinien des Bundeskartellamts | 281 | ||
| III. Bußgeldbemessungskriterien der US-Gerichte | 282 | ||
| 1. Bußgeldbemessungskriterie | 282 | ||
| a) Erwirtschaftete Vorteile | 282 | ||
| b) Größe des Unternehmens | 282 | ||
| c) Vor- und Nachtatverhalte | 283 | ||
| d) Weitere Kriterie | 283 | ||
| 2. Erkenntnisse für die deutsche Rechtslage | 284 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 284 | ||
| F. Neuerungen durch die 9. GWB-Novelle | 285 | ||
| G. Ergebnis | 286 | ||
| § 4 Zusammenfassung | 286 | ||
| Teil 4: Gesamtschuldnerinnenausgleich im Konzern bei einem kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch | 288 | ||
| § 1 Grundlage | 289 | ||
| A. Ausgangslage | 289 | ||
| B. Zulässigkeit des Gesamtschuldnerinnenausgleichs | 289 | ||
| § 2 Gesamtschuldnerinnenausgleich nach deutschem Recht | 291 | ||
| A. Verhältnis von Schadensersatz und Bußgeld | 291 | ||
| I. Kartellrechtlicher Schadensersatzanspruch und Bußgeld | 292 | ||
| II. Erkenntnisse für den Gesamtschuldnerinnenausgleich bei einem kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch | 294 | ||
| B. Ausgleichskriterie | 295 | ||
| I. Vertragliche Vereinbarunge | 295 | ||
| II. Verursachungs- und Verschuldensbeiträge | 295 | ||
| III. Erwirtschaftete Vorteile | 296 | ||
| IV. Marktanteile | 297 | ||
| V. Rolle der Beteiligte | 298 | ||
| VI. Dauer der Beteiligung | 299 | ||
| VII. Bußgeldhöhe | 299 | ||
| VIII. Organisationsgrad | 300 | ||
| IX. Vor- und Nachtatverhalte | 300 | ||
| X. Zwischenergebnis | 301 | ||
| C. Verhältnis der Ausgleichskriterie | 302 | ||
| I. Verhältnis unter Berücksichtigung der Art des Kartells | 302 | ||
| 1. Horizontale Preisabsprache | 302 | ||
| 2. Vertikale Preisabsprache | 303 | ||
| 3. Submissionsabsprache | 303 | ||
| 4. Quotenkartelle | 303 | ||
| 5. Markt- und Kundenaufteilunge | 304 | ||
| II. Verhältnis unter Berücksichtigung besonderer Schadensarte | 304 | ||
| 1. Preisschirmeffekte | 304 | ||
| 2. Entgangene Gewinne | 305 | ||
| 3. Zinsschäde | 305 | ||
| III. Zwischenergebnis | 306 | ||
| D. Ergebnis | 306 | ||
| § 3 Gesamtschuldnerinnenausgleich im Vereinigten Königreich und in den USA bei einem Schadensersatzanspruch | 307 | ||
| A. Rechtslage im Vereinigten Königreich | 307 | ||
| I. Grundlage | 307 | ||
| 1. Geschichte des Innenausgleichs | 307 | ||
| 2. Innenausgleich de lege lata | 308 | ||
| II. Ausgleichskriterie | 309 | ||
| 1. Vertragliche Vereinbarunge | 309 | ||
| 2. Verursachungsbeiträge | 309 | ||
| 3. Schuldhaftigkeit | 310 | ||
| 4. Vorteilsabschöpfung | 311 | ||
| 5. Pro-Kopf-Aufteilung | 312 | ||
| 6. Verhältnis der Ausgleichskriterie | 312 | ||
| III. Gesamtschuldnerausgleich bei einem kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch | 313 | ||
| 1. Grundlage | 314 | ||
| 2. Vertragliche Vereinbarunge | 314 | ||
| 3. Erwirtschaftete Vorteile | 314 | ||
| 4. Verursachungsbeiträge und Schuldhaftigkeit | 315 | ||
| 5. Vor- und Nachtatverhalte | 316 | ||
| 6. Unternehmensgröße und Marktanteil | 316 | ||
| 7. Verhältnis der Ausgleichskriterie | 317 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 317 | ||
| B. Rechtslage in den USA | 317 | ||
| I. Grundlage | 318 | ||
| II. Vorgeschlagene Ausgleichskriterie | 318 | ||
| C. Übertragbarkeit der Ergebnisse | 319 | ||
| I. Ausgleichskriterie | 320 | ||
| II. Verhältnis der Ausgleichskriterie | 320 | ||
| § 4 Verhältnis von „zivilrechtlichem“ und „bußgeldrechtlichem“ Gesamtschuldnerinnenausgleich | 320 | ||
| A. Erkenntnisse für den „zivilrechtlichen“ Gesamtschuldnerinnenausgleich | 321 | ||
| B. Erkenntnisse für den „bußgeldrechtlichen“ Gesamtschuldnerinnenausgleich | 322 | ||
| § 5 Zusammenfassung | 323 | ||
| Schlussbetrachtung | 324 | ||
| A. Unionsrechtliche Außenhaftung des Konzerns | 324 | ||
| B. Außenhaftung des Konzerns nach deutschem Recht | 324 | ||
| C. Enthaftungsmöglichkeite | 325 | ||
| D. Gesamtschuldnerinnenausgleich im Konzern bei einer Geldbuße | 325 | ||
| E. Gesamtschuldnerinnenausgleich im Konzern bei einem Schadensersatzanspruch | 326 | ||
| Literaturverzeichnis | 327 | ||
| Sachverzeichnis | 346 |
