Das System und die Prinzipien der Einkünfte im werdenden Staat der Neuzeit,
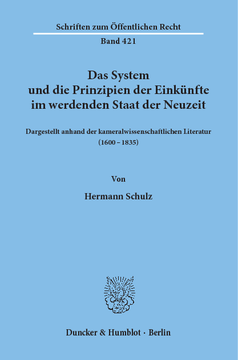
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das System und die Prinzipien der Einkünfte im werdenden Staat der Neuzeit,
dargestellt anhand der kameralwissenschaftlichen Literatur (1600 - 1835)
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 421
(1982)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung: Wissenschaftliche Einordnung, Ziel und Aufbau der Arbeit | 19 | ||
| I. Die vor- und frühkameralistische Literatur in der Zeit vom 16. Jahrhundert bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts | 25 | ||
| A. Die Entwicklung der Systematik der landesherrlichen Einkünfte | 25 | ||
| 1. Die ethische, additive Ratskonzeption | 28 | ||
| a) Jean Bodin (1530 - 1596) | 29 | ||
| b) Theophilus Ellychnius | 33 | ||
| 2. Der Gliederungsansatz nach ersten rationalen Einkunftsmerkmalen | 38 | ||
| a) Johannes Boterio (ca. 1533/1544 - 1617) | 38 | ||
| b) Georg Obrecht (1547 - 1612) | 41 | ||
| 3. Die dichotomische Gliederungsvielfalt der sogenannten juristischen Steuerliteratur | 44 | ||
| a) Jakob Bornitz (ca. 1560 - 1625) | 46 | ||
| b) Christoph Besold (1577 - 1638) | 50 | ||
| c) Kaspar Klock (1583 - 1655) | 51 | ||
| d) Maximilian Faust von Aschaffenburg | 52 | ||
| 4. Schlußanmerkung. Das Fehlen einer Gliederungsdiskussion | 53 | ||
| B. Die Einkunftsberechtigung des Regenten und die Einkunftsprinzipien | 54 | ||
| 1. Die Einkunftsberechtigung | 55 | ||
| 2. Das ständische Steuerbewilligungsrecht | 55 | ||
| 3. Die Einkunftsprinzipien | 60 | ||
| a) Vorrang der Kammergefälle | 60 | ||
| b) Subsidiarität der Auflagen | 61 | ||
| c) Sparsamkeit in der Haushaltsführung | 64 | ||
| d) Der Grundsatz der Mäßigkeit | 66 | ||
| e) Der Grundsatz des Substanzschutzes | 67 | ||
| f) Die Grundsätze der Leistungsfähigkeit, Gleichheit und Allgemeinheit (Proportionalität) der Abgaben | 69 | ||
| g) Übermaßverbot und Herrschaftszweck | 72 | ||
| II. Die frühe Kameralepoche seit dem Ausgang des Dreißigjährigen Krieges bis zur Einrichtung der ersten Kamerallehrstühle (ca. 1650 - 1730) | 73 | ||
| A. Die Entwicklung der Systematik der Einkünfte | 73 | ||
| 1. Die herrschaftlichen Gütereinkünfte | 74 | ||
| a) Die eigenen fürstlichen Einkünfte nach Seckendorff | 74 | ||
| b) Die herrschaftlichen Gütereinkünfte nach Lau | 76 | ||
| c) Die rechtliche Qualifizierung der herrschaftlichen Güter als Domänen | 77 | ||
| d) Der Rechtsgrund der herrschaftlichen Güter und Domänen | 78 | ||
| 2. Die Einkunftskategorie der Regalieneinkünfte | 79 | ||
| a) Die Formierung der Regalieneinkünfte als eigenständige Gattung der landesherrlichen Intraden nach Seckendorff | 79 | ||
| b) Die Regalien und Regalieneinkünfte | 80 | ||
| aa) Der Begriff der Regalien | 81 | ||
| bb) Der Rechtsgrund der Regalien | 82 | ||
| cc) Die Gliederung der Regalien | 85 | ||
| dd) Der gegenständliche Bereich der Regalien | 86 | ||
| α) Der Katalog der Regalien | 86 | ||
| β) Die Ausgliederung der Steuern und die Triasbildung Domänen — Regalien — Steuern | 89 | ||
| 3. Die Ordnung der Steuern | 91 | ||
| a) Das Ideal der regulären Steuer | 91 | ||
| b) Die Steueranlässe | 95 | ||
| c) Der Steuerbegriff | 96 | ||
| d) Das Steuererhebungsrecht | 99 | ||
| e) Die Steuerlegitimation | 102 | ||
| B. Ausgestaltung und Prinzipien der Einkünfte | 106 | ||
| 1. Die herrschaftlichen Gütereinkünfte | 106 | ||
| 2. Die Nutzungen der Regalien | 108 | ||
| a) Das Bergwerksregal | 108 | ||
| b) Das Münzregal | 109 | ||
| c) Das Postregal | 110 | ||
| d) Das Straßen-, Geleits- und Zollregal | 110 | ||
| e) Das Jagdregal | 112 | ||
| f) Das Forstregal | 112 | ||
| g) Das Fischereiregal und andere Wassernutzungen | 113 | ||
| h) Das Lehensregal | 113 | ||
| 3. Die Steuerprinzipien | 114 | ||
| a) Die Steuergleichheit | 115 | ||
| aa) Der Grundsatz der Allgemeinheit der Steuern. Exkurs: die Akzise | 116 | ||
| bb) Der Grundsatz materiell gleicher Steuerbelastung | 126 | ||
| cc) Steuergleichheit, Steuermäßigkeit und Fähigkeitstheorem | 130 | ||
| dd) Steuergleichheit, Steuerfreiheit und Erhalt des Notbedarfs | 133 | ||
| b) Das Verbot der Doppelbesteuerung | 134 | ||
| c) Der Grundsatz der Ertrags- bzw. Gewinnbesteuerung | 135 | ||
| d) Der Grundsatz der Wirtschaftsfreundlichkeit und Wirtschaftsförderlichkeit der Steuern | 138 | ||
| e) Der Grundsatz der Vermögensgeheimhaltung | 139 | ||
| f) Der Grundsatz der Bestimmtheit der Besteuerung | 141 | ||
| g) Der Grundsatz der Bequemlichkeit der Besteuerung | 142 | ||
| h) Der Grundsatz der Wohlfeilheit der Besteuerung | 144 | ||
| i) Der Grundsatz der Besteuerung nach dem Zustand des Landes und der Steuerpflichtigen | 145 | ||
| k) Der Grundsatz der Begrenzung der Gesamtsteuereinkünfte durch den Herrschaftszweck | 149 | ||
| l) Der Grundsatz der Einheit und Widerspruchsfreiheit der Steuerordnung | 150 | ||
| III. Die spätere Kameralepoche (ca. 1730 - 1835) | 153 | ||
| A. Die Systematisierungsansätze zur Gliederung der Einkünfte | 154 | ||
| 1. Die Gliederung in ordentliche und außerordentliche Einkünfte | 154 | ||
| 2. Die Gliederung in ordentliche Einkünfte aus Domänen, Regalien und Steuerauflagen bzw. Domänen, Regalien, zufälligen Einkünften und Steuerauflagen | 154 | ||
| 3. Die Gliederung in unmittelbare und mittelbare Einkünfte bzw. in Einkünfte aus eigenem Vermögen und Einkünfte aus dem Vermögen der Untertanen und Bürger | 155 | ||
| 4. Weitere Gliederungsansätze | 158 | ||
| 5. Nichttragende Gliederungsansätze, insbesondere die Gliederung in Aerar- und Fiskaleinkünfte | 159 | ||
| B. Die materielle Ausgestaltung des Einkunftswesens. Die Generalmaximen des Finanzwesens | 162 | ||
| C. Die Domänen und Domäneneinkünfte | 165 | ||
| 1. Die Bezeichnung „Domänen" und bedeutungsgleiche Benennungen | 165 | ||
| 2. Der Domänenbegriff | 167 | ||
| a) Die Güter und Rechte der Domänen | 169 | ||
| aa) Die Grundstücke | 170 | ||
| bb) Die „Zugehörungen" | 171 | ||
| cc) Die Gerechtsamen | 174 | ||
| b) Die Domänen als Staatsgüter | 176 | ||
| aa) Die Scheidung in Domänen (öffentliche Güter) und Chatoulgüter (Privatgüter) | 177 | ||
| α) Die Chatoulgüter als Privatgüter | 178 | ||
| β) Die Domänen als öffentliche Güter | 183 | ||
| bb) Die Zuordnung der Domänen zum Eigentum bzw. Besitz des Regenten als Regenten | 183 | ||
| cc) Die Domänen als Staatsgüter | 184 | ||
| dd) Das dominiale Staatsgut — Theorie und Realität | 185 | ||
| c) Die Berechtigung des Regenten an den Domäneneinkünften | 190 | ||
| d) Die Zweckbindung der Domäneneinkünfte | 191 | ||
| e) Die Unveräußerlichkeit der Domänen | 193 | ||
| 3. Die Kameralaufgabe der „Besorgung" der Domänen | 198 | ||
| 4. Die Domäneneinkünfte und ihre Ausgestaltung | 200 | ||
| a) Domäneneinkünfte aus der Verwaltung des Domänenguts | 201 | ||
| aa) Die Amtsverwaltung der Domänen | 201 | ||
| bb) Die Gewährsverwaltung der Domänen | 202 | ||
| cc) Die Einschätzung der Einkunftserzielung durch Verwaltung der Domänen | 203 | ||
| α) Die Nutzung der Güter | 203 | ||
| β) Die Ausübung der dominialen Sonderrechte | 206 | ||
| αα) Der Zehnte | 206 | ||
| ββ) Die Fron | 209 | ||
| b) Domäneneinkünfte aus der Verpachtung der Domänengüter | 210 | ||
| aa) Die Pachtzinsen | 210 | ||
| bb) Die Pachtarten | 211 | ||
| cc) Die Einschätzung der Einkunftserzielung durch Verpachtung der Domänengüter | 211 | ||
| c) Domäneneinkünfte aus der Zerschlagung und Austeilung der Domänengüter | 213 | ||
| aa) Die Arten der Güterausteilung | 213 | ||
| bb) Die Einkünfte aus der Güterausteilung | 214 | ||
| cc) Die Einschätzung der Einkunftserzielung aus der Privatisierung der Güter. Exkurs: die Lehre der Physiokraten | 214 | ||
| d) Das Gewicht der dominialen Einkünfte in der Theorie und Praxis | 217 | ||
| D. Die Regalien, zufälligen Einkünfte und deren Nutzungen | 219 | ||
| 1. Der Regalienbegriff und die Kategorie der zufälligen Einkünfte | 220 | ||
| a) Der Rechtsgrund der Regalien | 220 | ||
| aa) Die Regalien als implizierte Rechte der Landeshoheit | 220 | ||
| bb) Die Obsoleszenz alter Rechtsquellen | 221 | ||
| cc) Die sekundäre Bedeutung der historischen Ursprungsgründe | 222 | ||
| dd) Die Bedeutungslosigkeit traditioneller Regaliengliederungen | 223 | ||
| ee) Die Wesensgleichheit der Regalien und sonstigen Regierungsrechte | 224 | ||
| ff) Die Zuordnung der Regalien zum Subjekt „Staat" | 224 | ||
| b) Die Bestimmung des Umfangs der Regalien | 225 | ||
| aa) Die Bestimmung der Regalien nach materiellen Kriterien | 226 | ||
| α) Die Grundlegung bei Justi | 226 | ||
| β) Die Fortschreibung der materiellen Regalienbestimmung | 228 | ||
| γ) Die Benennung der Regalien | 232 | ||
| δ) Der Normativcharakter der Regalienbestimmung | 233 | ||
| bb) Die formale Regalienbestimmung | 234 | ||
| α) Das formale Zuordnungsmoment in der materiellen Regalienlehre | 234 | ||
| β) Die tradierte formale Zuordnungslehre | 235 | ||
| γ) Die Fortführung und neuerliche Hinwendung zur formalen Regalienlehre | 236 | ||
| δ) Die gemischt formale-materielle Regalienlehre | 239 | ||
| ε) Die Benennung der Regalien | 240 | ||
| c) Die Gliederung der Regalien nach inneren Finanzprinzipien in „Finanzregalien" und „wesentliche Regalien". Die Trennung der staatlichen Einkunftsrechte in „Regalien" und „zufällige Einkünfte" | 241 | ||
| aa) Die Lehre von den „Finanzregalien" und „wesentlichen Regalien" | 243 | ||
| bb) Die Lehre von den „Regalien" und „zufälligen Einkünften" | 247 | ||
| α) Das regalische Einkunftsprinzip | 248 | ||
| β) Die zufälligen Einkünfte | 251 | ||
| αα) Der Rechtsgrund der zufälligen Einkünfte | 251 | ||
| ββ) Die einzelnen zufälligen Einkünfte | 252 | ||
| γγ) Das Einkunftsprinzip der zufälligen Einkünfte | 255 | ||
| δδ) Die Terminologie „zufällige Einkünfte" | 256 | ||
| cc) Würdigung | 256 | ||
| d) Die Aufgabe der Kategorie der Regalieneinkünfte und zufälligen Einkünfte | 257 | ||
| aa) Die Reduktion der Regalien auf Erwerbseinkünfte, Polizeirevenuen und Steuern | 257 | ||
| bb) Das Verdikt der Physiokratie über die Regalien | 260 | ||
| cc) Das Aufgeben der verfassungsrechtlichen Einkunftskategorie der Regalien | 262 | ||
| 2. Die Lehren zu den einzelnen („Finanz-") „Regalien" und Regalieneinkünften | 268 | ||
| a) Die Finanz- und Einkunftsmaximen | 268 | ||
| aa) Der Grundsatz der Vermehrung der Regalieneinkünfte und die Aufgabe dieser Maxime | 268 | ||
| bb) Der Grundsatz der Administration der Regalien | 270 | ||
| cc) Die Gestaltungsmaximen der Regalieneinkünfte | 271 | ||
| b) Die einzelnen Regalien und die Regalieneinkünfte | 272 | ||
| aa) Das Bergwerksregal | 272 | ||
| α) Der Rechtsgrund des Bergwerksregals | 272 | ||
| β) Der Inhalt des Bergwerksregals | 274 | ||
| γ) Der Umfang und die Nutzungsformen des Bergwerksregals | 275 | ||
| δ) Die Einkünfte aus dem Bergwerksregal | 277 | ||
| bb) Das Salzregal | 278 | ||
| α) Die Regalität des Salzes | 278 | ||
| β) Der Umfang der regalischen Salzrechte | 278 | ||
| γ) Die Salzintraden | 279 | ||
| δ) Die Einschätzung des Salzregals | 279 | ||
| cc) Das Salpeterregal | 280 | ||
| α) Die Regalität des Salpeters | 280 | ||
| β) Die Regaliennutzungen | 281 | ||
| dd) Das Münzregal | 282 | ||
| α) Der Rechtsgrund und Inhalt des Münzregals | 282 | ||
| β) Die Funktion des Geldes und der Zweck des Münzregals | 282 | ||
| γ) Die Ausgestaltung des Geldes | 283 | ||
| δ) Die Nutzungen aus dem Münzregal | 284 | ||
| ee) Das Straßenregal | 286 | ||
| α) Der Begriff des Straßenregals im weiteren Sinne | 286 | ||
| β) Die Zweckbestimmung des Straßenregals im weiteren Sinne | 286 | ||
| γ) Das Straßenregal im engeren Sinne | 287 | ||
| αα) Der Begriff des Straßenregals im engeren Sinne | 287 | ||
| ββ) Das Straßenwesen und die Straßengelder | 288 | ||
| γγ) Die Legitimation der Straßengelder | 289 | ||
| δδ) Die Ausgestaltung der Straßengelder | 290 | ||
| δ) Das Geleitsregal | 293 | ||
| αα) Der Begriff des Geleits | 293 | ||
| ββ) Die historische Bedeutung des Geleits | 293 | ||
| γγ) Die tradierte Gestalt des Geleits und die Geleitseinkünfte | 294 | ||
| ε) Das Zollregal | 295 | ||
| αα) Der Inhalt des Zollregals | 295 | ||
| ββ) Die Funktions- und Inhaltsbestimmung der Zölle | 295 | ||
| γγ) Der Rechtsgrund des Zollregals | 297 | ||
| δδ) Die Terminologie, Gliederung und Ausgestaltung der Zölle | 298 | ||
| ζ) Das Postregal | 301 | ||
| αα) Der Umfang des Postwesens und die Arten der Posteinkünfte | 301 | ||
| ββ) Der Umfang, Rechtsgrund und Institutszweck des Postregals | 302 | ||
| γγ) Die Gestaltung der Posttaxen | 304 | ||
| ff) Das Wasserregal | 308 | ||
| α) Der Gegenstand, Rechtsgrund und Inhalt des Wasserregals | 308 | ||
| β) Die Nutzungen und Einkünfte aus dem Wasserregal | 309 | ||
| gg) Das Forstregal | 312 | ||
| α) Die Reduktion der Forstregalität auf die polizeiliche Forstaufsicht und die dominiale Forstnutzung | 312 | ||
| β) Die Forsteinkünfte | 313 | ||
| hh) Das Jagdregal | 314 | ||
| α) Der Inhalt und Rechtsgrund des Jagdregals | 314 | ||
| β) Die Jagdnutzungen und die Einkünfte aus dem Jagdregal | 315 | ||
| kk) Das Handels- und Gewerberegal bzw. das Monopol | 316 | ||
| 3. Die Ausgestaltung der „zufälligen Einkünfte" bzw. der „wesentlichen Regalien" | 318 | ||
| a) Das Gestaltungsprinzip der zufälligen Einkünfte bzw. der wesentlichen Regalien | 319 | ||
| b) Die Gerichtstaxen | 320 | ||
| E. Die Einkunftsgattung der Steuer und die Steuerprinzipien | 326 | ||
| 1. Die Steuer | 327 | ||
| a) Die Bezeichnung „Steuer" | 327 | ||
| b) Der Steuerbegriff | 328 | ||
| aa) Die Steuer als „Beitrag" der Untertanen/Bürger | 329 | ||
| bb) Die Steuer als „Pflichtbeitrag" der Untertanen/Bürger an den Staat. Die Steuer als „Staatsauflage" | 330 | ||
| cc) Die Steuer als Beitrag zum „Staatsaufwand" | 331 | ||
| dd) Die Steuer als Staatskostenbeitrag aus dem Vermögen der Untertanen/Bürger | 332 | ||
| ee) Die Steuer als „unmittelbarer Beitrag zu den allgemeinen Regierungslasten" | 333 | ||
| ff) Die Steuer als „subsidiäres Staatsfinanzmittel" | 334 | ||
| gg) Die Steuer als „gleicher und allgemeiner Beitrag", als „Beitrag vom Ertrag" und als „bestimmter Beitrag nach sicheren Verhältnissen" | 335 | ||
| c) Das Besteuerungsrecht des Staates | 336 | ||
| d) Die Steuerbewilligung | 338 | ||
| e) Die materielle Beschränkung des Besteuerungsrechts | 340 | ||
| f) Die Steuerlegitimation | 342 | ||
| g) Die Gliederung der Steuern | 346 | ||
| h) Das Gebot der Steuervermehrung | 350 | ||
| 2. Die Gestaltungsprinzipien der Einkünfte | 351 | ||
| a) Die Konzeption der Besteuerungsgrundsätze | 351 | ||
| aa) Die staatswissenschaftliche Fundierung der Besteuerungsgrundsätze | 351 | ||
| bb) Die Gliederung der Besteuerungsgrundsätze | 353 | ||
| cc) Die Darstellung und Bedeutung der Besteuerungsgrundsätze | 355 | ||
| b) Die einzelnen Besteuerungsgrundsätze | 356 | ||
| aa) Der Grundsatz der globalen Beschränkung der Steuern auf den notwendigen Staatsbedarf | 356 | ||
| α) Der ursprüngliche staatsrechtliche Inhalt der Notwendigkeitsmaxime | 356 | ||
| β) Die „nationalökonomische" Interpretation der Notwendigkeitsmaxime. Das Gebot der Steuerminimierung | 358 | ||
| γ) Die budgetrechtliche Regel der Veranschlagung der Steuereinnahmen nach den Steuerausgaben | 359 | ||
| bb) Der Grundsatz der individuellen Mäßigkeit | 359 | ||
| cc) Das Verbot „drückender Auflagen" | 361 | ||
| dd) Das Gebot des Substanzschutzes und das Prinzip der Erhaltung der steuerlichen Leistungsfähigkeit der Untertanen/ Bürger | 361 | ||
| ee) Der Grundsatz der Beschränkung der Besteuerung auf einen Teil des Gewinns | 363 | ||
| ff) Die Grundsätze der zureichenden Gesamtsteuereinkünfte und der Ergiebigkeit der Steuern | 365 | ||
| gg) Der Grundsatz der variablen, stetig steigenden Steuereinkünfte | 366 | ||
| hh) Der Grundsatz der Steuergleichheit | 366 | ||
| α) Die Theorie und Praxis der Steuergleichheit | 366 | ||
| β) Die „Allgemeinheit" und „Gleichförmigkeit" als Komponenten der Steuergleichheit | 368 | ||
| γ) Die Begründung der Steuergleichheit | 369 | ||
| δ) Der Inhalt der Gleichheitsmaxime | 370 | ||
| αα) Die Allgemeinheit der Steuern und die Steuerbefreiungen | 371 | ||
| ββ) Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Die Vorteilsmaxime als rechtlicher Steuerverteilungsmaßstab. Proportionale und progressive Besteuerung, steuerfreies Existenzminimum | 372 | ||
| ii) Das Ziel der rechten Steueranknüpfung und die Maxime der Ertrags- bzw. Gewinnbesteuerung | 375 | ||
| α) Die klassisch-kamerale Konzeption der Erwerbssteuern | 376 | ||
| β) Die physiokratische Konzeption der einzigen Bodenertragssteuer | 377 | ||
| γ) Die spätkamerale Konzeption der Gewinn- bzw. Einkommensbesteuerung | 379 | ||
| kk) Der Grundsatz der Sicherheit der Steuereinnahmen | 380 | ||
| ll) Der Grundsatz der Bestimmtheit der Steuern und der Transparenz der staatlichen Einkünfte | 381 | ||
| mm) Der Grundsatz der Bequemlichkeit und Unmerklichkeit der Besteuerung | 381 | ||
| nn) Der Grundsatz der Wohlfeilheit der Besteuerung | 382 | ||
| oo) Die Grundsätze der außerfiskalischen Steuerwirkungen und Steuerzwecke | 383 | ||
| α) Der Grundsatz der Schonung der bürgerlichen Freiheit | 384 | ||
| β) Der Grundsatz der Wirtschaftsfreundlichkeit der Besteuerung | 384 | ||
| γ) Der Grundsatz der Verfolgung „policeylicher" Zwecke. Das Prinzip der Wirtschaftsförderung | 385 | ||
| δ) Die Lehre von den Steuern als reinem Fiskalmittel. Das Gebot der Wirtschaftsneutralität der Steuern | 389 | ||
| pp) Das Gebot der Steuereinrichtung nach dem Zustand des Landes | 391 | ||
| qq) Der Grundsatz der „freiwilligen Steuerentrichtung" | 391 | ||
| rr) Das Gebot der „Nützlichkeit" der Steuererhebung | 391 | ||
| ss) Der Grundsatz der Vermögensgeheimhaltung und des Steuergeheimnisses | 392 | ||
| tt) Der Grundsatz der harmonisch abgestimmten Steuervielfalt und das Ideal der Alleinsteuer | 393 | ||
| F. Die außerordentlichen Einkünfte | 397 | ||
| 1. Der außerordentliche Bedarf als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der außerordentlichen Einkünfte | 397 | ||
| 2. Die einzelnen außerordentlichen Einkünfte | 398 | ||
| Schlußbetrachtung | 400 | ||
| Quellen- und Literaturverzeichnis | 405 |
