Das Unrecht der versuchten Tat
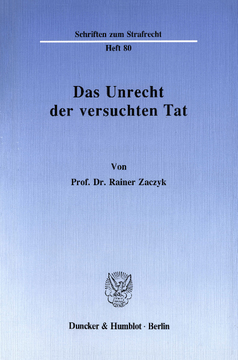
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Das Unrecht der versuchten Tat
Schriften zum Strafrecht, Vol. 80
(1989)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| Teil 1: Kritische Aufnahme des Diskussionsstandes | 20 | ||
| A. Vermittelnde Lösungen der Gegenwart | 20 | ||
| I. Einleitende Bemerkungen | 20 | ||
| II. Die sogenannte Eindruckstheorie | 21 | ||
| 1. Die Bestimmung der heute h. L. | 21 | ||
| 2. Die Begründung der Eindruckstheorie durch v. Gemmingen | 24 | ||
| a) Darstellung | 24 | ||
| b) Kritik | 25 | ||
| III. Vermittelnde Lehren zum Unrecht | 28 | ||
| 1. Bestimmung des Unrechts nach den Strafzwecken | 29 | ||
| 2. Der systemtheoretische Ansatz | 31 | ||
| a) Seine Einbeziehung durch Jakobs | 32 | ||
| b) Jakobs’ neuere Konzeption | 34 | ||
| IV. Die „Ausweitung“ der Unrechtslehre (Kratzsch) | 36 | ||
| 1. Darstellung dieser Lehre | 36 | ||
| 2. Kritik | 39 | ||
| V. Zusammenfassung | 41 | ||
| B. Objektive Lehren zu Versuch und Vollendung | 41 | ||
| I. Die objektive Versuchstheorie | 41 | ||
| 1. Ihre Begründung durch Feuerbach | 41 | ||
| 2. Die Fortbestimmung des Gefahrbegriffs durch Mittermaier und v. Liszt; Kritik an diesem Kriterium | 43 | ||
| 3. Andere Gestaltungen einer objektiven Versuchstheorie | 52 | ||
| a) Die Lehre von der teilweisen Verwirklichung des Unrechts | 52 | ||
| b) Die Lehre vom Mangel am Tatbestand | 53 | ||
| 4. Der Übergang zum nächsten Abschnitt; die rechtsstaatliche Bedeutung der objektiven Unrechtsbestimmung | 54 | ||
| II. Objektive Unrechtslehren | 55 | ||
| 1. v. Liszt | 55 | ||
| 2. Mezger | 59 | ||
| 3. Der Beitrag der Wertlehren | 61 | ||
| a) Der methodologische Ansatz bei Rickert | 62 | ||
| b) Rickerts „System der Philosophie“ und die Wertlehren Schelers und Hartmanns | 63 | ||
| 4. Die Lehre Bindings | 69 | ||
| a) Generelle Bestimmung seines Standpunkts für das Thema dieser Arbeit | 69 | ||
| b) Darstellung und Kritik seiner Lehre | 70 | ||
| C. Subjektive Lehren | 75 | ||
| I. Die subjektive Versuchstheorie und verwandte Lehren | 76 | ||
| 1. Die ältere subjektive Lehre | 76 | ||
| a) Überblick | 76 | ||
| b) v. Buris Versuchstheorie | 78 | ||
| c) Die subjektive Versuchstheorie in der Rechtsprechung und der Umkehrschluß aus § 59 a. F. | 79 | ||
| d) Die subjektive Versuchstheorie und das geltende Recht | 81 | ||
| 2. Abwandlungen der subjektiven Versuchstheorie | 82 | ||
| a) Die Lehre von der Tätergefahr | 82 | ||
| b) Die sog. „Plantheorie“ | 82 | ||
| II. Subjektive Unrechtslehren | 85 | ||
| 1. Einleitende Bemerkungen | 85 | ||
| 2. Die Imperativentheorie | 86 | ||
| 3. Unrecht als Aktunwert | 94 | ||
| a) Einleitende Bemerkungen | 94 | ||
| b) Subjekt und Tat bei Welzel | 95 | ||
| c) Subjekt und Recht bei Welzel und Armin Kaufmann | 98 | ||
| d) Konsequenzen für den Versuch | 104 | ||
| 4. Personale Unrechtslehren | 105 | ||
| a) Überblick | 105 | ||
| b) Unrecht als Pflichtverletzung; die Lehre in den 30er Jahren | 106 | ||
| c) Die Unrechtslehre Maihofers | 108 | ||
| (1) Darstellung | 108 | ||
| (2) Kritik | 110 | ||
| d) Weiterentwicklung der personalen Unrechtslehre | 112 | ||
| (1) Lampe | 112 | ||
| (2) Otto (in Anlehnung an Hardwig) | 117 | ||
| (3) Die dort noch offenen Probleme; Hinweise auf die Lösung durch Arbeiten E. A. Wolffs und Michael Köhlers | 118 | ||
| D. Bestimmung des Unrechts durch die Lehre vom Rechtsgut | 119 | ||
| I. Die Bedeutung der Rechtsgutslehre | 119 | ||
| II. Ihre gedankliche Entwicklung | 120 | ||
| 1. Die Anfänge bei Feuerbach | 120 | ||
| 2. Die Fortführung durch Birnbaum | 121 | ||
| 3. Der Zusammenhang zwischen geistesgeschichtlicher Entwicklung und Rechtsgutslehre | 122 | ||
| 4. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert | 123 | ||
| 5. Rechtsgut und Subjektivität | 124 | ||
| Teil 2: Begründung des Unrechts des Versuchs | 126 | ||
| A. Überblick | 126 | ||
| B. Die Konstitution rechtlicher Freiheit | 128 | ||
| I. Einleitung | 128 | ||
| II. Die Autonomie der Person und das Rechtsverhältnis (rechtsphilosophische Grundlegung) | 130 | ||
| 1. Kant | 130 | ||
| a) Aufweis der Freiheit in der „Kritik der reinen Vernunft“ | 130 | ||
| b) Positive Bestimmung der Freiheit in der „Kritik der praktischen Vernunft“ | 136 | ||
| c) Kritische Positionen gegen Kant (exemplarisch) | 142 | ||
| (1) Adorno | 142 | ||
| (2) Hegel | 143 | ||
| d) Die Erscheinung der Freiheit im Recht | 146 | ||
| 2. Fichte | 154 | ||
| a) Fichtes Ansatz des Problems | 154 | ||
| b) Entfaltung des Ansatzes in der „Grundlage des Naturrechts“ | 157 | ||
| c) Der Ertrag von Fichtes Lehre | 162 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 165 | ||
| III. Erste Konkretisierung des Rechtsverhältnisses | 165 | ||
| 1. Einleitende Bestimmungen | 165 | ||
| 2. Grundsachverhalte des Rechtsverhältnisses: Leben | 166 | ||
| 3. Körper | 167 | ||
| 4. Freiheit und Eigentum | 168 | ||
| 5. Bedeutung dieser Bestimmungen für den Gang der Arbeit | 169 | ||
| IV. Zweite Konkretisierung des Rechtsverhältnisses | 170 | ||
| 1. Auflösung des engeren Interpersonalverhältnisses | 170 | ||
| 2. Gesellschaftliche Konstitution von Rechtsgütern | 172 | ||
| a) Kennzeichnung der Konstitution | 172 | ||
| b) Beispiele | 173 | ||
| aa) „Umwelt“ | 173 | ||
| bb) Vertrauen des Rechtsverkehrs in Urkunden | 174 | ||
| cc) Tatsachenermittlung vor Gericht | 175 | ||
| c) Die praktische Leistung der Konstituenten | 176 | ||
| 3. Exkurs: Rechtsgüter als zeitlich bedingte Elemente | 178 | ||
| 4. Ergebnis | 180 | ||
| V. Der Staat und die gesetzliche Konstitution der Freiheit | 181 | ||
| 1. Die Notwendigkeit der Dimension des Staats | 181 | ||
| a) Der Ansatz beim Rechtsverhältnis | 181 | ||
| b) Abweisung des Begriffs „Not- und Verstandesstaat“ bei Hegel | 182 | ||
| c) Staat und Einzelner: der Staatsvertrag | 183 | ||
| 2. Nähere Konkretisierung des Staats | 185 | ||
| 3. Rechtsgüter des Staats | 190 | ||
| a) Ihre Kennzeichnung | 190 | ||
| b) Verhältnis der Einzelnen zu ihnen | 191 | ||
| aa) Als „Normalbürger“ | 191 | ||
| bb) Als Amtsträger | 192 | ||
| c) Das Problem der gesetzlichen Festlegung dieser Rechtsgüter | 192 | ||
| VI. Zusammenfassung | 193 | ||
| C. Zur Bestimmung vollendeten Unrechts | 194 | ||
| I. Einleitende Bemerkungen | 194 | ||
| II. Vollendetes Unrecht als Unterdrückung konkreter Freiheit (Rechtsgutsverletzung) | 196 | ||
| 1. Zusammenhang mit den Ausführungen unter B. | 196 | ||
| 2. Verletzung von Daseinselementen der Person und der Gesellschaft | 198 | ||
| 3. Verletzung von Daseinselementen des Staats | 203 | ||
| a) Grundsätzlicher Unterschied zu Verletzungen der Person | 203 | ||
| b) Genauere Bestimmung des Unterschieds | 204 | ||
| c) Bestimmung der Eigenart der Verletzung | 205 | ||
| d) Zusammenfassung | 208 | ||
| 4. Vorsätzliche und fahrlässige Verletzung | 209 | ||
| a) Das Verhältnis des Willens zur Verletzung | 209 | ||
| b) Die willentliche (vorsätzliche) Verletzung | 209 | ||
| c) Die Verletzung aus Unbedachtsamkeit (Fahrlässigkeit); Konsequenzen für den Versuch | 211 | ||
| III. Vollendetes Unrecht als Erfüllung der Merkmale des Tatbestandes | 215 | ||
| 1. Einleitende Bemerkungen | 215 | ||
| 2. Bedeutung des Gesetzeserfordernisses | 215 | ||
| 3. Tatbestandsmerkmale | 217 | ||
| a) Verhältnis zum materiellen Unrecht | 218 | ||
| b) Verhältnis zur Rechtswidrigkeit als systematischem Begriff | 219 | ||
| c) Verhältnis zur Innensicht des Täters | 221 | ||
| 4. Die Distanz zwischen tatbestandlich umschriebenem und materiell vollendetem Unrecht | 222 | ||
| 5. Die Transformation materiellen Unrechts in formelles durch den Gesetzgeber | 226 | ||
| D. Das Unrecht des Versuchs | 229 | ||
| I. Einleitende Bemerkungen | 229 | ||
| II. Prinzipien versuchten Unrechts (Erklärung der Möglichkeit des Versuchs) | 231 | ||
| 1. Versuch als Übergang eines Konstituenten des Rechtsguts zur Verletzung | 231 | ||
| 2. Generelle Bestimmung des Unrechts des Versuchs bei Rechtsgütern der Person | 232 | ||
| 3. Generelle Bestimmung des Unrechts des Versuchs bei Rechtsgütern der Gesellschaft | 238 | ||
| 4. Generelle Bestimmung des Unrechts des Versuchs bei Rechtsgütern des Staats | 238 | ||
| III. Differenzierte Bestimmung des Unrechts des Versuchs | 241 | ||
| 1. Aufgabe der folgenden Abschnitte: Konkretisierung der Grundsätze | 241 | ||
| 2. Versuch bei Delikten gegen die Person | 241 | ||
| a) Mängel der Handlung | 242 | ||
| aa) Kennzeichnung der Innensicht des Täters; der Tatentschluß | 243 | ||
| bb) Kennzeichnung der Außenperspektive der Handlung | 248 | ||
| (1) Der abergläubische Versuch | 251 | ||
| (2) Das bloße „Wünschen“ eines Erfolgs | 252 | ||
| b) Mängel des Gegenübers (Objektbereichs) der Handlung | 253 | ||
| aa) Einleitende Bemerkungen | 253 | ||
| bb) Differenzierte Behandlung der Objektmängel, insbes. die Grenze zwischen Versuch und Wahndelikt bei sog. normativen Tatbestandsmerkmalen; Beispiele aus der Rechtsprechung | 253 | ||
| c) Mängel des Subjekts | 268 | ||
| 3. Versuch bei Delikten gegen die Gesellschaft | 271 | ||
| a) Mängel der Handlung | 271 | ||
| aa) Die Innenperspektive | 271 | ||
| bb) Die Außenperspektive, insbes. bei „Normativität“ der Handlung | 273 | ||
| b) Mängel des Gegenübers (Objektbereichs) der Handlung | 279 | ||
| aa) Verhältnis zu Mängeln der Handlung bei diesen Delikten | 279 | ||
| bb) Erörterung von Beispielen | 281 | ||
| (1) § 154 | 281 | ||
| (2) § 267 | 284 | ||
| c) Mängel des Subjekts | 285 | ||
| 4. Versuch bei Delikten gegen den Staat | 285 | ||
| a) Unterschied zu den anderen Delikten | 285 | ||
| b) Mängel der Handlung | 286 | ||
| aa) Die Innenperspektive | 286 | ||
| bb) Die Außenperspektive | 287 | ||
| (1) Fehler des instrumentalen Handlungsvollzugs | 287 | ||
| (2) „Normativität“ der Handlung | 287 | ||
| (3) Besonderheit bei Amtsdelikten | 290 | ||
| c) Mängel des Gegenübers (Objektbereichs) der Handlung | 291 | ||
| aa) Erörterung an Beispielsfällen | 291 | ||
| (1) Fall zu § 108 | 291 | ||
| (2) Versuch bei § 370 AO | 292 | ||
| (3) Versuch bei § 258 | 294 | ||
| bb) Differenzierung bei Amtsdelikten | 295 | ||
| (1) § 258 a | 295 | ||
| (2) §§ 331 ff. | 296 | ||
| (2.1) Irrtümliche Annahmen des Extraneus | 297 | ||
| (2.2) Irrtümliche Annahmen des Amtsträgers | 298 | ||
| d) Mängel des Subjekts | 298 | ||
| IV. Das unmittelbare Ansetzen zur Tat | 299 | ||
| 1. Zusammenhang des „unmittelbar Ansetzens“ mit der Bestimmung des Unrechts des Versuchs | 299 | ||
| 2. Zur Auslegung des § 22 | 302 | ||
| a) Kriterien für „vortatbestandliches“ Unrecht und die Formeln zu § 22 | 302 | ||
| b) Einzelbetrachtung der Formeln | 304 | ||
| aa) Formeln, die sich am Tatbestand orientieren | 304 | ||
| bb) Formeln, die sich am materiellen Unrecht orientieren | 305 | ||
| cc) Die Formel von der Gefährdung des Rechtsguts | 306 | ||
| 3. Aus der hier vorgetragenen Lehre resultierende Bestimmung des „unmittelbar Ansetzens“ | 308 | ||
| a) Bestimmung des Übergangs freiheitskonstituierender zu freiheitsunterdrückenden Handlungen | 308 | ||
| b) Beispiel aus der Rechtsprechung | 311 | ||
| c) Bedeutung des subjektiven Elements | 312 | ||
| d) Erörterung von Beispielsfällen aus der Rechtsprechung | 313 | ||
| (1) BGH GA 1980, 24 | 313 | ||
| (2) BGHSt 26, 201 | 314 | ||
| (3) OLG Koblenz, NJW 1983, 1625 | 315 | ||
| (4) BayObLG JR 1978, 38 | 316 | ||
| 4. Sonderfälle des „unmittelbar Ansetzens“ | 317 | ||
| a) Versuch des unechten Unterlassungsdelikts | 318 | ||
| b) Versuch bei „Distanzdelikten“ | 320 | ||
| c) Versuch bei konkreten und abstrakten Gefährdungsdelikten sowie selbständig pönalisierten Vorbereitungshandlungen | 322 | ||
| (1) § 315 c | 322 | ||
| (2) § 306 | 323 | ||
| (3) Selbständig pönalisierte Vorbereitungshandlungen | 323 | ||
| Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit | 326 | ||
| Literaturverzeichnis | 331 |
