»Negotiated Rulemaking« in den USA und normvertretende Absprachen in Deutschland
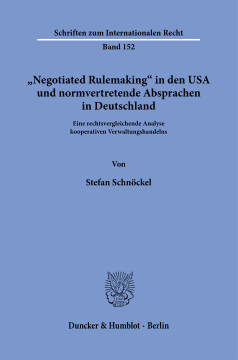
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
»Negotiated Rulemaking« in den USA und normvertretende Absprachen in Deutschland
Eine rechtsvergleichende Analyse kooperativen Verwaltungshandelns
Schriften zum Internationalen Recht, Vol. 152
(2005)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Stefan Schnöckel vergleicht zwei Formen kooperativen Verwaltungshandelns: das amerikanische »Negotiated Rulemaking« und die deutschen normvertretenden Absprachen bzw. Selbstverpflichtungen. Beide Handlungsformen gleichen sich insoweit, als sie darauf gerichtet sind, auf der Grundlage von Verhandlungen generell-abstrakte Problemlösungen hervorzubringen; sie unterscheiden sich vor allem dadurch, dass am Ende des »Negotiated Rulemaking« eine verbindliche staatliche Verordnung steht, wohingegen der Staat bei normvertretenden Absprachen gerade auf die Normsetzung verzichtet.Trotz dieser Unterschiede werfen beide Verfahren ähnliche Probleme auf, weil sie beide auf Defizite des traditionellen Verordnungsgebungsprozesses reagieren. Von diesen Problemen greift Stefan Schnöckel drei auf:- Die Zufriedenheit aller Beteiligten ist offenbar kein gutes Indiz für die sachliche Richtigkeit eines Verhandlungsergebnisses. Erklären lässt sich das am besten unter Rückgriff auf psychologische Erkenntnisse, insbesondere auf die Theorie der kognitiven Dissonanz und den Hawthorne-Effekt.- Am Verhandlungstisch gelingt es gut organisierten Minderheiten häufig, überproportionale Macht auszuüben, da größere Gruppen mit Problemen kollektiven Handelns zu kämpfen haben.- Normvertretende Absprachen regeln vielfach Situationen, die keiner Regelung bedürfen, weil die zugrundeliegenden Gefahren objektiv viel geringer sind, als die Betroffenen subjektiv - etwa aufgrund kognitiver Fehleinschätzungen - annehmen.Vor diesem Hintergrund befürwortet die in Deutschland von Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer und in den USA von Prof. Cass R. Sunstein betreute Arbeit die Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse. Denn wenngleich dieses Instrument auf theoretischer Ebene umstritten sein mag, sind seine konkreten Auswirkungen doch so vielversprechend, dass sein stärkerer Einsatz wünschenswert erscheint.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Danksagung | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Α. Einleitung | 15 | ||
| Β. „Negotiated Rulemaking" in den USA und normvertretende Absprachen in Deutschland: Gründe für ihre Entstehung und Darstellung ihrer rechtlichen Ausformung | 20 | ||
| I. Gründe für die Einführung des „Negotiated Rulemaking" in den USA | 20 | ||
| 1. Mängel des traditionellen amerikanischen Verordnungsgebungsverfahrens | 20 | ||
| 2. Mit dem neuen Verhandlungsverfahren verbundene Hoffnungen | 22 | ||
| II. Der „Negotiated Rulemaking Act" | 24 | ||
| III. Die Auswirkungen des „Negotiated Rulemaking Act" | 27 | ||
| 1. Verkürzt das „Negotiated Rulemaking" Verordnungsgebungsverfahren und hilft es, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden? | 28 | ||
| 2. Die Bewertung des „Negotiated Rulemaking" durch die Wirtschaftsverbände | 31 | ||
| 3. Spieltheoretische Überlegungen | 32 | ||
| IV. Vergleichbarkeit von amerikanischem „Negotiated Rulemaking" und deutschen normvertretenden Absprachen | 33 | ||
| V. Gründe für normvertretende Absprachen in Deutschland | 35 | ||
| 1. Vorzüge von Absprachen | 36 | ||
| 2. Schattenseiten der Absprachen | 38 | ||
| 3. Absprachen beim Gesetzesvollzug | 40 | ||
| VI. Die rechtliche Bewertung der normvertretenden Absprachen | 41 | ||
| 1. Bindungswirkung | 41 | ||
| 2. Schadensersatzansprüche bei Verstoß gegen Absprachen? | 44 | ||
| a) Amtshaftung | 44 | ||
| b) Verschulden bei Vertragsverhandlungen | 46 | ||
| c) Umdeutung | 47 | ||
| 3. Normvertretende Absprachen und das Wettbewerbsrecht | 48 | ||
| a) Grundsätzliche Überlegungen zur Vereinbarkeit von Absprachen und Wettbewerbsrecht | 49 | ||
| b) Die rechtswissenschaftliche Diskussion dieses Themas | 51 | ||
| c) Die Frage nach der Zuordnung der Absprachen zum öffentlichen Recht bzw. zum Privatrecht | 53 | ||
| 4. Der staatliche Mitwirkungsakt | 56 | ||
| a) Ermächtigungsgrundlage | 58 | ||
| (1) Erfordernis einer Ermächtigungsgrundlage im Verhältnis zu den an der Absprache Beteiligten | 58 | ||
| (2) Erfordernis einer Ermächtigungsgrundlage im Verhältnis zu Dritten | 62 | ||
| b) Zuständigkeit | 64 | ||
| c) Verfahrensanforderungen | 66 | ||
| (1) Anwendbarkeit der Geschäftsordnungen der Bundesregierung und der Bundesministerien auf Absprachen | 66 | ||
| (2) Erforderlichkeit der Zustimmung des Bundesrats | 67 | ||
| (3) Entsprechende Anwendung sonstiger Beteiligungsvorschriften? | 68 | ||
| d) Veröffentlichung des Absprachewortlauts | 70 | ||
| e) Gesetzgebungspflichten | 72 | ||
| f) Zwecktauglichkeit | 72 | ||
| 5. Zwischenergebnis zum deutschen Recht | 73 | ||
| VII. Vorläufiger Vergleich des amerikanischen „Negotiated Rulemaking" mit den deutschen normvertretenden Absprachen | 74 | ||
| C. Die abfallwirtschaftliche Absprache aus dem Jahr 1977 als Beispiel für normvertretende Absprachen in Deutschland - Zugleich eine Einführung in die ökonomische Analyse der Regulierung umweltverschmutzenden Verhaltens | 75 | ||
| I. Zustandekommen und Inhalt der abfallwirtschaftlichen Absprache | 76 | ||
| II. Von der Absprache zu lösende Probleme | 79 | ||
| 1. Probleme aufgrund der Produktion und Entsorgung von Einwegbehältnissen | 79 | ||
| 2. Externe Effekte und Marktversagen | 80 | ||
| 3. Maßstäbe für die Beurteilung verschiedener Regelungsinstrumente | 83 | ||
| III. Tauglichkeit privatrechtlichen Vorgehens | 84 | ||
| IV. Brauchbarkeit öffentlich-rechtlicher Instrumente | 86 | ||
| 1. Informationspflichten | 86 | ||
| 2. Verbot der nicht ordnungsgemäßen Entsorgung von Einwegbehältern | 87 | ||
| 3. Verbot der Produktion bzw. des Inverkehrbringens von Einwegbehältern | 88 | ||
| 4. Abgaben | 90 | ||
| a) Vorzüge von Abgaben | 90 | ||
| b) Bedenken | 93 | ||
| 5. Dosenpfand | 96 | ||
| a) Nutzen des Dosenpfands | 97 | ||
| b) Einwände | 98 | ||
| V. Bewertung der abfallrechtlichen Absprache | 100 | ||
| D. Die Interessenvertretung im amerikanischen „Negotiated Rulemaking", insb. die Frage nach dem Nutzen der Beteiligung von Umweltverbänden | 104 | ||
| I. Einleitung | 104 | ||
| II. Beispiele für „Negotiated Rules" | 106 | ||
| 1. Die Koksofenverordnung („Coke Oven Emissions Rule") | 107 | ||
| a) Die Missachtung des Vorrangs des Gesetzes durch die Koksofenverordnung und ihr Beitrag zur Beibehaltung alter Technologien | 107 | ||
| b) Zu enge Definition des Begriffs „Neue Anlage" („New Source") | 110 | ||
| c) Zu frühe Überprüfung der Grenzwerte | 111 | ||
| d) Ergebnis | 111 | ||
| 2. Die Holzmöbelverordnung („Standards for Hazardous Air Pollutant Emissions from Wood Furniture Manufacturing Operations") | 113 | ||
| a) Verletzung von CAA § 112 (d) durch zu großzügige Grenzwerte für bereits bestehende Anlagen und durch die Weigerung, Unterkategorien festzulegen | 114 | ||
| b) Verletzung von CAA § 112 (d)(3) durch die Grenzwerte für neue Anlagen | 117 | ||
| c) Ergebnis | 118 | ||
| 3. Die Holzofen Verordnung („Woodstoves Rule") | 118 | ||
| a) Zu kleiner Anwendungsbereich der Verordnung aufgrund zu enger Definition des Begriffs der Veränderung („Modification") | 119 | ||
| b) Verletzung des Clean Air Act (CAA § 111 (a)( 1 )) durch unterschiedliche Anforderungen an Holzöfen mit und ohne Katalysatoren | 120 | ||
| c) Rechtswidrige Begünstigung kleiner Hersteller | 123 | ||
| d) Verschiedenes | 124 | ||
| 4. Ergebnis | 124 | ||
| III. Warum sind Teilnehmer an Verhandlungskomitees mit Verordnungen zufrieden, die den von ihnen vertretenen Interessen zuwiderlaufen? | 125 | ||
| 1. Empirische Untersuchungen | 126 | ||
| 2. Überraschende Ergebnisse der empirischen Untersuchungen | 129 | ||
| 3. Die Theorie der kognitiven Dissonanz | 131 | ||
| a) Beschreibung | 131 | ||
| b) Anwendung der Theorie der kognitiven Dissonanz auf das „Negotiated Rulemaking" | 134 | ||
| c) Empirische Untersuchung zum Einfluss der Initiation auf die Wertschätzung einer Gruppe | 135 | ||
| d) Übertragung der Ergebnisse des Initiationsexperiments auf das „Negotiated Rulemaking" | 137 | ||
| e) Kognitive Dissonanz und die deutschen normvertretenden Absprachen | 140 | ||
| 4. Der Hawthorne-Effekt | 141 | ||
| IV. Vergleich zwischen „Negotiated Rulemaking" und traditionellem „Notice-and- Comment Rulemaking" | 145 | ||
| 1. Das traditionelle amerikanische Verordnungsgebungsverfahren | 146 | ||
| 2. Einordnung des neuen „Negotiated Rulemaking" in das herkömmliche, auf Ausgewogenheit bedachte System | 147 | ||
| V. Übertragung der Ergebnisse dieses Abschnitts auf das deutsche Recht und auf die Frage nach erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten für Umweltverbände | 150 | ||
| E. Verfahrensbeteiligung und Probleme kollektiven Handelns | 152 | ||
| I. Beispiele | 154 | ||
| 1. „Grand Canyon Visibility Rule" | 154 | ||
| a) Entstehungsgeschichte und gesetzliche Grundlagen | 154 | ||
| b) Einführung in die ökonomische Bewertung natürlicher Ressourcen | 158 | ||
| c) Ergebnis der Verordnungsverhandlungen | 163 | ||
| d) Gründe für das Erreichen eines Kompromisses in den Verhandlungen | 165 | ||
| e) Besonderheiten der Vereinbarung | 166 | ||
| (1) Das Problem der geringen Sichtweiten | 166 | ||
| (2) Die Zusammensetzung des Kreises der Verhandlungsteilnehmer | 168 | ||
| 2. Holzofenverordnung („Woodstoves Rule") | 172 | ||
| II. Unterschiede zwischen parlamentarischer Gesetzgebung und kooperativer Verordnungsgebung | 173 | ||
| 1. Pluralismus | 174 | ||
| 2. Von Interessengruppen vertretene Interessen | 179 | ||
| 3. Soziale Stellung der typischen Verbandsmitglieder | 182 | ||
| 4. Bei der Organisation von Gruppen auftretende Probleme kollektiven Handelns | 184 | ||
| a) Kollektivgüter und große Gruppen | 185 | ||
| b) Einwände gegen dieses Erklärungsmodell | 189 | ||
| c) Empirische Untersuchungen zur Bedeutung selektiver Vorteile | 191 | ||
| d) Schwierigkeiten der Verhandlungsteilnahme für Gruppen, die durch selektive Vorteile zusammengehalten werden | 193 | ||
| 5. Zur Möglichkeit des Kongresses, mit Hilfe umfassender Strategieentscheidungen den Einfluss von Interessengruppen zu schwächen | 194 | ||
| 6. Warum der Gesetzgeber Interessen beachtet, die bei der kooperativen Verordnungsgebung vernachlässigt werden | 196 | ||
| a) Empirische Untersuchungen zur Situation in den USA | 196 | ||
| (1) Interesse der amerikanischen Abgeordneten an ihrer Wiederwahl | 197 | ||
| (2) Aufmerksame Öffentlichkeit vs. Unaufmerksame Öffentlichkeit | 200 | ||
| b) Übertragbarkeit der für die USA gewonnenen Ergebnisse auf Deutschland | 204 | ||
| c) Anwendung der Erkenntnisse über das Verhalten von Abgeordneten auf die kooperative Verordnungsgebung | 207 | ||
| (1) Allgemeine Bemerkungen | 207 | ||
| (2) Der Clean Air Act als Beleg für die Ausrichtung der Abgeordneten an den Interessen der unaufmerksamen Öffentlichkeit | 210 | ||
| (3) Anwendung auf die „Grand Canyon Visibility Rule" | 212 | ||
| (4) Anwendung auf die Holzofen Verordnung | 214 | ||
| d) Lösungsmöglichkeiten: Publizität und Wahl von Vertretern? | 218 | ||
| III. Ergebnis dieses Abschnitts | 220 | ||
| F. Abschluss von Selbstverpflichtungen in Fällen, in denen der Staat nicht ohne weiteres handeln kann, aber die Öffentlichkeit staatliches Tätigwerden verlangt | 224 | ||
| I. Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber | 225 | ||
| 1. Inhalt | 225 | ||
| 2. Bewertung der Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber | 227 | ||
| a) Abgrenzung geringe Wahrscheinlichkeit/objektive Ungewissheit | 228 | ||
| b) Vernachlässigung von Wahrscheinlichkeiten | 229 | ||
| (1) Experiment zum Nachweis des Zusammenhangs zwischen Gefühlen und Wahrscheinlichkeitsbewertungen | 231 | ||
| (2) „Certainty Effect" und binäre Erklärungsmodelle | 232 | ||
| c) Rivalisierende Rationalitäten? | 234 | ||
| d) Informationsdefizite und einseitige Betrachtungsweisen | 238 | ||
| (1) Allgemeines | 238 | ||
| (2) Asbest in New Yorker Schulen | 239 | ||
| (3) „Negotiated Rulemaking: Asbestos containing materials in schools" | 240 | ||
| e) Weiteres zum Einfluss von Gefühlen auf Risikobewertungen | 242 | ||
| f) Sozialprozesse und ihr Einfluss auf Risikowahrnehmungen | 244 | ||
| g) Warum die Aufklärung der Bevölkerung oft keinen Erfolg verspricht | 245 | ||
| (1) Ergebnis einer Studie zur Wahrnehmung von Risiken aufgrund elektromagnetischer Felder | 245 | ||
| (2) Ergebnisse anderer Studien | 247 | ||
| (3) Anwendung auf den Fall der Mobilfunkbetreiber | 248 | ||
| h) Möglichkeit staatlichen Handelns bei Angst der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern | 250 | ||
| i) Auswirkungen der Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber auf das inter-kommunale Verhältnis | 254 | ||
| j) Auswirkungen der Selbstverpflichtung auf das intra-kommunale Verhältnis | 255 | ||
| II. Selbstverpflichtung der Kinderbekleidungsindustrie | 257 | ||
| 1. Inhalt | 257 | ||
| 2. Verfügbarkeitsheuristik („Availability Heuristic") | 258 | ||
| a) Beschreibung | 258 | ||
| b) Beispiel: „Worst case analysis under ΝΕΡΑ" | 261 | ||
| 3. Anwendung der Erkenntnisse der Verfügbarkeitsheuristik auf die Selbstverpflichtung der Kinderbekleidungsindustrie | 265 | ||
| 4. Ermächtigungsgrundlage für staatliches Handeln zweifelhaft (§ 7 ProdSG) | 266 | ||
| 5. Lösung dieses Problems mit Hilfe des BGB und des ProdHaftG? | 269 | ||
| 6. Warum man sich nicht auf ProdHaftG und BGB verlassen hat | 271 | ||
| 7. Bewertung der Selbstverpflichtung der Kinderbekleidungsindustrie | 273 | ||
| III. Ergebnis zu den Selbstverpflichtungen der Kinderbekleidungshersteller und der Mobilfunkbetreiber | 276 | ||
| G. Schlussbetrachtung | 278 | ||
| I. „Negotiated Rulemaking" in Deutschland? | 278 | ||
| II. Probleme, die sowohl „Negotiated Rulemakings" und normvertretende Absprachen als auch den parlamentarischen Gesetzgeber betreffen | 283 | ||
| III. Probleme, die nur „Negotiated Rulemaking" und normvertretenden Absprachen eigen sind | 284 | ||
| IV. Kosten-Nutzen-Analyse | 287 | ||
| 1. Verwendung der Kosten-Nutzen-Analyse in Deutschland | 287 | ||
| 2. Kosten-Nutzen-Analyse in den USA | 289 | ||
| 3. Kritik an der Kosten-Nutzen-Analyse | 290 | ||
| 4. Vorteile der Kosten-Nutzen-Analyse | 294 | ||
| 5. Weitere Einwände gegen die Kosten-Nutzen-Analyse | 298 | ||
| 6. Ergebnis | 302 | ||
| H. Zusammenfassung | 303 | ||
| English Summary (Englische Zusammenfassung) | 316 | ||
| Anhang: Negotiated Rulemaking Act | 319 | ||
| Literaturverzeichnis | 325 | ||
| Personen-und Sachregister | 340 |
