Der Untreueschutz der Vor-GmbH vor einverständlichen Schädigungen
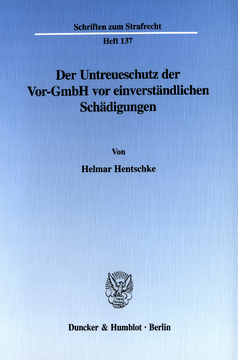
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Untreueschutz der Vor-GmbH vor einverständlichen Schädigungen
Schriften zum Strafrecht, Vol. 137
(2002)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 21 | ||
| Einführung | 27 | ||
| I. Die Problematik | 27 | ||
| 1. Bedeutung und Entwicklung der Vor-GmbH | 28 | ||
| 2. Strafrechtliche Relevanz der Insolvenz der Vor-GmbH | 29 | ||
| 3. Relevante Fallgestaltungen | 30 | ||
| 4. Der bisherige Meinungsstand zum Schutz der Vorgesellschaft durch § 266 StGB vor einverständlichen Schädigungen | 32 | ||
| a) Herrschende Meinung | 32 | ||
| aa) Rechtsprechung | 32 | ||
| bb) Herrschende Lehre | 34 | ||
| b) Anwendung des § 266 StGB auf die Vor-GmbH durch die Gegenauffassung in der Literatur | 36 | ||
| II. Gang der Untersuchung | 37 | ||
| Teil 1: Notwendigkeit der Anwendung des § 266 StGB auf die Vor-GmbH | 38 | ||
| § 1 Unzureichende zivilrechtliche Kompensation von Vermögensverlagerungen bei Insolvenz der Vor-GmbH | 38 | ||
| I. Gründerhaftung | 38 | ||
| 1. Ältere Rechtsprechung | 38 | ||
| 2. Strafrechtliche Konsequenzen aus der mangelnden Kompensation von Vermögensverlagerungen | 43 | ||
| 3. Neuere zivilrechtliche Entwicklung der Gründerhaftung bei der Vorgesellschaft | 44 | ||
| a) Konzeption der gänzlichen Haftungsbeschränkung | 44 | ||
| b) Außenhaftungskonzept | 44 | ||
| c) Innenhaftungskonzept | 46 | ||
| aa) Entwicklung in Rechtsprechung und Literatur | 46 | ||
| bb) Fehlende hinreichende Kompensation nach dem Innenhaftungskonzept | 48 | ||
| (1) Fehlen gesamtschuldnerischer Haftung | 48 | ||
| (2) Gefährdung der Anspruchsdurchsetzung durch mangelnde Publizität | 50 | ||
| (3) Beweisprobleme bei den vom BGH zugelassenen Ausnahmefällen | 50 | ||
| (4) Langwierigkeit der Rechtsdurchsetzung | 51 | ||
| (5) Verzögerungsrisiko | 52 | ||
| (6) Möglichkeit der Verschleierung von Privatvermögen | 52 | ||
| 4. Strafrechtliche Konsequenzen | 52 | ||
| II. Handelndenhaftung | 53 | ||
| 1. Bedenken gegen die Handelndenhaftung wegen Funktionslosigkeit des § 11 Abs. 2 GmbHG | 54 | ||
| a) Wandel des Verständnisses der Handelndenhaftung | 54 | ||
| b) § 11 Abs. 2 GmbHG und das EG-Recht | 56 | ||
| c) Ausgleichsfunktion der Handelndenhaftung | 57 | ||
| 2. Konzepte zur Abwicklung der Handelndenhaftung | 58 | ||
| a) Unmittelbare Haftung der Gründer gegenüber den Handelnden | 58 | ||
| b) Einlagenhaftung der Gründer gegenüber den Handelnden | 59 | ||
| c) Haftung der Vor-GmbH gegenüber den Handelnden | 60 | ||
| 3. Strafrechtliche Konsequenzen aus der Betrachtung der Handelndenhaftung | 61 | ||
| § 2 Anwendbarkeit der Insolvenzdelikte auf die Vor-GmbH? | 62 | ||
| I. Bankrott, § 283 StGB | 62 | ||
| 1. Sonderdeliktscharakter des § 283 StGB | 62 | ||
| 2. Unanwendbarkeit des § 14 StGB auf die Organe der Vor-GmbH | 64 | ||
| a) § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB | 65 | ||
| b) Unanwendbarkeit des § 14 Abs. 1 Nr. 2 StGB auf die Vor-GmbH | 65 | ||
| aa) Grundsätzliche Anwendbarkeit auf die Insolvenz von Personenhandelsgesellschaften | 65 | ||
| bb) Keine Geltung für den Geschäftsführer der Vor-GmbH | 66 | ||
| cc) Rechtsnatur der Vor-GmbH | 67 | ||
| (1) Vor-GmbH als Gebilde sui generis | 67 | ||
| (2) Möglichkeit der Fremdorganschaft | 69 | ||
| (a) Fremdorganschaft bei der Vor-GmbH | 69 | ||
| (b) Unzulässigkeit der Fremdorganschaft bei Personengesellschaften | 70 | ||
| (aa) Neutralität der gesetzlichen Regelungen | 71 | ||
| (bb) Gesellschafterschutz | 71 | ||
| (cc) Verkehrsschutz | 73 | ||
| (dd) Abspaltungsverbot | 73 | ||
| (ee) Grundsatz der Verbandssouveränität | 74 | ||
| (ff) Gesetzessystematik | 74 | ||
| (gg) Vereinbarkeit mit dem Recht der EWIV? | 75 | ||
| (hh) Zwischenergebnis | 75 | ||
| c) § 14 Abs. 2 StGB | 75 | ||
| 3. Ergebnis | 76 | ||
| II. Verletzung der Insolvenzantragspflicht, § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG | 76 | ||
| 1. Streitstand | 76 | ||
| 2. Stellung des Geschäftsführers der Vor-GmbH | 77 | ||
| 3. Ablehnung der unmittelbaren Anwendung des § 64 Abs. 1 GmbHG auf die Vor-GmbH | 78 | ||
| a) Gesetzeswortlaut | 78 | ||
| b) Sinn und Zweck der Vorschrift | 79 | ||
| c) Systematischer Zusammenhang | 79 | ||
| d) Sicht des historischen Gesetzgebers | 80 | ||
| e) Auslegungsergebnis | 81 | ||
| 4. Anwendung des § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG auf den Geschäftsführer der Vor-GmbH als Verstoß gegen das Analogieverbot | 81 | ||
| a) Tatbestandscharakter des § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG | 82 | ||
| b) Rechtsfindung praeter legem und Analogieverbot | 83 | ||
| III. Vereiteln der Zwangsvollstreckung, § 288 StGB | 83 | ||
| 1. Sanktionierung der Vermögensverlagerungen | 84 | ||
| 2. Sanktionierung der Verschleierung von Privatvermögen | 84 | ||
| a) Gesellschafter als Täter | 84 | ||
| b) Geschäftsführer als Täter | 86 | ||
| IV. Ergebnis des ersten Teils | 86 | ||
| Teil 2: Untreueschutz der eingetragenen GmbH | 89 | ||
| § 3 Verlagerungen aus dem Gesellschaftsvermögen als Problem der Untreue | 89 | ||
| I. Untreuerelevanz der Vermögensverlagerungen | 89 | ||
| II. Unbrauchbarkeit des Begriffs der verdeckten Gewinnausschüttung | 90 | ||
| III. Vermögensbetreuungspflicht des Geschäftsführers | 92 | ||
| IV. Vermögensverlagerungen als Treubruch gemäß § 266 Abs. 1, 2. Alt StGB | 93 | ||
| § 4 Die Vermögensinhaberschaft der GmbH | 94 | ||
| I. Wirtschaftliche Betrachtungsweise | 94 | ||
| II. Bestimmung der Vermögensinhaberschaft nach gesellschaftsrechtlichen Vorgaben | 96 | ||
| § 5 Untreuestrafrechtliche Relevanz der Zustimmung der Gesellschaftergesamtheit | 97 | ||
| I. Stellung der Gesellschaftergesamtheit im Kompetenzgefüge der GmbH | 97 | ||
| II. Zustimmung und Untreuetatbestand | 98 | ||
| 1. Relevanz für das Merkmal der „Pflichtwidrigkeit“ | 99 | ||
| a) Tatbestandsausschließendes Einverständnis und rechtfertigende Einwilligung | 99 | ||
| b) Zustimmung als tatbestandsausschließendes Einverständnis | 101 | ||
| c) Wirksamkeitsvoraussetzungen des Einverständnisses | 101 | ||
| aa) Rechtsgutsinhaberschaft | 102 | ||
| (1) Gesellschafter als Organ des Rechtsgutsinhabers | 102 | ||
| (2) Unbeachtlichkeit von § 228 StGB | 102 | ||
| bb) Keine Kundgabe nach außen erforderlich | 103 | ||
| cc) Beachtlichkeit von Willensmängeln | 104 | ||
| dd) Relevanz der Einsichtsfähigkeit | 104 | ||
| 2. Tatbestandsmerkmal „Nachteil“ | 105 | ||
| III. Reichweite der Dispositionsbefugnis der Gesellschaftergesamtheit | 108 | ||
| 1. Unbeschränktheit der Dispositionsbefugnis? | 108 | ||
| 2. Schranken der Dispositionsbefugnis | 109 | ||
| a) Kapitalerhaltungsvorschrift als Grenze | 109 | ||
| b) Funktion des § 30 Abs. 1 GmbHG | 110 | ||
| aa) Zivilrechtliche Rechtsprechung | 110 | ||
| bb) Zivilrechtliche Literatur | 112 | ||
| cc) Strafrechtliche Rechtsprechung | 114 | ||
| dd) Strafrechtliche Literatur zum Bestandsinteresse | 114 | ||
| ee) Stellungnahme | 115 | ||
| c) Regelungsinhalt des § 30 Abs. 1 GmbHG | 117 | ||
| aa) Begriff des Stammkapitals | 117 | ||
| bb) Voraussetzung für das Eingreifen des Auszahlungsverbots | 119 | ||
| (1) Begriff der Unterbilanz | 119 | ||
| (2) Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 GmbHG bei Überschuldung | 119 | ||
| cc) Feststellen der Unterbilanz | 120 | ||
| (1) Maßgeblicher Zeitpunkt | 120 | ||
| (2) Bilanzierungsgrundsatz | 121 | ||
| (3) Bewertungsgrundsätze | 122 | ||
| (a) Aktivseite | 122 | ||
| (b) Passivseite | 123 | ||
| dd) Feststellen der Überschuldung | 124 | ||
| ee) Verbotene Auszahlungen | 126 | ||
| 3. Ergebnis | 128 | ||
| IV. Weitere Grenzen der Dispositionsbefugnis | 128 | ||
| 1. Existenz- und Liquiditätsgefährdung | 129 | ||
| a) Unbegründbarkeit eines eigenständigen Verbots der Existenz- und Liquiditätsgefährdung | 129 | ||
| b) Berücksichtigung der Existenz- und Liquiditätsgefährdung bei der Bilanzierung | 132 | ||
| 2. Verletzung der Buchführungspflicht | 133 | ||
| 3. Verletzung der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes | 134 | ||
| 4. Sittenwidrigkeit der Gesellschafterbeschlüsse | 135 | ||
| 5. § 32 a GmbHG | 135 | ||
| 6. Unterkapitalisierung | 136 | ||
| 7. Ergebnis | 136 | ||
| § 6 Gesellschafter als Täter der Untreue | 136 | ||
| I. Maßgeblichkeit der Vermögensbetreuungspflicht für die Strafbarkeit der Gesellschafter | 136 | ||
| II. Vermögensbetreuungspflicht der Gesellschafter ohne Geschäftsführungsaufgabenwahrnehmung | 138 | ||
| 1. Verhaltenspflichten aus dem GmbH-Gesetz | 138 | ||
| 2. § 30 Abs. 1 GmbHG | 138 | ||
| 3. Die Treuepflicht gemäß § 242 BGB | 140 | ||
| 4. Die Mitgliedschaft gemäß § 45 GmbHG | 142 | ||
| 5. Tatsächliches Treueverhältnis als Grundlage einer Vermögensbetreuungspflicht | 143 | ||
| 6. Zwischenergebnis | 143 | ||
| III. Vermögensbetreuungspflicht bei Gesellschaftern mit Geschäftsführungsaufgabenwahrnehmung | 143 | ||
| 1. Unterscheidung von Geschäftsführer- und Gesellschafterstellung | 143 | ||
| 2. Begriff des faktischen Organs | 144 | ||
| a) Der Grundsatz | 144 | ||
| b) Besonderheiten des § 266 StGB | 146 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 147 | ||
| IV. Ergebnis des zweiten Teils | 147 | ||
| Teil 3: Anwendbarkeit des § 266 StGB auf einverständliche Schädigungen des Vor-GmbH-Vermögens | 148 | ||
| § 7 Tätereigenschaft des Geschäftsführers und der Gesellschafter der Vor-GmbH | 148 | ||
| I. Geschäftsführer als Täter | 149 | ||
| II. Gesellschafter als Täter | 149 | ||
| § 8 Die Vermögensträgerschaft der Vor-GmbH | 150 | ||
| I. Streitstand | 150 | ||
| 1. Erfordernis der eigenen Rechtspersönlichkeit | 150 | ||
| a) Rechtsprechung | 150 | ||
| b) Literatur | 151 | ||
| 2. Forderung nach einer eigenen Haftungsmasse des Vermögensträgers | 153 | ||
| a) Rechtsprechung | 153 | ||
| b) Literatur | 153 | ||
| 3. Die Auffassung von Nelles zur Vermögenssubjekteigenschaft | 154 | ||
| II. Charakterisierung des Vermögenssubjekts nach dem Wortlaut des § 266 StGB | 155 | ||
| 1. „Fremde Vermögensinteressen“ | 156 | ||
| 2. Trennung von Vermögensträger- und Vermögenssubjekteigenschaft | 156 | ||
| III. Vermögensträgerschaft der Vor-GmbH | 157 | ||
| 1. Untauglichkeit der Zwecksetzungsbefugnis zur Bestimmung des Vermögensträgers | 157 | ||
| a) Geschäftsunfähige oder betreute Menschen | 158 | ||
| b) Insolvenz | 158 | ||
| c) Eingetragene GmbH | 160 | ||
| 2. Bestimmung des Vermögensträgers nach rechtlichen Kriterien | 163 | ||
| 3. Zuordnung von Rechten als Voraussetzung für die Vermögensträgerschaft | 165 | ||
| a) Natürliche und juristische Personen | 165 | ||
| b) Personenmehrheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 165 | ||
| aa) Anerkennung einer Teilrechtsfähigkeit | 165 | ||
| bb) Zuordnung von Rechten durch Anerkennung selbstständiger Rechtsträger | 167 | ||
| cc) Zuordnung von Rechten durch Anerkennung von Personifikationen | 168 | ||
| dd) Verwendung des Begriffs Rechtsträger | 170 | ||
| ee) Konsequenzen für die Anwendbarkeit des § 266 StGB | 171 | ||
| 4. Vor-GmbH als Rechtsträger | 172 | ||
| 5. Ausschluss der Vermögensträgerschaft bei der Gesamthandszuordnung | 173 | ||
| a) Herrschende Meinung | 173 | ||
| aa) Traditionelle Gesamthandslehre | 173 | ||
| bb) Einheitslehre | 175 | ||
| cc) „Auflösungsthese“? | 177 | ||
| b) Aufhebung des Gesamthandsprinzips? | 178 | ||
| aa) Unmöglichkeit der Gleichsetzung mit der juristischen Person | 179 | ||
| (1) Gemeinsamkeiten | 179 | ||
| (a) Existenz mehrerer Haftungsfonds | 179 | ||
| (b) Ähnlichkeit von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 179 | ||
| (c) Treuepflichten | 179 | ||
| (2) Unterschiede | 180 | ||
| (a) Bestandsschutz | 180 | ||
| (b) Unmöglichkeit der Fremdorganschaft | 181 | ||
| (c) Unzulässigkeit der Einmannbeteiligung bei der Personengesellschaft | 181 | ||
| (aa) Entgegenstehendes Gesamthandsverständnis | 181 | ||
| (bb) Entgegenstehende gesetzliche Regelungen | 182 | ||
| (cc) Erbrechtliche Konstruktionen | 184 | ||
| (dd) Rechtslage bei der EWIV | 185 | ||
| (ee) Firmenrecht des HGB | 186 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 186 | ||
| bb) Konsequenzen des UmwG | 186 | ||
| cc) Beibehaltung des Gesamthandsprinzips trotz Anerkennung der Rechts- und Parteifähigkeit der GbR | 189 | ||
| c) Ergebnis | 190 | ||
| 6. Vermögenszuordnung bei Körperschaften ohne Rechtspersönlichkeit | 190 | ||
| a) Organisationsstruktur und Vermögenszuordnung | 190 | ||
| b) Vor-GmbH als Körperschaft | 191 | ||
| aa) Unabhängigkeit vom Mitgliederbestand | 191 | ||
| bb) Möglichkeit der Fremdorganschaft | 192 | ||
| cc) Geltung des Mehrheitsprinzips | 192 | ||
| dd) Eigenständige Vermögenszuordnung | 192 | ||
| c) Ausschluss der Gesamthandsvermögenszuordnung bei Körperschaften nach dem Vielheitsgedanken | 193 | ||
| d) Ablehnung einer gesamthänderischen Vermögenszuordnung bei Körperschaften nach modernem Gesamthandsverständnis | 193 | ||
| aa) Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Organisationsstruktur Personengesellschaft und der Vermögenszuordnung nach dem Gesamthandsprinzip am Beispiel der BGB-Gesellschaft | 194 | ||
| (1) BGB-Gesellschaft als „Urfigur“ der Gesamthand | 194 | ||
| (2) Zwingende Geltung der Gesamthandsvermögenszuordnung bei der Personengesellschaft | 196 | ||
| (3) Konsequenzen der Anerkennung einer Innengesellschaft? | 197 | ||
| bb) Vermögenszuordnung bei Körperschaften am Beispiel des nichtrechtsfähigen Vereins | 199 | ||
| (1) Eingeschränkte Anwendbarkeit des Personengesellschaftsrechts auf den nichtrechtsfähigen Verein | 200 | ||
| (a) Notwendigkeit der Korrektur der gesetzgeberischen Entscheidung | 200 | ||
| (b) Unanwendbarkeit des Personengesellschaftsrechts auf den nichtrechtsfähigen Idealverein | 201 | ||
| (c) Beschränkte Anwendung des Personengesellschaftsrechts auf den wirtschaftlichen nichtrechtsfähigen Verein | 202 | ||
| (aa) Das Problem | 202 | ||
| (bb) Konsequenzen der körperschaftlichen Struktur für die Anwendbarkeit des § 54 Satz 1 BGB | 203 | ||
| (cc) Ablehnung der Rechtsformzwangthese | 204 | ||
| (dd) Geltung des Außenrechts der Personengesellschaft | 206 | ||
| (2) Abgrenzung von Personengesellschaften und Körperschaften unter Berücksichtigung körperschaftlich strukturierter Personengesellschaften | 208 | ||
| (a) Gemeinsamkeiten von körperschaftlich strukturierten Personengesellschaften und Körperschaften | 208 | ||
| (b) Unterschiede zwischen körperschaftlich strukturierten Personengesellschaften und Körperschaften | 209 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 211 | ||
| cc) Identität von unvollendeter, werdender und vollendeter juristischer Person | 211 | ||
| (1) Identitätsverständnis bei der unvollendeten juristischen Person am Beispiel des nichtrechtsfähigen Vereins | 211 | ||
| (2) Werdende juristische Personen | 212 | ||
| e) Mangelnde Erforderlichkeit der Rechtspersönlichkeit | 214 | ||
| f) Ergebnis | 215 | ||
| 7. Unvereinbarkeit der Gesamthandsthese mit der Zulassung von Einmanngründungen | 216 | ||
| a) Vermögenszuordnung bei der Einmann-Vor-GmbH | 217 | ||
| aa) Ablehnung einer Einmann-Gesamthand | 217 | ||
| bb) Unzulänglichkeit der Verfügungsbeschränkungsthese, der Treuhandlösung und der Vermögensinhaberschaft des Gründers | 218 | ||
| cc) Einmann-Vor-GmbH kein Sondervermögen eigener Art | 220 | ||
| b) Anerkennung einer verselbstständigten Einmann-Vor-GmbH | 220 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 222 | ||
| § 9 Die eigenständigen Vermögensinteressen der Vor-GmbH | 222 | ||
| I. Kapitalerhaltungsvorschrift des § 30 Abs. 1 GmbHG als Ausdruck des Vermögensinteresses der Vor-GmbH | 222 | ||
| 1. Inhalt der Vermögensinteressen im Sinne des § 266 StGB | 222 | ||
| a) Definition der Vermögensinteressen | 222 | ||
| b) Bestimmung der Vermögensinteressen durch den Zwecksetzungsbefugten | 224 | ||
| c) Beschränkung der Zwecksetzungsbefugnis durch Gesetz als Ausdruck eigenständiger Vermögensinteressen | 224 | ||
| 2. Anwendbarkeit der Kapitalerhaltungsvorschrift des § 30 Abs. 1 GmbHG auf die Vor-GmbH | 225 | ||
| a) Rechtsanwendung bei der Vorgesellschaft | 226 | ||
| aa) Sonderrechtsformel | 226 | ||
| bb) Rechtsfortbildung bei der Vor-GmbH | 227 | ||
| (1) Methodisches Vorgehen | 227 | ||
| (2) Lückenfeststellung | 229 | ||
| (a) Mögliche Art der Lücke | 229 | ||
| (b) Analogie als Mittel der Lückenfeststellung | 230 | ||
| (c) Charakterisierung der Lücke nach herkömmlicher Einteilung | 230 | ||
| (3) Lückenausfüllung | 231 | ||
| (4) Analogie zu den Vorschriften des GmbH-Gesetzes | 232 | ||
| b) Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 GmbHG im Stadium der Vor-GmbH | 232 | ||
| aa) Ablehnende Auffassung | 232 | ||
| bb) Befürwortende Auffassung | 233 | ||
| (1) Unbrauchbarkeit der Gründungsvorschriften als Kapitalsicherung | 233 | ||
| (2) Bedeutung der Gesellschafterhaftung | 234 | ||
| (3) Kapitalerhaltung als Existenzberechtigung der Vor-GmbH | 235 | ||
| (4) Kapitalerhaltung aus Gründen des mittelbaren Gläubigerschutzes | 235 | ||
| (5) Wertungswiderspruch bei fehlender Kapitalerhaltung | 236 | ||
| (6) Anwendung des § 30 Abs. 1 GmbHG wegen Sicherstellung der Vermögenstrennung | 236 | ||
| (7) Keine Entwertung des Eintragungszeitpunktes | 237 | ||
| cc) Zeitpunkt der Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 GmbHG | 237 | ||
| (1) Anwendbarkeit des § 30 Abs. 1 GmbHG erst ab Anmeldung? | 237 | ||
| (2) Anwendung des § 30 Abs. 1 GmbHG schon mit Errichtung der Gesellschaft | 237 | ||
| II. Zulässigkeit der analogen Anwendung des § 30 Abs. 1 GmbHG im Strafrecht | 239 | ||
| 1. Inhalt des Analogieverbots | 240 | ||
| a) Abgrenzung von Auslegung und Analogie | 240 | ||
| b) Normtheoretische und verfassungsrechtliche Grundlagen des strafrechtlichen Analogieverbots | 242 | ||
| c) Folgerungen für die Anwendung des § 30 Abs. 1 GmbHG auf die Vorgesellschaft | 244 | ||
| 2. Begriff und Reichweite des Garantietatbestandes | 245 | ||
| a) Berücksichtigung formal außerstrafrechtlicher Regelungen im Strafrecht | 245 | ||
| b) Bestimmung des Strafgesetzbegriffs | 246 | ||
| aa) Übertragung des in § 2 Abs. 3 StGB verwendeten Strafgesetzbegriffs | 247 | ||
| (1) Verfassungsrang des Milderungsgebots in § 2 Abs. 3 StGB | 248 | ||
| (2) Identität der in Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB und § 2 Abs. 3 StGB verwendeten Gesetzesbegriffe | 249 | ||
| (a) Gesetzessystematik | 249 | ||
| (b) Wechselseitige Abhängigkeit des Bestimmtheitsgebots und des Rückwirkungsverbots / Milderungsgebots | 250 | ||
| (c) Nichtberücksichtigung von Gewohnheitsrecht | 250 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 254 | ||
| bb) Inhalt des Strafgesetzbegriffs | 254 | ||
| (1) Formeller Strafgesetzbegriff | 254 | ||
| (2) Rechtsgutstheoretischer Strafgesetzbegriff | 255 | ||
| (3) Normtheoretischer Strafgesetzbegriff | 255 | ||
| (4) Materieller Strafgesetzbegriff | 256 | ||
| (5) Stellungnahme | 256 | ||
| cc) Materieller Strafgesetzbegriff und Reichweite des Analogieverbots | 257 | ||
| (1) Anwendung des Analogieverbots bei Blankettstrafgesetzen | 257 | ||
| (a) Begriff des Blankettstrafgesetzes | 257 | ||
| (b) Bedeutung der Blankettstrafgesetze | 258 | ||
| (c) Ausfüllungsnorm als Bestandteil des Strafgesetzes | 258 | ||
| (2) Analogieverbot bei normativen Tatbestandsmerkmalen | 260 | ||
| (a) Begriff des normativen Tatbestandsmerkmals | 261 | ||
| (b) Reichweite des Analogieverbots bei normativen Tatbestandsmerkmalen | 263 | ||
| (c) Abgrenzung von Blankettstrafgesetzen und normativen Tatbestandsmerkmalen | 267 | ||
| (3) Anwendung des Analogieverbots bei Fällen indirekter Akzessorietät | 269 | ||
| (a) Begriffsklärung | 269 | ||
| (b) Reichweite des Analogieverbots bei der indirekten Akzessorietät | 269 | ||
| 3. Zulässige analoge Anwendung des § 30 Abs. 1 GmbHG im Rahmen des § 266 StGB | 270 | ||
| a) Tatbestandsstruktur des § 266 StGB | 270 | ||
| aa) Ausschluss des Blankettcharakters | 270 | ||
| bb) „Pflichtwidrigkeit“ und „Nachteil“ als normative Tatbestandsmerkmale | 271 | ||
| (1) Bindung des Einverständnisses an Merkmale des Tatbestandes | 271 | ||
| (2) „Pflichtwidrigkeit“ als normatives Tatbestandsmerkmal | 272 | ||
| (3) „Nachteil“ als normatives Tatbestandsmerkmal | 274 | ||
| b) Ergebnis | 274 | ||
| § 10 Untreueschutz der Einmann-Vor-GmbH und der unechten Vor-GmbH | 274 | ||
| I. Vermögenssubjekt Einmann-Vor-GmbH | 275 | ||
| II. Vermögenssubjekteigenschaft der unechten Vor-GmbH? | 275 | ||
| 1. Kriterien für die unechte Vor-GmbH | 275 | ||
| a) Aufnahme uneingeschränkter Geschäftstätigkeit | 275 | ||
| b) Fehlende Ernsthaftigkeit des Betreibens der Eintragung | 276 | ||
| 2. Ablehnung der Lehre von der unechten Vor-GmbH | 277 | ||
| 3. Verhinderung des Dauerzustandes der Vor-GmbH durch Umwandlung zur OHG | 277 | ||
| 4. Ablauf der Umwandlung | 278 | ||
| 5. Konsequenzen für die Anwendung des § 266 StGB | 279 | ||
| III. Ergebnis des dritten Teils | 279 | ||
| Zusammenfassung | 281 | ||
| Literaturverzeichnis | 283 | ||
| Sachwortregister | 317 |
