Grundrechtskonkurrenzen
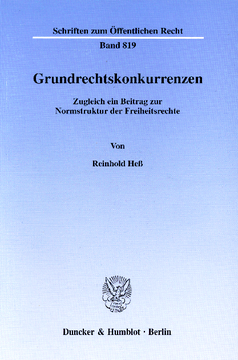
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Grundrechtskonkurrenzen
Zugleich ein Beitrag zur Normstruktur der Freiheitsrechte
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 819
(2000)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 12 | ||
| Α. Einführung | 15 | ||
| Β. Die Konkurrenz von Rechtsnormen aus methodischer Sicht | 17 | ||
| I. Einleitung | 17 | ||
| II. Systematische Einordnung der Normkonkurrenz | 18 | ||
| 1. Begriffsbestimmung „Rechtsnorm" | 18 | ||
| 2. Anwendbarkeit einer Rechtsnorm | 19 | ||
| 3. Normkollisionen | 20 | ||
| a) Kollision von Normen unterschiedlicher Rangstufen | 21 | ||
| b) Kollision gleichrangiger Normen unterschiedlichen Alters | 25 | ||
| 4. Normkonkurrenzen | 26 | ||
| a) Entstehung von Normkonkurrenzen | 26 | ||
| b) Folgen einer Normkonkurrenz | 27 | ||
| III. Methodische Behandlung von Konkurrenzsituationen | 28 | ||
| 1. Nichtauflösungsbedürftige Konkurrenzen | 28 | ||
| a) Kumulative Konkurrenz | 28 | ||
| b) Alternative Konkurrenz? | 29 | ||
| 2. Auflösungsbedürftige Konkurrenzen | 31 | ||
| a) Gründe für die Auflösung von Normkonkurrenzen | 31 | ||
| aa) Der Satz von der Widerspruchslosigkeit der Rechtsordnung | 31 | ||
| bb) Spezifische Auflösungsgründe | 33 | ||
| cc) Weitere, normlogische Auflösungsgründe? | 34 | ||
| (1) Spezialitätsbegriff - normlogische Spezialität | 34 | ||
| (2) Keine Verdrängung kraft Normlogik | 36 | ||
| b) Verfahren der Konkurrenzauflösung | 39 | ||
| aa) Konkurrenzauflösung durch Gesetz | 39 | ||
| bb) Konkurrenzauflösung durch Auslegung | 40 | ||
| 3. Folgen für die anwendbaren Normen bei Auflösung und Nichtauflösung der Konkurrenz | 43 | ||
| a) Ausnahme vom Grundsatz der vollständigen Verdrängung der allgemeinen Norm | 43 | ||
| b) Wechselseitige Beeinflussung der konkurrierenden Normen bei kumulativer Anwendung | 44 | ||
| C. Grundrechtskonkurrenzen - Einführung, Begriffsbestimmung, Analyse der Lösungsvorschläge | 48 | ||
| I. Einleitung | 48 | ||
| II. Begriffsbestimmung | 49 | ||
| III. Abgrenzung zu den sog. „Scheinkonkurrenzen" | 51 | ||
| 1. Sachverhaltszerlegung | 52 | ||
| a) Handlungsmehrheiten | 53 | ||
| b) Differenzierung nach Eingriffen | 54 | ||
| 2. Tatbestandsabgrenzung | 55 | ||
| IV. Darstellung und Kritik der Lösungsvorschläge zur Behandlung von Grundrechtskonkurrenzen | 57 | ||
| 1. Einleitung | 57 | ||
| 2. Normverdrängende Lösung | 58 | ||
| a) Tatbestandsorientierte Verdrängung | 59 | ||
| aa) Normlogische Spezialität | 59 | ||
| bb) Normative Spezialität | 62 | ||
| cc) Sonderproblem personeller Schutzbereich | 64 | ||
| b) Eingriffsorientierte Verdrängung | 65 | ||
| 3. Normkumulierende Lösungen | 68 | ||
| a) Theorie der rechtsfolgenverdrängenden Idealkonkurrenz | 68 | ||
| b) Schrankenübertragungstheorien | 72 | ||
| aa) Herrschaft des Grundrechts mit Begrenzungsregelung | 74 | ||
| bb) Herrschaft des Grundrechts ohne Begrenzungsregelung | 75 | ||
| cc) Vermittelnde Lösungen | 77 | ||
| dd) Kritik der Schrankenübertragungsthese | 78 | ||
| 4. Normkombinierende Lösungen - Grundrechtsverbund | 82 | ||
| a) Generelle Verbundlösung | 82 | ||
| b) Partielle Verbundlösungen | 84 | ||
| aa) Kombinationsgrundrechte | 84 | ||
| bb) Begrenzungskombination | 86 | ||
| cc) Schrankenverbund | 88 | ||
| c) Theorie der funktionellen Geltungseinheit | 89 | ||
| 5. Gestufte Konkurrenzlösung unter Anwendung unterschiedlicher Modelle | 91 | ||
| D. Grundlagen der Konkurrenzdogmatik | 93 | ||
| I. Einleitung | 93 | ||
| II. Struktur der abwehrrechtsbegründenden Grundrechtsnorm | 93 | ||
| 1. Tatbestand | 94 | ||
| a) Tatbestand in sachlicher Hinsicht | 94 | ||
| aa) Grundrechtsbegrenzungen als Tatbestandsmerkmale? | 96 | ||
| (1) Inkorporation von Grundrechtsbegrenzungen | 96 | ||
| (2) Kritik der Begrenzungsinkorporation | 98 | ||
| bb) Grundrechtsbeeinträchtigung als Tatbestandsmerkmal? | 100 | ||
| b) Tatbestand in personeller Hinsicht - Exkurs zur Konkurrenz von Deutschen- und Jedermanngrundrechten | 106 | ||
| 2. Grundrechtsbegrenzungen | 111 | ||
| 3. Sonstige Begrenzungsregelungen - „Schrankenschranken" | 114 | ||
| a) Formelle Anforderungen | 114 | ||
| b) Materielle Anforderungen | 115 | ||
| c) Verfassungsmäßigkeit im übrigen | 117 | ||
| 4. Zusammenfassung | 119 | ||
| III. Der abwehrrechtliche Schutzgegenstand | 119 | ||
| 1. Systematik der Schutzgegenstände | 120 | ||
| a) Erscheinungsformen | 120 | ||
| b) Bestimmung des Schutzgegenstandes | 121 | ||
| c) Schutzgegenstandsmehrheiten | 123 | ||
| aa) Unechte Schutzgegenstandsmehrheiten | 123 | ||
| bb) Echte Schutzgegenstandsmehrheit | 124 | ||
| d) Verhältnis der Schutzgegenstände zueinander | 125 | ||
| 2. Konzentration der Gewährleistungsgehalte mehrerer Grundrechte zu einem Schutzgegenstand? | 128 | ||
| a) Allgemeines Persönlichkeitsrecht | 128 | ||
| b) Sonstige Synthesegrundrechte | 130 | ||
| aa) Grundrecht auf Mobilität | 130 | ||
| bb) Zeitungspersönlichkeitsrecht | 131 | ||
| E. Allgemeine Konkurrenzdogmatik der Grundrechtsnormen | 133 | ||
| I. Der Satz von der Widerspruchslosigkeit der Rechtsordnung als Grund für die Auflösung von Konkurrenzlagen | 133 | ||
| 1. Widerspruchsfähigkeit von Grundrechtsnormen | 133 | ||
| 2. Gegenstand der Konkurrenz | 134 | ||
| 3. Sonstige Auflösungsgründe? | 135 | ||
| II. Verfahren der Konkurrenzauflösung | 136 | ||
| 1. Konkurrenzlösende Verfassungsnormen und -aussagen? | 136 | ||
| a) Grundrechtsbezogene Regelungen | 136 | ||
| b) Bindungsklausel, Art. 1 Abs. 3 GG | 137 | ||
| c) Wesensgehaltsgarantie, Art. 19 Abs. 2 GG | 138 | ||
| aa) Sicherungswirkung | 138 | ||
| bb) Sperrwirkung bei Eingriff in den Wesensgehalt | 138 | ||
| d) Art. 142 GG | 139 | ||
| 2. Konkurrenzauflösung nach allgemeinen Regeln | 144 | ||
| a) Normlogische Spezialität | 144 | ||
| aa) Eingliedrige Schutzgegenstände | 144 | ||
| bb) Mehrgliedrige Schutzgegenstände | 145 | ||
| cc) Eigentumsschutz durch normlogisch spezielle Grundrechtsnormen | 147 | ||
| b) Normative Spezialität | 149 | ||
| aa) Konkurrenz unterschiedlicher Schutzgegenstandstypen | 149 | ||
| bb) Inhalts- und Ausübungsrechte | 152 | ||
| cc) Haupt- und Hilfsschutzgegenstände | 157 | ||
| dd) Reichweite der Verdrängung | 160 | ||
| (1) Problematik | 160 | ||
| (2) Restwirkung der verdrängten Norm | 161 | ||
| c) Tatbestandliche Idealkonkurrenz - Dominanz der stärksten Entscheidungsnorm | 163 | ||
| d) Logischer Vorrang der Verdrängung kraft Spezialität | 164 | ||
| III. Schutzzweck der Grundrechtsnorm | 165 | ||
| F. Die Konkurrenzverhältnisse im einzelnen | 167 | ||
| I. Einleitung | 167 | ||
| II. Die Garantie der Menschenwürde - Art. 1 Abs. 1 GG | 167 | ||
| 1. Einleitung | 167 | ||
| 2. Schutzgegestandsbestimmung | 169 | ||
| 3. Annex - Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung | 171 | ||
| III. Meinungs- und Mediengrundrechte - die internen Konkurrenzverhältnisse des Art. 5 Abs. 1 GG | 172 | ||
| 1. Einleitung | 172 | ||
| 2. Verhältnis der Meinungsäußerungsfreiheit zu den Mediengrundrechten am Beispiel der Pressefreiheit | 173 | ||
| a) Einleitung | 173 | ||
| b) Schutzgegenstandsbestimmung | 174 | ||
| c) Tatbestandsabgrenzung | 178 | ||
| d) Schutzzweck | 180 | ||
| e) Fallbeispiele | 180 | ||
| 3. Verhältnis der Informationsfreiheit zu den Mediengrundrechten am Beispiel der Pressefreiheit | 181 | ||
| 4. Verhältnis der Mediengrundrechte zueinander | 182 | ||
| IV. Kunstfreiheit - Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG | 184 | ||
| 1. Verhältnis zur Meinungsäußerungsfreiheit | 184 | ||
| a) Einleitung | 184 | ||
| b) Schutzgegenstandsbestimmung | 188 | ||
| aa) Keine normlogische Spezialität der Kunstfreiheit | 188 | ||
| bb) Fälle normativer Spezialität der Kunstfreiheit | 189 | ||
| cc) Tatbestandsabgrenzung - Exkurs zum Kunstbegriff | 190 | ||
| dd) Fälle normativer Spezialität der Meinungsäußerungsfreiheit | 192 | ||
| 2. Verhältnis zu den Mediengrundrechten am Beispiel der Filmfreiheit | 195 | ||
| V. Wissenschaftsfreiheit - Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG | 196 | ||
| 1. Verhältnis zur Meinungsfreiheit | 196 | ||
| 2. Verhältnis zu den Mediengrundrechten | 196 | ||
| 3. Verhältnis zur Informationsfreiheit | 197 | ||
| VI. Glaubens- und Gewissensfreiheit, Kriegsdienstverweigerung - Art. 4 GG | 198 | ||
| 1. Verhältnis zur Meinungsäußerungsfreiheit | 198 | ||
| a) Einleitung | 198 | ||
| b) Schutzgegenstandsbestimmung | 199 | ||
| c) Normative Spezialität der Glaubens- und der Gewissensfreiheit | 202 | ||
| d) Tatbestandsabgrenzung zwischen Gewissens- und Meinungsfreiheit | 203 | ||
| 2. Interne Konkurrenzverhältnisse | 203 | ||
| 3. Verhältnis zu den Mediengrundrechten | 204 | ||
| 4. Verhältnis zur Wissenschafts- und Kunstfreiheit | 205 | ||
| 5. Verhältnis zum Elternrecht - Art. 6 Abs. 2 GG | 206 | ||
| 6. Verhältnis zu Art. 7 Abs. 2 GG, Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG und Art. 7 Abs. 3 S. 3 GG | 208 | ||
| 7. Verhältnis zu Art. 140 GG i.V.m. den Regelungen der WRV | 209 | ||
| a) Einleitung | 209 | ||
| b) Verhältnis zu Art. 136 Abs. 1 WRV | 210 | ||
| c) Verhältnis zu Art. 136 Abs. 3 u. 4 WRV | 212 | ||
| d) Verhältnis zu Art. 137 Abs. 2 WRV | 212 | ||
| e) Verhältnis zu Art. 137 Abs. 3 WRV | 213 | ||
| f) Verhältnis zu Art. 138 Abs. 2 WRV | 215 | ||
| VII. Allgemeine Handlungsfreiheit und allgemeines Persönlichkeitsrecht - Art. 2 Abs. 1 GG; Freiheit der Person - Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG | 216 | ||
| 1. Allgemeine Handlungsfreiheit | 216 | ||
| 2. Allgemeines Persönlichkeitsrecht | 219 | ||
| 3. Freiheit der Person - Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG | 221 | ||
| a) Verhältnis zu Art. 104 GG | 221 | ||
| b) Verhältnis zu Art. 11 GG | 223 | ||
| VIII. Versammlungsfreiheit - Art. 8 GG | 226 | ||
| 1. Verhältnis zur Meinungsäußerungsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG | 226 | ||
| a) Einleitung | 226 | ||
| b) Tatbestandsabgrenzung | 227 | ||
| c) Schutzzweck | 228 | ||
| d) Fälle normlogischer Spezialität | 229 | ||
| 2. Verhältnis zur Kunstfreiheit, Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG | 231 | ||
| 3. Verhältnis zu Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG sowie Art. 4 Abs. 1, 2 GG | 231 | ||
| IX. Vereinigungsfreiheit - Art. 9 Abs. 1 GG | 233 | ||
| X. Berufsfreiheit - Art. 12 GG | 235 | ||
| 1. Verhältnis zu Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG | 235 | ||
| a) Einleitung | 235 | ||
| b) Schutzgegenstandsbestimmung | 235 | ||
| 2. Verhältnis zu Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG; Art. 4 Abs. 1, 2 GG; Art. 33 GG | 238 | ||
| XI. Eigentumsfreiheit - Art. 14 GG | 240 | ||
| 1. Tatbestandsabgrenzung | 240 | ||
| 2. Allgemeine Schlußfolgerungen für das Verhältnis zu den Freiheitsrechten | 243 | ||
| 3. Verhältnis zu Art. 2 Abs. 1 GG; Art. 12 GG; Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 Abs. 2 WRV | 244 | ||
| 4. Verhältnis zu Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG | 245 | ||
| XII. Anmerkungen zum allgemeinen Gleichheitssatz - Art. 3 Abs. 1 GG | 247 | ||
| Literaturverzeichnis | 249 | ||
| Sachwortverzeichnis | 260 |
