Europa auf dem Wege zur Politischen Union?
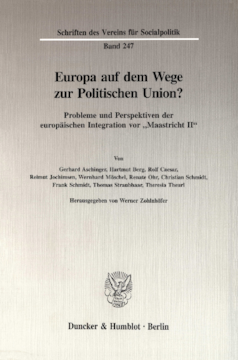
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Europa auf dem Wege zur Politischen Union?
Probleme und Perspektiven der europäischen Integration vor »Maastricht II«
Editors: Zohlnhöfer, Werner
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 247
(1996)
Additional Information
Book Details
Abstract
Der Vertrag von Maastricht ist - im Lichte der ursprünglich artikulierten Zielvorstellungen - als Torso zu betrachten: Während die Schaffung einer Europäischen Währungsunion (EWU) in vollem Umfang vereinbart wurde, blieben die Bemühungen um substantielle Fortschritte auf dem Wege zu einer Politischen Union Europas in rudimentären Ansätzen stecken. Als (schwacher) Trost blieb Befürwortern einer weitergehenden politischen Integration lediglich die »Zusage« des EU-Vertrags, daß im Jahre 1996 eine Regierungskonferenz zur Revision der Bestimmungen über die Politische Union einberufen wird.Dieses Ereignis - meist nur kurz als »Maastricht II« bezeichnet - nahm der Wirtschaftspolitische Ausschuß des Vereins für Socialpolitik zum Anlaß, sich im Rahmen seiner Sitzung im April 1996 in Fribourg (Schweiz) mit Problemen und Perspektiven einer Weiterentwicklung der Integration Europas zu beschäftigen. Im Gegensatz zur Regierungskonferenz widmete sich der Ausschuß allerdings nicht nur Fragen einer möglichen Fortentwicklung der Politischen Union, sondern auch, ja in besonderem Maße, den Erfolgsaussichten der geplanten Europäischen Währungsunion. Entsprechend wird in diesem Tagungsband ein breites Spektrum von Fragen thematisiert. Es reicht von einem umfassenden Problemaufriß über eine differenzierte Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken der EWU bis hin zu einer Prognose der von der Regierungskonferenz zu erwartenden Änderungen der institutionellen Infrastruktur der EU. In ihrer Gesamtheit verdeutlichen diese acht Beiträge nicht nur, wie weit die EU heute noch von einer Politischen Union entfernt ist, die diesen Namen verdient; sie bemühen sich auch um Antworten auf die Frage, welche Wege sich als (nicht) zielführend erweisen dürften.
