Ansätze für eine ökonomische Analyse des Subsidiaritätsprinzips des EG Art. 5 Abs. 2
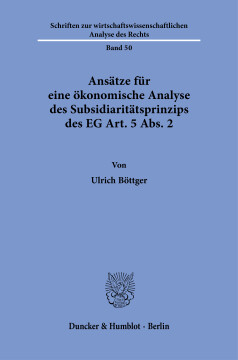
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Ansätze für eine ökonomische Analyse des Subsidiaritätsprinzips des EG Art. 5 Abs. 2
Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des Rechts, Vol. 50
(2004)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Das Subsidiaritätsprinzip des EG Art. 5 Abs. 2 wird mit Hilfe des ökonomischen Instrumentariums der ökonomischen Analyse des Rechts mit dem Ziel untersucht, zu einer Konkretisierung zu gelangen, die der juristischen Anwendung dieser Norm als Kompetenzbegrenzungsregel dient. Es soll ein Modell für eine ökonomische Analyse der Kompetenzausübung entwickelt werden. Hierzu entwirft Ulrich Böttger einen komplexen interdisziplinären Ansatz, eine positive Ökonomik im Rahmen der (neuen) Institutionenökonomik. Das Modell wird aus einer Synthese von Property-Rights-Ansatz und Transaktionskostentheorie im Subsidiaritätsprinzip entwickelt. Der Autor arbeitet die Schwächen und offenen Fragen, insbesondere die Unbestimmtheit des Subsidiaritätsprinzips, heraus.Die FuE, insbesondere die Förderung der angewandten Forschung der EG, besteht den Subsidiaritätstest nicht.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Α. Einleitung | 15 | ||
| I. Einführung | 15 | ||
| II. Problemstellung | 16 | ||
| III. Gang der Untersuchung | 20 | ||
| B. Das Subsidiaritätsprinzip des EG Art. 5 Abs. 2: Schwächen, offene Fragen, Lösungsansätze | 21 | ||
| I. Die bestehende EG-Kompetenzverteilung | 21 | ||
| II. Das Subsidiaritätsprinzip des EG: Die vorherrschenden Ansätze zur Inhaltsbestimmung | 28 | ||
| 1. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips | 34 | ||
| 2. Begründungspflicht für Rechtsakte | 36 | ||
| 3. Gerichtliche Überprüfung | 38 | ||
| III. Zur Kritik des Subsidiaritätsprinzips des EG Art. 5 | 40 | ||
| 1. Die unvollendete Kompetenzordnung des EGV als Grundproblem des Subsidiaritätskonzepts der EG | 41 | ||
| 2. Die begriffliche Unbestimmtheit des EG Art. 5 Abs. 2 | 48 | ||
| a) Bisherige Konkretisierungsvorschläge zu EG Art. 5 Abs. 2 | 49 | ||
| b) Memorandum der Bundesregierung zum Subsidiaritätsprinzip | 51 | ||
| c) Erklärungen der Europäischen Organe zu EG Art. 5 (Art. 3 b EGV) | 51 | ||
| d) Das Problem der Überantwortung einer Kompetenzprüfung an das Gemeinschaftsorgan EuGH | 57 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 61 | ||
| V. Die Notwendigkeit inhaltlicher Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips | 61 | ||
| VI. Zwischenbilanz | 63 | ||
| 1. Ausgangssituation | 63 | ||
| 2. Konsequenzen für das weitere Vorgehen | 63 | ||
| VII. Der wirtschaftstheoretische Rahmen der Arbeit | 65 | ||
| 1. Die zentralen Annahmen der neuen Institutionenökonomik | 65 | ||
| a) Ressourcenknappheit | 66 | ||
| b) Eigennutztheorem | 67 | ||
| c) (Beschränkte) Rationalität | 67 | ||
| d) Methodologischer Individualismus | 68 | ||
| 2. Öffentliche Güter und Mautgüter - Die Grundlagenforschung als öffentliches Gut in Abgrenzung von der angewandten Forschung | 70 | ||
| a) Öffentliche Güter | 70 | ||
| b) Grundlagenforschung als öffentliches Gut | 72 | ||
| c) Angewandte Forschung als Maut-Gut | 75 | ||
| VIII. Das Grundmodell der Analyse | 77 | ||
| 1. Legitimationsgrundlagen | 77 | ||
| 2. Subsidiaritätsprinzip und Organisationstheorie | 81 | ||
| a) Der Property-Rights-Ansatz | 82 | ||
| b) Transaktionskostentheorie | 85 | ||
| c) Synthese Property-Rights-Ansatz und Transaktionskostentheorie im Subsidiaritätsprinzip | 87 | ||
| d) Das Prüfmodell von Homann und Kirchner | 91 | ||
| IX. Einfachmodell für die Überprüfung einer Kompetenzausübung auf ihre Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip | 91 | ||
| X. Programm der weiterführenden Analyse | 92 | ||
| 1. Der statische Kosten- und Effizienzvergleich | 93 | ||
| 2. Die Zukunftserwartungen im Hinblick auf einen Kostenvergleich unter Wettbewerbsaspekten | 94 | ||
| 3. Die Zukunftserwartungen bezüglich existierender Unterschiede bei den Möglichkeiten der Kontrolle der Bürger über die Akteure auf politischer und administrativer Ebene | 95 | ||
| 4. Entscheidung über die Ebene der Kompetenzausübung | 98 | ||
| C. Die Förderung von Forschung und technologischer Entwicklung in der Gemeinschaft aus öffentlichen Mitteln | 99 | ||
| I. Förderung der (Grundlagen-)Forschung durch die Gemeinschaft | 99 | ||
| 1. Das 4. Rahmenprogramm | 102 | ||
| 2. Das 5. Rahmenprogramm | 107 | ||
| a) Inhalt der „thematischen" Programme | 109 | ||
| b) Inhalt der „horizontalen" Programme | 110 | ||
| 3. Die Entwicklung und Durchführung der EU-FuE-Programme | 118 | ||
| a) Entwicklung der Programme | 118 | ||
| b) Programminstallierung | 121 | ||
| c) Bewerbungs- und Auswahlverfahren | 122 | ||
| d) Vertragsschluß | 123 | ||
| e) Kontrolle und Berichterstattung | 123 | ||
| f) Evaluation der Programme | 124 | ||
| g) Verwertung der Ergebnisse | 125 | ||
| 4. Zum Stellenwert der Grundlagenforschung im Rahmen der EU-FuE | 130 | ||
| 5. Die Position der Gemeinsamen Forschungsstelle im FuE-Konzept der EU | 133 | ||
| 6. Vernetzung der EU-Politiken | 136 | ||
| II. Förderung der (Grundlagen-)Forschung in der Bundesrepublik Deutschland als Beispiel für FuE in Mitgliedstaaten | 138 | ||
| 1. Die Forschungsinfrastruktur | 138 | ||
| 2. FuE-finanzierende Sektoren | 140 | ||
| a) Blaue Liste | 143 | ||
| b) CAESAR | 143 | ||
| 3. Bewertung | 144 | ||
| III. Die Multilateralen Kooperationsrahmen EUREKA und COST | 145 | ||
| 1. EUREKA | 146 | ||
| 2. COST | 147 | ||
| D. Ansätze für eine ökonomische Analyse der Kompetenzausübung auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung - Einfachmodell | 149 | ||
| I. Kostenfaktoren | 150 | ||
| 1. Economies of Scale | 152 | ||
| a) Verfahrenskonzentration und -vereinheitlichung | 154 | ||
| aa) Zum COST-Programm | 158 | ||
| bb) Zur EUREKA-Initiative | 159 | ||
| b) Vermeidung von Doppelforschung | 161 | ||
| c) Verbreitung der Ergebnisse | 164 | ||
| d) Einschränkung des Lobbyismus | 167 | ||
| 2. Economies of Scope | 172 | ||
| 3. Fazit | 173 | ||
| II. Der Effizienzaspekt | 174 | ||
| 1. Negative externe Effekte | 174 | ||
| 2. Positive externe Effekte | 175 | ||
| a) Ansätze für eine Verbesserung suboptimaler Zustände in Richtung auf eine effiziente Ressourcennutzung | 176 | ||
| aa) Förderung und Finanzierung von Grundlagenforschung | 176 | ||
| bb) Bereitstellung von Infrastruktur | 177 | ||
| cc) Aus-, Weiter- und Hochschulbildung, Zusatzqualifikationen | 178 | ||
| b) Fazit | 178 | ||
| III. Zusätzliche positive externe Effekte durch EU-FuE? | 179 | ||
| 1. Das Trittbrettfahrerproblem bei der Verteilung von FuE-Fördermitteln auf staatlicher Ebene | 179 | ||
| 2. Durch EU-FuE ausgelöste positive externe Effekte bei Privaten | 182 | ||
| 3. Fazit | 188 | ||
| E. Der Wettbewerbsaspekt | 189 | ||
| I. Der Wettbewerb unter privaten Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen | 190 | ||
| 1. Zur „Vorwettbewerblichkeit" der EU-FuE | 192 | ||
| a) Das Konzept der Vorwettbewerblichkeit | 192 | ||
| b) Zwischenergebnis | 198 | ||
| 2. Zur Marktrelevanz der EU-FuE | 198 | ||
| a) Das Kriterium des überlegenen Wissens | 202 | ||
| aa) Zur Informationsmangeltheorie | 203 | ||
| bb) Zur Prognosefehlertheorie | 204 | ||
| b) Das Kriterium der Effizienzsteigerung durch zentral gesteuerte FuE | 207 | ||
| aa) Führt Zentralisation zu mehr Forschungseffizienz? | 208 | ||
| bb) Führen die Koordination von Forschung und die Vermeidung von Doppelforschung zu mehr Forschungseffizienz und zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Effizienz? | 210 | ||
| c) Das Kriterium der Mitnahmeeffekte und Lobbytätigkeit | 215 | ||
| d) Zusammenfassende Beurteilung der Ordnungskonformität der EU-FuE | 219 | ||
| e) Perspektiven der EU-FuE unter dem Aspekt des Wettbewerbs | 219 | ||
| f) Konkret: Das 5. Rahmenprogramm | 220 | ||
| 3. Erste Schlußfolgerungen für den Wettbewerbsaspekt | 222 | ||
| 4. Inhaltliche Vorgaben für eine ordnungskonforme FuE | 222 | ||
| 5. Exkurs: Die Schwierigkeiten der Durchsetzung eines bestimmten ordnungspolitischen Konzepts auf Gemeinschaftsebene | 223 | ||
| II. Der Wettbewerb der politischen Systeme | 229 | ||
| 1. Kohäsion versus Wettbewerb der Regionen | 235 | ||
| 2. Fazit | 236 | ||
| III. Zwischenergebnis zum Wettbewerbsaspekt | 236 | ||
| F. Kontrolle | 237 | ||
| I. Die grundsätzliche Bedeutung der Kontrolle von Mandatsträgern | 237 | ||
| 1. Grundsätzliche Kontrollprobleme bei öffentlicher Aufgabenerfüllung | 239 | ||
| 2. Grundsätzliche Kontrollprobleme bei gemeinschaftlicher Aufgabenerfüllung | 242 | ||
| 3. Grundsätzliche Kontrollprobleme bei gemeinschaftlicher Aufgabenerfüllung auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung | 243 | ||
| a) Systemimmanter Kontrollverlust: Experten kontrollieren anstelle der Bürger (Prinzipale) | 243 | ||
| b) Konkret: Lobbyismus | 246 | ||
| II. Welche politischen Akteure sind im FuE-Prozeß auf EU-Ebene beteiligt? | 250 | ||
| 1. Die Kommission | 250 | ||
| 2. Der Ministerrat | 250 | ||
| 3. Das Europäische Parlament | 251 | ||
| 4. Der Wirtschafts-und Sozialausschuß | 251 | ||
| 5. Der Ausschuß der Regionen | 251 | ||
| 6. Der Europäische Gerichtshof | 251 | ||
| III. Welche Möglichkeiten bestehen für den Bürger (Prinzipal), diese Organe und deren Mitglieder als europäische Akteure (Agenten) zu kontrollieren? | 251 | ||
| 1. Kommission | 251 | ||
| 2. Ministerrat | 253 | ||
| 3. Europäisches Parlament | 258 | ||
| a) Wahlrecht | 260 | ||
| b) Parteiensystem | 261 | ||
| 4. Wirtschafts- und Sozialausschuß | 262 | ||
| 5. Europäischer Gerichtshof | 262 | ||
| IV. Ansätze für institutionelle Veränderungen | 265 | ||
| 1. Kompetenzkatalog | 265 | ||
| 2. Rückübertragung von Kompetenzen | 266 | ||
| 3. Flexibilität, opt-out-Klausel | 267 | ||
| 4. Gewaltenteilung, Kommission | 268 | ||
| 5. Europäisches Parlament | 269 | ||
| a) Mehr Befugnisse und Kompetenzen für das Europäische Parlament? | 269 | ||
| b) Zwei-Kammern-System | 270 | ||
| c) Konkrete Ausgestaltung entsprechend dem Vorschlag der European Constitutional Group | 272 | ||
| d) Stimmgewichtung | 272 | ||
| e) 5 %-Klausel | 273 | ||
| 6. Der Ministerrat | 274 | ||
| a) Stimmgewichtung im Rat | 275 | ||
| b) Zustimmungs- und Mehrheitserfordernisse im Rat | 276 | ||
| c) Abgestufte Mehrheitserfordernisse | 277 | ||
| 7. Judikative | 280 | ||
| a) Europäischer Verfassungsgerichtshof | 280 | ||
| b) Europäischer Gerichtshof | 282 | ||
| V. Fazit | 283 | ||
| G. Schlußbetrachtung | 284 | ||
| I. Aussagen zum Subsidiaritätsprinzip | 284 | ||
| II. Der erforderliche Rahmen für die Funktionsfähigkeit des Subsidiaritätsprinzips | 285 | ||
| III. Die gemeinschaftliche Politik für Forschung und Entwicklung auf dem Prüfstand des Subsidiaritätsprinzips | 287 | ||
| Literaturverzeichnis | 289 | ||
| Sachwortverzeichnis | 310 |
