Studien zum Recht der städtebaulichen Umlegung
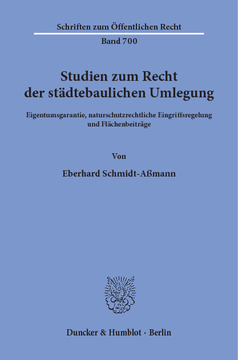
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Studien zum Recht der städtebaulichen Umlegung
Eigentumsgarantie, naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Flächenbeiträge
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 700
(1996)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 10 | ||
| Vorbemerkungen | 13 | ||
| Erster Abschnitt: Die eigentumsverfassungsrechtliche Problematik der Umlegung | 16 | ||
| (1) Zur Bedeutung der Qualifikationsfrage | 16 | ||
| (2) Zu den Diskussionsebenen der Qualifikationsfrage | 17 | ||
| A. Die Einstufung der Umlegung in der fachgerichtlichen Rechtsprechung und im Schrifttum | 19 | ||
| I. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts | 20 | ||
| 1. Abgrenzung nach der Interessenformel | 20 | ||
| 2. Verlagerungen auf eine Folgenbetrachtung | 22 | ||
| 3. Bedeutung der jüngeren Rechtsprechung | 26 | ||
| II. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs | 29 | ||
| 1. Die Interessenformel als Grundlage | 29 | ||
| a) Grundlinie: Privatnützigkeit | 29 | ||
| b) Zweckkonkretisierungen | 31 | ||
| 2. Die Wertformel als Zusatzkriterium | 33 | ||
| III. Die eigentumsverfassungsrechtliche Einstufung der Umlegung in der Literatur | 36 | ||
| 1. Umlegung als Inhalts- und Schrankenbestimmung | 36 | ||
| 2. Andere Einstufungen der Umlegung | 38 | ||
| a) Ältere Literatur | 38 | ||
| b) Jüngere Literatur | 39 | ||
| IV. Zwischenergebnis | 40 | ||
| B. Die Bedeutung der neueren eigentumsrechtlichen Dogmatik | 41 | ||
| I. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Fragen der Bodenordnung | 42 | ||
| 1. Die Entscheidung zum Umlegungsvorteil | 42 | ||
| 2. Das Deichordnungsurteil | 43 | ||
| 3. Die Entscheidung zur Unternehmensflurbereinigung | 43 | ||
| a) Enteignungstatbestand | 44 | ||
| b) Fragen der "Vorwirkung" | 45 | ||
| c) Enteignungsrechtliche Konsequenzen | 46 | ||
| II. Das größere Umfeld der eigentumsverfassungsrechtlichen Dogmatik | 46 | ||
| 1. Der Gehalt der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) | 47 | ||
| a) Bedeutungsschichten | 47 | ||
| aa) Rechtsstellungsgarantie | 47 | ||
| bb) Rechtsinstitutsgarantie | 48 | ||
| b) Inhalt: Privatnützigkeit | 49 | ||
| 2. Die Aufgaben des Gesetzgebers (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG) | 50 | ||
| a) Rechtserzeugter Schutzbereich | 50 | ||
| b) Determinanten der Ausgestaltung | 51 | ||
| 3. Die Sozialgebundenheit (Art. 14 Abs. 2 GG) | 52 | ||
| a) Bestand und Wandelbarkeit | 53 | ||
| b) Differenzierte Interessenstrukturen | 54 | ||
| 4. Der Begriff der Enteignung (Art. 14 Abs. 3 GG) | 55 | ||
| a) Reformalisierung: "Entzug" | 55 | ||
| b) Zwecke des Entzuges | 57 | ||
| C. Zusammenfassung: Qualifikation nach der Privatnützigkeit | 58 | ||
| I. Das Dilemma unterschiedlicher Rationalitäten | 59 | ||
| II. Mögliche Kriterien der Zweckkonkretisierung | 60 | ||
| IIΙ. Typisierung und Bilanzierung als Methoden der Zweckbestimmung | 62 | ||
| 1. Spektrum der Anknüpfungsmöglichkeiten | 62 | ||
| 2. Vermittelnde Betrachtung | 63 | ||
| a) Phase der Zwecksetzung | 64 | ||
| b) Phase der Zuteilung und Abfindung | 64 | ||
| Zweiter Abschnitt: Der Einsatz der Umlegung zur Aufbringung eingriffsrechtlicher Ausgleichs- und Ersatzflächen (§§ 8a-c BNatSchG) | 65 | ||
| A. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Städtebau | 66 | ||
| I. Das Grundmodell des § 8 BNatSchG | 66 | ||
| 1. Eingriffs- und Pflichtensystem | 66 | ||
| a) Eingriffsbegriff | 66 | ||
| b) Pflichtensystem | 67 | ||
| 2. Grundlage im Verursacherprinzip | 68 | ||
| 3. Bisherige Einbeziehung baurechtlicher Sachverhalte | 70 | ||
| a) Qualifiziert beplanter Bereich (§ 30 BauGB) | 71 | ||
| b) Innenbereich (§ 34 BauGB) | 72 | ||
| c) Außenbereich (§ 35 BauGB) | 72 | ||
| 4. Zusammenfassung | 73 | ||
| II. Die neue planerische Variante der §§ 8a-c BNatSchG | 73 | ||
| 1. Planerische Bewältigungsverantwortung | 75 | ||
| a) Ermittlungspflichten | 75 | ||
| b) Gestaltungspflichten | 76 | ||
| c) Abwägungspflichten | 76 | ||
| 2. Materielle Erfullungsverantwortung | 78 | ||
| 3. Rechtspraktische Regelungsverantwortung | 79 | ||
| ΙII. Zwischenergebnis | 80 | ||
| B. Die Realisierung der planerischen Eingriffsregelung durch das Instrument der Umlegung: Bedeutung der Zweckformel | 81 | ||
| I. Umlegung und andere Durchführungsinstrumente | 82 | ||
| 1. Städtebauliche Verträge: freiwillige Umlegung | 82 | ||
| 2. "Verursacher-nahe" Ausgleichskonzepte | 84 | ||
| II. Die Privatnützigkeit und die Zweckvertypungen des § 45 BauGB | 85 | ||
| 1. Die gesetzlichen Zwecktypisierungen | 86 | ||
| 2. Ausgleichs- und Ersatzflächen | 88 | ||
| a) Eigentümer der Eingriffsgrundstücke | 88 | ||
| b) Eigentümer der Ausgleichs- und Ersatzflächen | 89 | ||
| aa) Eigentümer im vorgeprägten Interessenverbund | 89 | ||
| bb) Eigentümer im gewillkürten Interessenverbund | 89 | ||
| c) Zwischenergebnis | 91 | ||
| C. Die Zuteilung von Ausgleichs- und Ersatzflächen in der Umlegung | 92 | ||
| I. Die Zuteilung aus der Verteilungsmasse gemäß § 59 Abs. 1 BauGB | 93 | ||
| 1. Die Grundsätze der läge- oder lagewertgleichen Zuteilung | 94 | ||
| a) Gleiche Lage | 95 | ||
| b) Gleichwertige Lage | 95 | ||
| 2. Die Grundsätze der anteilsgleichen und wertgleichen Zuteilung | 96 | ||
| a) Grundlagen | 96 | ||
| b) Bewertungsfragen | 97 | ||
| aa) Überkommene Bewertungsansätze | 98 | ||
| bb) Neuere Bewertungsansätze | 100 | ||
| II. Die Zuteilung als Gemeinschaftsanlage gemäß § 61 Abs. 1 BauGB | 101 | ||
| 1. Der Begriff der Gemeinschaftsanlage | 102 | ||
| a) Einrichtungsbezogene Interpretation | 102 | ||
| b) Funktionelle Interpretation | 102 | ||
| 2. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen | 103 | ||
| III. Der Vorwegabzug gem. § 55 Abs. 2 BauGB | 104 | ||
| 1. Verkehrsflächenbedingte AuE-Flächen | 105 | ||
| a) Vorwegabzug als örtliche Verkehrsflächen (Nr. 1) | 105 | ||
| b) Vorwegabzug als Grünflächen (Nr. 2) | 106 | ||
| c) Gemeinsame Grundsätze | 106 | ||
| 2. Bauflächenbedingte AuE-Flächen | 108 | ||
| a) Meinungsstand der Literatur | 108 | ||
| b) Stellungnahme | 111 | ||
| aa) Keine abstrakte Solidargemeinschaft | 112 | ||
| bb) Verursacher-begründete Solidargemeinschaft | 113 | ||
| cc) Konkrete Feststellung | 113 | ||
| IV. Der Vorwegabzug gem. § 55 Abs. 5 BauGB | 115 | ||
| 1. Verfassungsrechtliche Fragen | 115 | ||
| a) Grundlagen | 116 | ||
| b) Konsequenzen | 117 | ||
| 2. Abzug von Ausgleichs- und Ersatzflächen | 118 | ||
| a) Durch öffentliche Nutzung bedingte AuE-Flächen | 118 | ||
| b) Bauflächenbedingte AuE-Flächen | 119 | ||
| aa) Flächen für öffentliche Nutzungszwecke | 119 | ||
| bb) Enteignungsrechtliche Implikationen | 120 | ||
| Dritter Abschnitt: Verfassungsfragen eines erhöhten Flächenbeitrags | 122 | ||
| A. Die historische Entwicklung des Rechts der Flächenbeiträge | 123 | ||
| I. Vorab: zu den Begriffen | 123 | ||
| II. Vorläuferregelungen im älteren Recht | 124 | ||
| 1. Lex Adickes | 124 | ||
| 2. Badisches Ortsstraßengesetz | 126 | ||
| 3. Referentenentwurf für ein Reichsstädtebaugesetz | 126 | ||
| 4. Reichsumlegungsordnung | 126 | ||
| 5. Württemberg-Badisches Baulandgesetz | 127 | ||
| 6. Nordrhein-Westfälisches Aufbaugesetz | 128 | ||
| 7. Rheinland-Pfälzisches Aufbaugesetz | 129 | ||
| ΙII. Die Entstehungsgeschichte des § 58 BauGB | 129 | ||
| 1. Regierungsentwurf zum BBauG | 129 | ||
| 2. Die endgültige Fassung des § 58 BBauG | 131 | ||
| IV. Zusammenfassung | 132 | ||
| B. Die derzeitige Regelung des § 58 Abs. 1 BauGB und die Forderungen nach einer Erhöhung der Flächenbeiträge | 133 | ||
| I. Zur Verfassungsmäßigkeit der bisherigen Regelung | 133 | ||
| II. Neuere Forderungen nach einer Erhöhung der Flächenbeiträge | 136 | ||
| 1. Stellungnahmen für eine Erhöhung | 136 | ||
| 2. Stellungnahmen gegen Erhöhungen | 137 | ||
| C. Flächenbeiträge im Konzept der privatnützigen Umlegung | 138 | ||
| I. Flächenbeiträge als Ausdruck des Vorteilsausgleichsgedankens | 138 | ||
| 1. Die einzelnen Bestandteile des Umlegungsvorteils | 138 | ||
| a) Vorteile durch Bereitstellung von Erschließungsflächen | 139 | ||
| b) Vorteile aus der Neuordnung | 139 | ||
| 2. Verhältnis zum Planungsvorteil und zu gemeindlichen Aufwendungen | 140 | ||
| II. Vorteilsausgleich und Privatnützigkeit | 141 | ||
| 1. Flächenabzug für Erschließungsmaßnahmen (§ 55 Abs. 2 BauGB) | 142 | ||
| 2. Flächenbeitrag für den allgemeinen Vorteilsausgleich | 142 | ||
| a) Umlegungsvorteile im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG | 142 | ||
| b) Unterschiede zur Wertumlegung | 143 | ||
| c) Verfassungsfunktion der Obergrenzenregelung | 144 | ||
| ΙII. Die derzeitige Obergrenze und ihre Erhöhung | 145 | ||
| 1. Variabilität der Prozentsätze | 145 | ||
| a) Bedeutung als akzeptierte Mindestsätze | 146 | ||
| b) Unsichere ältere "Erfahrungswerte" | 146 | ||
| c) Notwendigkeit neuer Erfahrungswerte | 148 | ||
| 2. Erhöhungsbedarf im Gefolge des § 8a BNatSchG | 148 | ||
| a) Konkrete Regelungsmöglichkeiten | 149 | ||
| b) Fragen einer Belastungsobergrenze | 150 | ||
| Zusammenfassung | 151 | ||
| Literaturverzeichnis | 156 |
