Die Organisation zwischen offener und geschlossener Gesellschaft
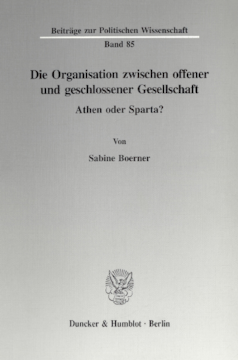
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Organisation zwischen offener und geschlossener Gesellschaft
Athen oder Sparta?
Beiträge zur Politischen Wissenschaft, Vol. 85
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 11 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 16 | ||
| A. Einleitung | 17 | ||
| I. Einführung in die Problematik | 17 | ||
| II. Zielsetzung der Untersuchung | 24 | ||
| III. Gegenstand und Aufbau der Untersuchung | 25 | ||
| IV. Methode der Untersuchung | 27 | ||
| B. Theoretische Konzeption und betriebliche Realität | 31 | ||
| I. Offene versus geschlossene Gesellschaft in der Konzeption Karl Poppers | 31 | ||
| 1. Einleitung | 31 | ||
| 2. Poppers Gesellschaftskonzeption in der Philosophie des kritischen Rationalismus | 32 | ||
| a) Elemente der Wissenschaftstheorie Karl Poppers | 34 | ||
| (1) Drei-Welten-Theorie | 34 | ||
| (2) Methodologischer Essentialismus versus methodologischer Nominalismus | 35 | ||
| (3) Objektivität als Intersubjektivität der wissenschaftlichen Methode | 36 | ||
| (4) Rationalismus in der Wissenschaftstheorie Poppers | 38 | ||
| b) Elemente der Sozialphilosophie Karl Poppers | 39 | ||
| (1) Naiver Monismus versus kritischer Dualismus | 39 | ||
| (2) Dezisionismus als Folge des kritischen Dualismus | 40 | ||
| (3) Humanitäre Ethik als Folge des kritischen Rationalismus | 40 | ||
| (4) Rationalistische Sozialethik als Basis der Gesellschaftskonzeption | 41 | ||
| (5) Offene und geschlossene Gesellschaft als Idealtypen | 42 | ||
| 3. Merkmale der offenen und geschlossenen Gesellschaft Poppers | 44 | ||
| a) Einstellung zu den Gebräuchen des sozialen Lebens | 44 | ||
| b) Handlungsautonomie der Mitglieder des Gemeinwesens | 49 | ||
| c) Soziale Differenzierung und Mobilität innerhalb des Gemeinwesens | 52 | ||
| d) Stellung des Individuums im Gemeinwesen | 55 | ||
| e) Aufgaben und Funktionsweise des Gemeinwesens | 58 | ||
| (1) Politische Aufgaben des Gemeinwesens | 58 | ||
| (2) Wissenschaftliche Aufgaben des Gemeinwesens | 60 | ||
| 4. Dimensionen zur Kennzeichnung der offenen und geschlossenen Gesellschaft | 63 | ||
| a) Anthropologische Dimension: Voluntarismus versus Determinismus | 64 | ||
| b) Soziale Dimension: Individualismus versus Kollektivismus | 65 | ||
| c) Kognitive Dimension: Vorläufigkeit versus Endgültigkeit | 66 | ||
| II. Organisationale Gestaltungsvariablen: Organisationskultur, Führung und Gruppe | 69 | ||
| 1. Organisationskultur | 69 | ||
| 2. Führung und Gruppenarbeit | 72 | ||
| 3. Beziehung von Organisationskultur, Führung und Gruppenarbeit | 75 | ||
| C. Widerspiegelung von Offenheit und Geschlossenheit in der betrieblichen Realität | 78 | ||
| I. Organisationskultur zwischen offener und geschlossener Gesellschaft | 78 | ||
| 1. Einleitung | 78 | ||
| 2. Konzeption der Organisationskultur | 79 | ||
| a) Artefakte und Erzeugnisse (“Artifacts and Creations”) | 82 | ||
| b) Werte (“Values”) | 82 | ||
| c) Grundannahmen (“basic assumptions”) | 83 | ||
| 3. Exkurs: Basic Assumptions im Organisationskultur-Konzept von Schein | 86 | ||
| a) Kulturanthropologische Basis der Basic Assumptions nach Kluckhohn und Strodtbeck | 86 | ||
| (1) Human Nature Orientation | 88 | ||
| (2) Man-Nature (-Supernature) Orientation | 88 | ||
| (3) Time Orientation | 89 | ||
| (4) Activity Orientation | 90 | ||
| (5) Relational Orientation | 90 | ||
| b) Basic Underlying Assumptions nach Schein | 92 | ||
| (1) Annahmen über das Wesen von Realität und Wahrheit | 92 | ||
| (2) Annahmen über das Wesen des Menschen | 94 | ||
| (3) Annahmen über das Wesen menschlicher Aktivität | 95 | ||
| (4) Annahmen über das Wesen menschlicher Beziehungen | 96 | ||
| 4. “Offene” versus “geschlossene” Organisationskultur | 100 | ||
| a) Anthropologische Dimension: “Planungssubjekt” versus “Planobjekt” | 101 | ||
| b) Soziale Dimension: “Partikularismus” versus “Holismus” | 104 | ||
| c) Kognitive Dimension: “Erkenntnissuche” versus “Erkenntnisumsetzung” | 106 | ||
| 5. Fazit | 111 | ||
| II. Führung zwischen offener und geschlossener Gesellschaft | 116 | ||
| 1. Einleitung | 116 | ||
| 2. “Offene” versus “geschlossene” Führung | 118 | ||
| a) Anthropologische Dimension: “liberale/fördernde” versus “direktive/entmündigende” Führung | 119 | ||
| b) Soziale Dimension: “pluralistische” versus “uniformistische” Führung | 124 | ||
| c) Kognitive Dimension: “dialogische/aufklärende” versus “monologische/verschleiernde” Führung | 126 | ||
| 3. Charismatische Führung als Konkretisierung von Führung | 129 | ||
| a) Modell der charismatischen Führung | 129 | ||
| (1) Art der Beeinflussung der Geführten | 133 | ||
| (2) Mittel der Beeinflussung | 134 | ||
| (3) Ziele der Beeinflussung | 134 | ||
| (4) Ergebnis der Beeinflussung | 135 | ||
| b) Charismatische Führung im Kontext der Popperschen Gesellschaftskonzeption | 135 | ||
| (1) Motivationale Funktion Charismatischer Führung (bedürfnistheoretische Sicht) | 138 | ||
| (2) Charismatische Führung als Denk- und Verhaltensprogrammierung (alltagspsychologische Sicht) | 142 | ||
| (3) Charismatische Führung als “Symbiose” (tiefenpsychologische Sicht) | 147 | ||
| (4) Charismatische Führung als soziales Lernen (sozialpsychologische Sicht) | 153 | ||
| c) Charismatische Führung als Schritt in die geschlossene Gesellschaft? | 154 | ||
| 4. Fazit | 156 | ||
| III. Gruppenarbeit zwischen offener und geschlossener Gesellschaft | 165 | ||
| 1. Einleitung | 165 | ||
| 2. “Offene” versus “geschlossene” Arbeitsgruppe | 166 | ||
| a) Anthropologische Dimension: “Legislative/Kommission” versus “Exekutive/Besatzung” | 169 | ||
| b) Soziale Dimension: “abstrakter Interessenverband” versus “organische Stammesgemeinschaft” | 171 | ||
| c) Kognitive Dimension: “Diskussionsforum und Perspektivenfundus” versus “Reservat von Dogmen und Ideologien” | 175 | ||
| 3. Exkurs: Gruppendynamische Phänomene (Kohäsion, Konformität, Groupthink) | 181 | ||
| a) Gruppenkohäsion | 181 | ||
| b) Konformität | 184 | ||
| c) Groupthink | 188 | ||
| (1) Definition von Groupthink | 188 | ||
| (2) Ursachen von Groupthink | 188 | ||
| (3) Symptome und Folgen von Groupthink | 190 | ||
| d) Zusammenfassung | 194 | ||
| 4. Teilautonome Arbeitsgruppe als Konkretisierung von Gruppenarbeit | 198 | ||
| a) Modell der Teilautonomen Arbeitsgruppe | 198 | ||
| b) Teilautonome Arbeitsgruppe im Kontext der Popperschen Gesellschaftskonzeption | 203 | ||
| (1) Teilautonome Arbeitsgruppe als Medium der Sekundärsozialisation (sozialisationstheoretische Sicht) | 206 | ||
| (2) Teilautonome Arbeitsgruppe als kollektive Realitätskonstruktion (Sicht der kognitiven Organisationstheorie) | 208 | ||
| (3) Teilautonome Arbeitsgruppe und soziale Primärbedürfnisse (soziodynamische Sicht) | 213 | ||
| c) Teilautonomie als Schritt in die offene Gesellschaft? | 217 | ||
| 5. Fazit | 220 | ||
| D. Schlußbetrachtung: “Offene” versus “geschlossene” Organisation als Optionen? | 228 | ||
| Literaturverzeichnis | 237 |
