Die aufgedrängte Bereicherung
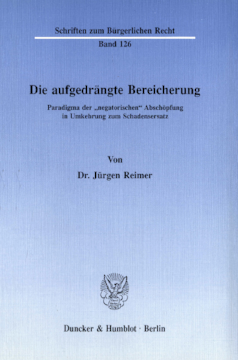
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die aufgedrängte Bereicherung
Paradigma der »negatorischen« Abschöpfung in Umkehrung zum Schadensersatz
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 126
(1990)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung | 17 | ||
| Kapitel 1: Der materiale Grund für die Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung und seine präjudizielle Bedeutung für die Fälle der aufgedrängten Bereicherung | 22 | ||
| 1. Abschnitt: Die aufgedrängte Bereicherung aus der gesetzgeberischen Sichtweise einer „negatorischen“ Abschöpfung ungerechtfertigter Vermögensvorteile im Rahmen der Einheitslehre | 22 | ||
| I. Die Lehre Savignys und die Ausgestaltung des Rechts der ungerechtfertigten Bereicherung durch den Gesetzgeber | 22 | ||
| II. Grundlegende Konsequenzen der gesetzgeberischen Sichtweise für die aufgedrängte Bereicherung | 25 | ||
| 1. Irrelevanz der Bereicherungsursache für die Haftungsbegründung und den Haftungsumfang | 25 | ||
| 2. Verbleibende Problematik der Wertberechnung unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit von Dispositionsänderungen | 26 | ||
| 2. Abschnitt: Die Auflösung des einheitlichen materialen Grundes der Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung in disharmonische Regelungsziele im Rahmen der Trennungslehre | 29 | ||
| I. Entwicklung und Aussagen der Trennungslehre | 29 | ||
| II. Kritik an der „modernen“ Bereicherungslehre | 31 | ||
| 3. Abschnitt: Verfehlte Konsequenzen der „modernen“ Bereicherungslehre für die aufgedrängte Bereicherung | 35 | ||
| I. Gegenstands- oder Vermögensorientierung des Bereicherungsanspruchs unter Vergleich der analogen Problematik im Schadensersatzrecht | 35 | ||
| 1. Problemstellung der Gegenstands- oder Vermögensorientierung und ihre Relevanz für die aufgedrängte Bereicherung | 35 | ||
| 2. Die Naturalrestitution als Argument für die Gegenstandsorientierung im Schadensersatz- und im Bereicherungsrecht? | 38 | ||
| (a) Zur Vergleichbarkeit zwischen Schadensersatz- und Bereicherungsrecht | 39 | ||
| (b) Überlagerung von Gegenstands- und Vermögensorientierung im Schadensersatz- und im Bereicherungsrecht | 40 | ||
| 3. Der Geldersatz als Argument für die Vermögensorientierung? | 43 | ||
| 4. Überlagerung von Gegenstands- und Vermögensorientierung im Bereicherungsrecht aus der Sicht des historischen Gesetzgebers | 45 | ||
| II. Schlußfolgerungen aus der Kontroverse Gegenstands- oder Vermögensorientierung des Bereicherungsanspruchs auf die Bestimmung des Wertersatzes nach § 818 II BGB | 47 | ||
| 1. Schlußfolgerungen aus der Kontroverse Gegenstands- oder Vermögensorientierung des Bereicherungsanspruchs auf die Bestimmung des erlangten Etwas und seine präjudizielle Bedeutung für die Bestimmung des Wertersatzes | 47 | ||
| 2. Bedürfnis nach einem bereicherungsrechtsspezifischen Dispositionsschutz? | 52 | ||
| (a) Meinungsstand | 52 | ||
| (b) Vergleichende Betrachtung zum Dispositionsschutz im Schadensersatzrecht und beim Betrugstatbestand | 54 | ||
| (c) Differenzierung nach in der Vergangenheit liegenden Dispositionsstörungen und der Obliegenheit zur zukünftigen Dispositionsänderung | 56 | ||
| (d) Der unterschiedliche Stellenwert des Dispositionsschutzes im Rahmen des jeweiligen bereicherungsrechtlichen Grundverständnisses | 59 | ||
| 3. Die unterschiedliche Berechnung des Wertersatzes nach § 818 II BGB auf der Grundlage der Kontroverse um eine Gegenstands- oder Vermögensorientierung des Bereicherungsanspruchs | 59 | ||
| (a) Meinungsstand zur Kontroverse objektiver-subjektiver Wertbegriff | 59 | ||
| (aa) Wertersatz nach objektiven Kriterien | 61 | ||
| (bb) Wertersatz nach subjektiven Kriterien | 62 | ||
| (b) Wortlaut des § 818 II BGB | 65 | ||
| (c) Die Sicht des Gesetzgebers | 66 | ||
| (d) Zur Überlagerung von Gegenstands- und Vermögensorientierung bei teleologischer Auslegung des § 818 II BGB | 67 | ||
| (e) Konsequenzen der Überlagerung von gegenstands- und vermögensorientierter Betrachtungsweise auf die Beweislastverteilung | 68 | ||
| 4. Die unterschiedliche Bestimmung des maßgeblichen Zeitpunktes für die Wertermittlung auf der Grundlage der Kontroverse um eine Gegenstands- oder Vermögensorientierung des Bereicherungsanspruchs | 70 | ||
| (a) Meinungsstand | 70 | ||
| (aa) Entstehung des Bereicherungsanspruchs bzw. des Wertersatzanspruchs aus gegenstandsorientierter Betrachtungsweise | 71 | ||
| (bb) Eintritt der Bösgläubigkeit oder Rechtshängigkeit | 72 | ||
| (cc) Bezahlung – letzte mündliche Verhandlung aus vermögensorientierter Betrachtungsweise | 73 | ||
| (b) Der maßgebliche Zeitpunkt für die Wertermittlung auf der Grundlage einer Überlagerung von gegenstands- und vermögensorientierter Betrachtungsweise in Parallele zum Schadensersatzrecht | 74 | ||
| 5. Die Begrenzung des Bereicherungsanspruchs bei der aufgedrängten Bereicherung auf die getätigten Aufwendungen als Paradigma der Verkennung der bereicherungsrechtlichen Abschöpfungsfunktion | 79 | ||
| 6. Die Problematik der Änderung der Verwendungsplanung des Bereicherungsschuldners nach rechtskräftigem Urteil | 80 | ||
| (a) Problemstellung und Meinungsstand | 80 | ||
| (b) Vergleich zum Schadensersatzrecht | 82 | ||
| 4. Abschnitt: Zusammenfassung der Ergebnisse des 1. Kapitels | 85 | ||
| Kapitel 2: Die Lösung des Problems der aufgedrängten Bereicherung durch die „negatorische“ Abschöpfung ungerechtfertigter Vermögensvorteile im Gegensatz zum Schadensersatzrecht | 87 | ||
| 1. Abschnitt: Überlagerung der bereicherungsrechtlichen Haftung des aufgedrängt Bereicherten und der deliktischen Haftung des Bereichernden bei schuldhafter Umgestaltung einer Sache | 87 | ||
| I. Haftungsmäßige Verrechnung von Vor- und Nachteilen bei Ansprüchen des aufdrängend Bereichernden aus § 812 I BGB und des aufgedrängt Bereicherten aus § 823 I BGB | 87 | ||
| II. Schlußfolgerung auf grundsätzliche Gemeinsamkeiten des Berechnungsmodus von Schaden und Bereicherung | 91 | ||
| 2. Abschnitt: Das Zusammenspiel von § 818 II und § 818 III BGB in seinen speziellen Konsequenzen für die aufgedrängte Bereicherung | 93 | ||
| I. Funktion des § 818 II BGB | 93 | ||
| II. Die Limitierung einer verkehrswertorientierten Wertersatzpflicht durch den nach subjektsorientierten Kriterien zu bestimmenden Eintritt einer „Vermögensminderung“ | 94 | ||
| 3. Abschnitt: Die sinngemäße Übertragung der schadensersatzrechtlichen Lösung in § 254 II 1, 2. Alt. BGB auf das Bereicherungsrecht und ihre Konsequenzen für die aufgedrängte Bereicherung | 97 | ||
| I. Zur Anwendbarkeit des dem § 254 II 1, 2. Alt. BGB zugrundeliegenden Rechtsgedankens auf das Bereicherungsrecht und speziell auf die aufgedrängte Bereicherung | 97 | ||
| II. Vermeidung von Rechtsunsicherheit bei Änderung der subjektiven Verwendungsplanungen des aufgedrängt Bereicherten | 98 | ||
| III. Einzelaspekte zur Frage der Zumutbarkeit von Dispositionsänderungen in Analogie zu § 254 II 1, 2. Alt. BGB | 100 | ||
| 1. Zur Relevanz des Wertverhältnisses | 100 | ||
| (a) Problemstellung anhand eines Beispielfalles | 100 | ||
| (b) Entsprechende Problematik bei den §§ 946 ff BGB | 101 | ||
| (c) Die Problematik der Unmöglichkeit der Herausgabe des erlangten Etwas nach § 818 II BGB bei gravierendem Wertzuwachs | 102 | ||
| 2. Zur Relevanz des Affektionsinteresses des Bereicherten | 106 | ||
| (a) Irrelevanz des Affektionsinteresses des Bereicherten nach der herrschenden Lehre | 106 | ||
| (b) Relevanz des Affektionsinteresses bei der Gesamtabwägung analog § 254 II 1, 2. Alt. BGB | 107 | ||
| 3. Zur Relevanz eines Verschuldens des Bereicherungsgläubigers im Hinblick auf das Aufdrängen der Bereicherung | 109 | ||
| (a) Die Relevanz eines Verschuldens des Bereicherungsgläubigers im Rahmen von Kondiktionssperren auf der Grundlage der herrschenden Lehre | 109 | ||
| (b) Abgestufte Relevanz eines Verschuldens des Bereicherungsgläubigers im Rahmen der Gesamtabwägung analog § 254 II 1, 2. Alt. BGB | 110 | ||
| 4. Zur Relevanz der Kenntnis des Bereicherungsschuldners von der aufgedrängten Bereicherung | 112 | ||
| (a) Interpretation des § 818 III BGB als Privileg für den Gutgläubigen auf der Grundlage der herrschenden Lehre | 112 | ||
| (b) Relevanz der Kenntnis des Bereicherungsschuldners bei Verstößen gegen die Obliegenheit zur Warnung und der Möglichkeit der Abwendung der Bereicherung im Rahmen der Gesamtabwägung in Analogie zu § 254 II 1, 2. Alt. BGB | 113 | ||
| 5. Zur Relevanz der Unterscheidung zwischen bloßen Dispositionsänderungen und Funktionsänderungen des Eigentums | 115 | ||
| 6. Zur Relevanz der Unterscheidung zwischen Umgestaltungsmaßnahmen und bloßen Erhaltungs-, Verbesserungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen | 115 | ||
| 7. Zur Relevanz der Fungibilität des von der Bereicherung betroffenen Gegenstandes | 116 | ||
| 8. Zur Relevanz der sozialen Stellung und der wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten | 117 | ||
| 4. Abschnitt: Zusammenfassung der Ergebnisse des 2. Kapitels | 119 | ||
| Kapitel 3: Die Sanktionierung des „Aufdrängens“ im Spannungsfeld zwischen Bereicherungsrecht und gesetzgeberischen Wertentscheidungen außerhalb der §§ 812, 818 BGB | 122 | ||
| 1. Abschnitt: Die Sanktionierung des „Aufdrängens“ im Streit zwischen den jeweiligen bereicherungsrechtlichen Grundpositionen | 122 | ||
| 2. Abschnitt: Analoge Anwendung des § 814 BGB | 125 | ||
| I. Befürwortende Stellungnahmen in der Lehre | 125 | ||
| II. Die Ungeeignetheit des § 814 BGB zur Lösung der Fälle der aufgedrängten Bereicherung | 127 | ||
| 1. Rechtsfolgenbetrachtung | 127 | ||
| 2. § 814 BGB als Sonderform des Verzichts? | 127 | ||
| 3. § 814 BGB als Ausprägung des Verbots des venire contra factum proprium | 128 | ||
| (a) Parallele zur Leistung | 128 | ||
| (b) Positive Kenntnis | 129 | ||
| (c) Parallele zum Tatbestandsmerkmal „das zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit Geleistete“ | 130 | ||
| III. Die Geltung des Verbots des venire contra factum proprium bei der aufgedrängten Bereicherung | 131 | ||
| 3. Abschnitt: Kondiktionsausschluß über § 687 II BGB | 133 | ||
| I. Verwendungskondiktion | 133 | ||
| 1. § 687 II BGB als Kondiktionssperre auf der Grundlage der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre | 133 | ||
| 2. Kritische Stellungnahme | 135 | ||
| (a) Konkurrenzverhältnis zwischen § 687 II BGB und § 812 BGB | 135 | ||
| (b) Kritik an der Limitierung des Bereicherungsanspruchs auf die getätigten Aufwendungen | 136 | ||
| (c) Das Wahlrecht des Geschäftsherrn nach § 687 II 2 BGB zwischen Aufwendungsersatz und Abschöpfungskondiktion | 137 | ||
| II. Rückgriffskondiktion | 141 | ||
| 1. Die Argumentation der Rechtsprechung und der herrschenden Meinung mit den §§ 404, 406 BGB und § 267 BGB | 141 | ||
| 2. Kritische Stellungnahme | 142 | ||
| (a) Kritik an der Argumentation mit den §§ 404, 406 ff BGB | 142 | ||
| (b) Kritik an der Argumentation mit § 267 BGB | 143 | ||
| (c) Fehlende Auseinandersetzung innerhalb der herrschenden Meinung mit § 687 II 2 BGB | 144 | ||
| 3. Die Lösung der Rückgriffskondiktion mit dem Ersparnisgedanken | 146 | ||
| 4. Abschnitt: Kondiktionsausschluß über § 996 BGB | 152 | ||
| I. § 996 BGB als Kondiktionssperre auf der Grundlage der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre | 152 | ||
| II. Uneingeschränkte Anwendbarkeit der §§ 812 ff BGB neben den §§ 994 ff BGB aufgrund des unterschiedlichen materialen Haftungsgrundes | 155 | ||
| 5. Abschnitt: Gegenanspruch des Bereicherten aus § 1004 I BGB | 160 | ||
| I. Der Schutz des aufgedrängt Bereicherten über § 1004 I BGB auf der Grundlage der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre | 160 | ||
| II. Die Unanwendbarkeit des § 1004 I BGB bei den Fällen der aufgedrängten Bereicherung auf der Grundlage der Position Pickers | 163 | ||
| 6. Abschnitt: Verweis auf die Wegnahmemöglichkeit in Analogie zu § 1001 S 2 BGB | 166 | ||
| I. Analoge Anwendung des § 1001 S 2 BGB in BGHZ 23, 61 | 166 | ||
| II. Untauglichkeit des § 1001 S 2 BGB zur Lösung des Problems der aufgedrängten Bereicherung aufgrund der ratio legis des § 1001 S 2 BGB | 166 | ||
| 7. Abschnitt: Verweis auf die Wegnahmemöglichkeit in Restriktion des § 951 I BGB | 168 | ||
| I. Abwendung des Bereicherungsanspruchs des aufdrängend Bereichernden durch Verweis auf die Wegnahmemöglichkeit im Rahmen einer Restriktion des § 951 I BGB | 168 | ||
| II. Die in der Lehre geübte Kritik an der Restriktion des § 951 I BGB zur Lösung der aufgedrängten Bereicherung | 169 | ||
| III. Ablehnende Stellungnahme zur Restriktion des § 951 I BGB aufgrund der Irrelevanz des Bereicherungsvorgangs für die bereicherungsrechtliche Haftungsbegründung | 170 | ||
| 8. Abschnitt: Ergebnis: Bereicherungsrechtliche Lösung statt Sanktionierung des „Aufdrängens“ der Bereicherung | 174 | ||
| Zusammenfassung | 175 | ||
| Schrifttum | 179 |
