Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen
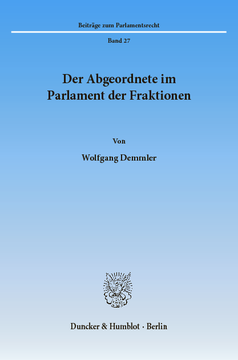
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen
Beiträge zum Parlamentsrecht, Vol. 27
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einleitung | 23 | ||
| 1. Der Untersuchungsgegenstand | 23 | ||
| 2. Der historische Bezug und die Aktualität der Problemstellung | 27 | ||
| a) Der Streit um die fortbestehende Bedeutung des freien Mandats | 27 | ||
| b) Der aktuelle Anlaß | 29 | ||
| 3. Abgeordneter und Fraktion in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 31 | ||
| a) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Kompetenzen des Abgeordneten und der Fraktion im parlamentarischen Prozeß | 32 | ||
| b) Die weiteren inhaltlichen Stellungnahmen des Bundesverfassungsgerichts | 35 | ||
| c) Die Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung | 37 | ||
| 4. Der Gang der Darstellung | 39 | ||
| 1. Kapitel: Der Status des Abgeordneten nach dem Grundgesetz | 41 | ||
| § 1 Der Abgeordnete als Amtsträger | 41 | ||
| 1. Die Unterscheidung von Mandatsfreiheit und Grundrecht in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 42 | ||
| 2. Die Parallelen zum Grundrechtsdenken im Schrifttum | 43 | ||
| a) Das “Diätenurteil” als vermeintliche Bestätigung des Grundrechtscharakters der Abgeordnetenstellung | 44 | ||
| b) Die Bedenken gegen die Eingliederung des Abgeordneten in die institutionalisierte Staatlichkeit | 46 | ||
| aa) Begriffliche Einwände | 46 | ||
| bb) Verfassungstheoretische Einwände | 47 | ||
| 3. Die Konsequenzen aus dem Amtscharakter des Mandats | 50 | ||
| a) Die Amtswalterrechte als Kompetenzen | 50 | ||
| b) Das freie Mandat als Umschreibung der Pflichtenstellung des Abgeordneten | 51 | ||
| aa) Die ausdrückliche Normierung von Pflichten in den Landesverfassungen | 51 | ||
| bb) Die Pflichten als Inhalt der Verbürgung des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG auf Bundesebene | 52 | ||
| 4. Die Notwendigkeit des Festhaltens am Amtsgedanken zur Begründung der Gemeinwohlbindung des Abgeordneten | 54 | ||
| § 2 Die Bedeutung des freien Mandats in einer von Parteien geprägten Demokratie | 55 | ||
| 1. Die Relevanz der Fragestellung | 55 | ||
| 2. Die Theorie des Parteienstaats von Gerhard Leibholz | 56 | ||
| a) Darstellung | 56 | ||
| b) Kritik | 58 | ||
| aa) Die Verengung des Begriffs der Repräsentation | 58 | ||
| bb) Der angeblich identitäre Charakter des Parteienstaats | 59 | ||
| cc) Die einseitige Sicht des Abgeordneten als bloßem Parteivertreter | 60 | ||
| dd) Die Überbewertung des plebiszitären Elements der Wahl | 61 | ||
| 3. Der Vorrang des Art. 38 GG? | 63 | ||
| a) Art. 21 GG als ausschließlich auf den gesellschaftlichen Bereich bezogene Norm | 63 | ||
| b) Art. 38 GG als lex specialis zu Art. 21 GG | 64 | ||
| 4. Die aktuelle Bedeutung des freien Mandats | 66 | ||
| a) Praktische Konkordanz von Art. 21 GG und Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 66 | ||
| b) Das freie Mandat als Garant innerparteilicher Demokratie | 67 | ||
| c) Das freie Mandat als Sicherung parlamentarischer Flexibilität | 68 | ||
| d) Das freie Mandat als Grundlage persönlicher Verantwortung | 69 | ||
| § 3 Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes | 72 | ||
| 1. Repräsentation als zentraler Begriff | 72 | ||
| a) Der Wille des Parlaments als hypothetischer Volkswille? | 72 | ||
| b) Repräsentation als formale und inhaltliche Kategorie | 73 | ||
| c) Die inhaltliche Repräsentation als Hauptaufgabe des einzelnen Abgeordneten | 77 | ||
| d) Repräsentation in Abgrenzung zur Vertretung | 80 | ||
| 2. Kollektivrepräsentation oder Individualrepräsentation | 81 | ||
| a) Die Kollektivrepräsentation in der Literatur | 82 | ||
| aa) Verfassungsrechtliche Begründung und Konsequenzen | 82 | ||
| bb) Kritik | 84 | ||
| b) Die Kollektivrepräsentation in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 89 | ||
| aa) Die bisherigen Stellungnahmen des Bundesverfassungsgerichts | 89 | ||
| bb) Die Kollektivrepräsentation als angemessene Form der formalen Repräsentation | 92 | ||
| § 4 An Aufträge und Weisungen nicht gebunden | 96 | ||
| 1. Aufträge und Weisungen | 96 | ||
| 2. Die rechtliche Unverbindlichkeit von Aufträgen und Weisungen | 97 | ||
| a) Die Bewahrung der Unverbindlichkeit als Gebot an die Rechtsordnung | 98 | ||
| b) Die Konsequenzen für die Ausgestaltung der Geschäftsordnung des Bundestages | 99 | ||
| 3. Die rechtliche Unzulässigkeit von Aufträgen und Weisungen | 102 | ||
| a) Aufträge und Weisungen als Aufforderung zu verfassungswidrigem Verhalten | 102 | ||
| b) Das Streben nach Geschlossenheit als funktionell notwendiges Anliegen der Fraktionen | 105 | ||
| c) Das Verbot mißbräuchlicher Einflußnahme | 108 | ||
| d) Die Androhung von Sanktionen als Merkmal unzulässigen Fraktionszwangs | 111 | ||
| e) Die Anforderungen an die Fraktionsgeschäftsordnungen | 116 | ||
| § 5 Und nur ihrem Gewissen unterworfen | 122 | ||
| 1. Der Gewissensbegriff des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 122 | ||
| 2. Die Gewissensunterworfenheit als Richtschnur parlamentarischen Verhaltens | 127 | ||
| 3. Die Subjektivierung der Entscheidung | 129 | ||
| a) Die Unüberprüfbarkeit nach objektiven Kriterien | 129 | ||
| b) Die Vereinbarkeit der Fraktionsdisziplin mit der Gewissensunterworfenheit | 131 | ||
| § 6 Die Gleichheit der Abgeordneten | 134 | ||
| 1. Die verfassungsrechtliche Grundlage | 134 | ||
| a) Die Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) | 134 | ||
| b) Die Anwendung der Wahlrechtsgleichheit (Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG) | 136 | ||
| c) Die Anwendung des Prinzips der repräsentativen Demokratie (Art. 20 Abs. 2 GG) | 141 | ||
| 2. Die inhaltliche Bedeutung der Gleichheit | 144 | ||
| a) Die Gleichheit als Gewährleistung von Freiheit | 144 | ||
| b) Die Gleichheit als Begrenzung von Freiheit | 147 | ||
| 2. Kapitel: Der Status der Fraktionen nach dem Grundgesetz | 149 | ||
| § 7 Die Vormachtstellung der Fraktionen im historischen Überblick | 149 | ||
| 1. Die Fraktionen in der Frankfurter Nationalversammlung | 150 | ||
| 2. Die Fraktionen im Preußischen Abgeordnetenhaus | 152 | ||
| 3. Die Fraktionen im Reichstag | 154 | ||
| 4. Fazit | 155 | ||
| § 8 Die Fraktion als Instrument zur effektiven Wahrnehmung von Abgeordnetenrechten | 156 | ||
| 1. Die Funktionen der Fraktion in bezug auf den einzelnen Abgeordneten | 156 | ||
| a) Die technischen Hilfen | 156 | ||
| b) Die Bereitstellung politisch aufbereiteter Informationen und Entscheidungshilfen | 157 | ||
| c) Die Potenzierung der Mitwirkungsmöglichkeiten durch ein System wechselseitiger Beeinflussung | 158 | ||
| 2. Die verfassungsrechtliche Verankerung der Fraktion in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 160 | ||
| a) Das Koalitionsrecht als Element des Abgeordnetenstatus | 160 | ||
| b) Die Anerkennung der Fraktion in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 162 | ||
| 3. Die Konsequenzen aus der Verankerung der Fraktionen in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 163 | ||
| a) Die Freiheit der Fraktionen | 163 | ||
| b) Die Gleichheit der Fraktionen | 165 | ||
| § 9 Die Fraktion als Einrichtung zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Parlaments | 166 | ||
| 1. Die Bedeutung der Fraktion für den äußeren Ablauf der Parlamentsarbeit | 166 | ||
| a) Die Notwendigkeit einer Auswahl der vom Parlament zu behandelnden Themen | 166 | ||
| b) Die Bindung von Befugnissen an die Fraktion als Auswahlkriterium von hoher Rationalität | 169 | ||
| 2. Die Bedeutung der Fraktion für die inhaltliche Güte der Parlamentsarbeit | 171 | ||
| a) Der gestufte Prozeß der Mehrheitsbildung | 171 | ||
| b) Die Klammerfunktion der Fraktion | 173 | ||
| 3. Die verfassungsrechtliche Verankerung der Fraktion in Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG? | 176 | ||
| § 10 Die Fraktion als parlamentarische Vertretung einer politischen Partei | 179 | ||
| 1. Die enge Verbindung zwischen den Fraktionen und den politischen Parteien | 180 | ||
| a) Die gleiche Parteizugehörigkeit als ausschlaggebender Faktor der Fraktionsbildung | 180 | ||
| b) Die Fraktion als Instrument zur Durchsetzung parteipolitischer Zielsetzungen | 181 | ||
| c) Weitere Berührungspunkte | 183 | ||
| 2. Die Eigenständigkeit der Fraktionen gegenüber den politischen Parteien | 184 | ||
| a) Die Einfügung der Fraktionen in den staatsorganschaftlichen Bereich | 184 | ||
| b) Der mangelnde Einfluß der Parteien auf das Zustandekommen der Fraktionen | 185 | ||
| c) Die fehlende Übereinstimmung von Partei- und Fraktionsmitgliedschaft in der Praxis des Bundestages | 186 | ||
| d) Die Möglichkeit parteiübergreifender Fraktionsbildungen | 188 | ||
| e) Die rechtliche Freiheit der Fraktion bei der Umsetzung parteipolitischer Zielsetzungen | 190 | ||
| 3. Die verfassungsrechtliche Verankerung der Fraktion in Art. 21 GG? | 192 | ||
| § 11 Die Rechtsnatur der Fraktionen | 195 | ||
| 1. Die Bedeutung der Fragestellung | 195 | ||
| a) Keine Auswirkungen auf die verfassungsrechtliche Stellung der Fraktionen | 195 | ||
| b) Die Relevanz für die Teilnahme der Fraktionen am allgemeinen Rechtsverkehr | 196 | ||
| 2. Stellungnahme zu den in der Literatur entwickelten Modellen | 197 | ||
| a) Die Fraktionen als Organe der Parteien | 197 | ||
| b) Die Fraktionen als Organe des Parlaments | 198 | ||
| aa) Die fehlende Zurechnung der Tätigkeit der Fraktionen | 198 | ||
| bb) Der Vergleich mit den Ausschüssen | 199 | ||
| cc) Keine Stütze in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 201 | ||
| c) Die Fraktionen als Staatsorgane sui generis | 202 | ||
| d) Die Fraktionen als Vereinigungen von Abgeordneten | 202 | ||
| aa) Auf der Grundlage des Bürgerlichen Rechts | 203 | ||
| bb) Auf der Grundlage des Öffentlichen Rechts | 205 | ||
| (1) Körperschaften des Öffentlichen Rechts | 205 | ||
| (2) Vereine des Öffentlichen Rechts | 206 | ||
| 3. Die mangelnde Notwendigkeit einer Bestimmung der Rechtsnatur | 206 | ||
| § 12 Die Zugehörigkeit zu der gleichen politischen Partei | 210 | ||
| 1. Der Maßstab einer verfassungsrechtlichen Beurteilung | 210 | ||
| 2. Die politische Homogenität als Wesensmerkmal der Fraktion | 211 | ||
| 3. Die Vermutung politischer Homogenität bei gleicher Parteizugehörigkeit | 213 | ||
| 4. Das Zustimmungserfordernis als Vorkehrung zur Verhinderung mißbräuchlicher Fraktionszusammenschlüsse | 214 | ||
| 5. Die Konsequenzen für die Geschäftsordnungen der Länderparlamente | 216 | ||
| § 13 Die Fraktionsmindeststärke | 219 | ||
| 1. Die Mindeststärke als durchgängige Voraussetzung jeder Fraktionsbildung | 219 | ||
| a) Historische Betrachtung | 219 | ||
| b) Der Vergleich mit den Regelungen in den Länderparlamenten | 220 | ||
| 2. Die Mindeststärke als notwendige Voraussetzung jeder Fraktionsbildung | 223 | ||
| 3. Die praktische Relevanz der Problematik | 224 | ||
| 4. Die Festlegung der Mindeststärke als Gegenstand der Geschäftsordnungsautonomie | 226 | ||
| a) Der Gestaltungsspielraum des Parlaments | 226 | ||
| b) Die Ableitung einer Obergrenze aus Art. 53 a GG? | 228 | ||
| 5. Die Grenzen der Geschäftsordnungsautonomie: Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs | 231 | ||
| a) Kein Ausschluß der Autonomie durch die Fraktion als “Partei im Parlament” | 231 | ||
| b) Vier verfassungsrechtliche Vorgaben | 233 | ||
| aa) Der Kernbereich des Mandats | 233 | ||
| bb) Das Übermaßverbot | 235 | ||
| cc) Oppositionsfreiheit und Minderheitenschutz | 236 | ||
| dd) Die Gleichheit der Abgeordneten | 238 | ||
| 6. Der formalisierte Gleichheitssatz als zutreffender Prüfungsmaßstab | 239 | ||
| a) Die Gleichheit der Abgeordneten als Anknüpfungspunkt | 239 | ||
| b) Die Bedeutung der wahlrechtlichen Sperrklausel für die Fraktionsmindeststärke | 240 | ||
| c) Schlußfolgerungen für die konkrete Festsetzung der Mindeststärke durch das Parlament | 242 | ||
| § 14 Der Fraktionsausschluß | 245 | ||
| 1. Die verfassungsrechtliche Relevanz der Problemstellung | 245 | ||
| 2. Der Fraktionsausschluß als Pendant des Fraktionsaustritts | 246 | ||
| a) Freiwilligkeit des Fraktionsbeitritts und Möglichkeit des Fraktionsaustritts | 246 | ||
| b) Freiwilligkeit der Aufnahme in die Fraktion und Möglichkeit des Fraktionsausschlusses | 247 | ||
| 3. Die materiellen Anforderungen an den Fraktionsausschluß | 249 | ||
| a) Der Fraktionsausschluß nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes | 249 | ||
| aa) Die Notwendigkeit einer Rechtfertigung vor Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 249 | ||
| bb) Die gerichtliche Kontrolldichte | 251 | ||
| b) Die konkreten Folgerungen aus der Annahme eines Beurteilungsspielraums | 252 | ||
| aa) Keine Akzessorietät zum Parteiausschluß | 252 | ||
| bb) Jedes Verhalten des Abgeordneten als möglicher Anknüpfungspunkt für den Ausschluß | 254 | ||
| 4. Die Kontrollmöglichkeiten durch die Gerichte | 255 | ||
| a) Die verfahrensrechtlichen Anforderungen | 256 | ||
| b) Der zutreffende Sachverhalt | 257 | ||
| c) Der Ausschluß sachfremder Motive | 257 | ||
| 5. Fazit | 257 | ||
| 3. Kapitel: Die Verteilung der parlamentarischen Befugnisse zwischen Abgeordnetem und Fraktion | 259 | ||
| § 15 Die konstruktive Begründung der Rechte von Fraktionen | 259 | ||
| 1. Eigene Rechte der Fraktionen nach der Geschäftsordnung | 259 | ||
| 2. Die Möglichkeiten einer verfassungsrechtlichen Begründung von Fraktionsrechten | 261 | ||
| 3. Die drei Begründungsmöglichkeiten im einzelnen | 263 | ||
| a) Originäre Rechte der Fraktionen nach dem Grundgesetz | 263 | ||
| b) Den Fraktionen zugewiesene Rechte des Bundestages | 266 | ||
| c) Den Abgeordneten entzogene Rechte | 269 | ||
| § 16 Der Kernbereich des Abgeordnetenmandats als Mindestbestand an Befugnissen | 273 | ||
| 1. Die Anerkennung des Kernbereichs in der Rechtsprechung | 273 | ||
| 2. Das Problem der Begrenzung des Kernbereichs | 275 | ||
| 3. Der Auftrag zur inhaltlichen Repräsentation als Begründung des Kernbereichs | 278 | ||
| 4. Die generelle Zuständigkeit des Abgeordneten beim Fehlen einer besonderen Zuweisung | 279 | ||
| 5. Der Kernbereich des Mandats als Gewährleistung eines Anteils an allen Funktionen des Parlaments | 282 | ||
| § 17 Die Kompetenzverteilung zwischen Abgeordnetem und Fraktion außerhalb des Kernbereichs | 286 | ||
| 1. Das Gebot der Abwägung bei der Verteilung der Zuständigkeiten | 286 | ||
| a) Keine Festlegung auf eine strenge Verhältnismäßigkeitskontrolle durch den Eingriffscharakter von Fraktionsrechten | 286 | ||
| b) Das Abwägungsgebot als sachgerechte Schranke der parlamentarischen Geschäftsordnungsautonomie | 287 | ||
| c) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 290 | ||
| 2. Das Gewicht der Freiheit des Abgeordneten in der Abwägung | 293 | ||
| a) Die Abhängigkeit von der jeweiligen Funktion des Bundestages | 293 | ||
| aa) Die Gegenüberstellung von Staatsleitung und Kontrolle | 294 | ||
| bb) Die vier Grundfunktionen des Parlaments | 295 | ||
| b) Die Folgerungen aus der Rückführung der Mitwirkungsbefugnisse auf die zugehörigen Parlamentsfunktionen | 297 | ||
| § 18 Das Verhältnis von Fraktions- und Quorumsrechten | 300 | ||
| 1. Die Forderung nach einem Quorumsrecht in Höhe der Fraktionsmindeststärke neben dem Fraktionsrecht | 300 | ||
| a) Die Ableitung aus dem formalisierten Gleichheitssatz | 300 | ||
| b) Die Ableitung aus der Abgeordnetenfreiheit | 301 | ||
| 2. Die Situation im Bundestag | 303 | ||
| 3. Die Situation in den Länderparlamenten | 305 | ||
| 4. Ein Rechtfertigungsversuch in der Literatur | 311 | ||
| § 19 Die prozessualen Konsequenzen des Modells der Zuständigkeitsverteilung | 314 | ||
| 1. Die Geltendmachung von Rechten des Bundestages durch den einzelnen Abgeordneten | 314 | ||
| a) Der Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anhand der einschlägigen Normen des Verfassungsprozeßrechts | 314 | ||
| b) Kritische Würdigung der Rechtsprechung | 317 | ||
| c) Die Antragsbefugnis des Abgeordneten als notwendige Konsequenz der Zuständigkeitsverteilung | 319 | ||
| 2. Die Antragsbefugnis der Fraktionen | 321 | ||
| 3. Die Geltendmachung der Rechte der Fraktion durch den fraktionsangehörigen Abgeordneten | 325 | ||
| 4. Kapitel: Die Konsequenzen aus der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Abgeordnetem und Fraktion für die einzelnen Parlamentsfunktionen | 329 | ||
| I. Die Gesetzgebungsfunktion | 329 | ||
| § 20 Das Recht zur Gesetzesinitiative | 329 | ||
| 1. Das Initiativrecht als Bestandteil des Kernbereichs? | 329 | ||
| 2. Art. 76 Abs. 1 GG als Ausschluß eines Initiativrechts des einzelnen Abgeordneten? | 331 | ||
| 3. Das kollektive Initiativrecht als angemessene Entscheidung der Geschäftsordnung | 333 | ||
| § 21 Die Besetzung der Bundestagsausschüsse | 337 | ||
| 1. Die Problemstellung | 337 | ||
| 2. Die Benennung der Ausschußmitglieder durch die Fraktionen als eine dem Bundestag zurechenbare Besetzung der Ausschüsse? | 339 | ||
| 3. Die verfassungsrechtliche Forderung nach einer Wahl der Ausschußmitglieder? | 340 | ||
| a) Der Gedanke der notwendigen demokratischen Legitimation | 341 | ||
| b) Der Vergleich mit anderen Personalentscheidungen des Parlaments | 343 | ||
| 4. Die Vereinbarkeit des Benennungsrechts mit Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 345 | ||
| a) Ein Recht auf Mitwirkung an der Ausschußbesetzung als Kernbereichsrecht? | 345 | ||
| b) Der Stellenwert des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG in der Abwägung | 346 | ||
| c) Die Bedenken gegen die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Ausgestaltung von Ausschußwahlen | 347 | ||
| d) Die sonstigen Probleme bei der praktischen Durchführung einer Wahl | 350 | ||
| e) Die Benennung der Ausschußmitglieder durch die Leitungsorgane des Parlaments? | 352 | ||
| § 22 Das Recht auf Mitgliedschaft in einem Ausschuß | 353 | ||
| 1. Die Mitgliedschaft in einem Ausschuß als Teil des Kernbereichs? | 353 | ||
| 2. Der Anspruch auf Mitgliedschaft in einem Ausschuß als Ergebnis der Abwägung | 356 | ||
| 3. Die Besonderheiten für fraktionslose Abgeordnete | 359 | ||
| a) Der Anspruch auf Mitgliedschaft in einem Ausschuß | 359 | ||
| b) Der Ausschluß fraktionsloser Abgeordneter vom Ausschußstimmrecht | 362 | ||
| aa) Die Umkehr der Rechtfertigungslast durch die Senatsmehrheit | 362 | ||
| bb) Die spiegelbildliche Zusammensetzung der Ausschüsse als Rechtfertigungsgrund? | 363 | ||
| cc) Die Sicherstellung der Mehrheitsfähigkeit als Rechtfertigungsgrund? | 365 | ||
| dd) Die Stellung des Ausschußstimmrechts im gestuften Entscheidungsprozeß | 366 | ||
| c) Die Bestimmung des Ausschusses für fraktionslose Abgeordnete | 368 | ||
| 4. Der Ausschußrückruf | 370 | ||
| § 23 Das Stellen von Änderungsanträgen | 376 | ||
| 1. Die Situation im Bundestag | 376 | ||
| 2. Das Recht zu Änderungsanträgen als Bestandteil des Kernbereichs | 377 | ||
| a) Der Meinungsstand in Rechtsprechung und Literatur | 377 | ||
| b) Stellungnahme | 380 | ||
| 3. Der Vergleich zwischen dem Recht zur Gesetzesinitiative und dem Recht zu Änderungsanträgen | 383 | ||
| 4. Die Konsequenzen für die Geschäftsordnung | 384 | ||
| § 24 Die Einführung geheimer Sachabstimmungen als Mittel zur Sicherung des freien Mandats? | 385 | ||
| 1. Die Lage im Bundestag und die Forderung nach mehr geheimen Abstimmungen | 385 | ||
| 2. Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Einführung geheimer Sachabstimmungen | 387 | ||
| a) Der Grundsatz der Öffentlichkeit (Art. 42 Abs. 1 GG) | 387 | ||
| b) Das Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) | 388 | ||
| 3. Die Einführung geheimer Sachabstimmungen als Abwägungsentscheidung | 390 | ||
| a) Die Schwierigkeiten bei der praktischen Handhabung einer geheimen Sachabstimmung | 391 | ||
| b) Die schwerwiegenden Nachteile geheimer Sachabstimmungen | 392 | ||
| II. Die Wahlfunktion | 394 | ||
| § 25 Das Recht zu Wahlvorschlägen | 394 | ||
| 1. Die Situation im Bundestag | 394 | ||
| 2. Das Wahlvorschlagsrecht als Bestandteil des Kernbereichs? | 396 | ||
| 3. Das Wahlvorschlagsrecht als Gegenstand der Abwägung | 397 | ||
| 4. Die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts | 399 | ||
| 5. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Unterschriftenquorum | 402 | ||
| 6. Die Besonderheiten bei der Wahl des Bundeskanzlers in der 3. Wahlphase gemäß Art. 63 Abs. 4 GG | 403 | ||
| § 26 Die Beteiligung aller Fraktionen an den vom Bundestag zu wählenden Gremien | 406 | ||
| 1. Die praktische Relevanz der Problemstellung | 406 | ||
| 2. Die Präzisierung der Frage | 408 | ||
| 3. Das verfassungsrechtlich geforderte Wahlsystem | 409 | ||
| 4. Die hinreichende Größe des Gremiums | 413 | ||
| a) Das Erfordernis einer alle Fraktionen berücksichtigenden Mitgliederzahl | 413 | ||
| b) Die Ausnahmen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts | 415 | ||
| aa) Die Arbeitsfähigkeit des Parlaments | 416 | ||
| bb) Die Belange des Geheimschutzes | 417 | ||
| c) Die Übertragung des Ergebnisses auf andere Ausschüsse | 419 | ||
| § 27 Die Vertretung aller Fraktionen im Präsidium des Bundestages | 422 | ||
| 1. Die Lage im Bundestag | 422 | ||
| a) Das Wahlverfahren | 422 | ||
| b) Die Anzahl der Vizepräsidenten | 424 | ||
| 2. Die Auseinandersetzung in der 10. und 11. Wahlperiode | 425 | ||
| a) Die Bemühungen der Fraktion DIE GRÜNEN um den Sitz eines Stellvertreters des Präsidenten | 425 | ||
| b) Die Argumentation der Befürworter einer Erweiterung des Präsidiums | 426 | ||
| 3. Stellungnahme | 428 | ||
| III. Die Kontrollfunktion | 432 | ||
| § 28 Das parlamentarische Fragerecht | 432 | ||
| 1. Die verfassungsrechtliche Grundlage | 432 | ||
| a) Die Ableitung aus dem Zitierrecht des Art. 43 Abs. 1 GG | 432 | ||
| b) Die Kritik an dieser Ableitung | 433 | ||
| c) Stellungnahme | 435 | ||
| aa) Die Kontrollfunktion des Bundestages als verfassungsrechtliche Grundlage der Fragerechte | 435 | ||
| bb) Das Verhältnis der im Grundgesetz ausdrücklich benannten Kontrollmittel zu den Fragerechten | 437 | ||
| cc) Die grundsätzliche Antwortpflicht der Bundesregierung | 438 | ||
| 2. Das Fragerecht des einzelnen Abgeordneten als Bestandteil des Kernbereichs | 440 | ||
| 3. Die Lage im Bundestag | 442 | ||
| § 29 Die Kontrollinstrumente der Großen und Kleinen Anfrage | 445 | ||
| 1. Die Ausgangslage im Bundestag | 445 | ||
| 2. Die Große Anfrage | 447 | ||
| 3. Die Kleine Anfrage | 448 | ||
| § 30 Die im Grundgesetz ausdrücklich benannten Kontrollmittel | 453 | ||
| 1. Das Zitierrecht | 454 | ||
| 2. Die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen | 456 | ||
| 3. Das Mißtrauensvotum | 458 | ||
| IV. Die Öffentlichkeitsfunktion | 461 | ||
| § 31 Der Einfluß des Abgeordneten auf die Tagesordnung des Plenums | 461 | ||
| 1. Das Plenum als zentraler Schauplatz der öffentlichen Auseinandersetzung | 461 | ||
| a) Die Diskussion um öffentliche Ausschußsitzungen | 461 | ||
| b) Das Plenum als Forum der Nation | 463 | ||
| 2. Die Aufstellung der Tagesordnung | 465 | ||
| a) Die entscheidende Rolle des Ältestenrats | 465 | ||
| b) Das Verfahren bei Fehlen einer interfraktionellen Vereinbarung | 467 | ||
| 3. Die Mitwirkungsmöglichkeit des einzelnen Abgeordneten bei der Aufstellung der Tagesordnung | 468 | ||
| a) Die Mitwirkung als Element des Kernbereichs? | 468 | ||
| b) Das individuelle Antragsrecht als angemessenes Ergebnis der Abwägung | 469 | ||
| § 32 Das Rederecht des Abgeordneten und seine Begrenzungen | 471 | ||
| 1. Das Rederecht als Bestandteil des Kernbereichs | 471 | ||
| a) Die Ableitung der Redebefugnis aus der Öffentlichkeitsfunktion | 471 | ||
| b) Die Konsequenzen der Zugehörigkeit zum Kernbereich | 472 | ||
| 2. Die Begrenzungen bei der Ausübung des Rederechts | 474 | ||
| a) Die Festlegung einer Gesamtdauer der Aussprache | 475 | ||
| aa) Die grundsätzliche Unbedenklichkeit einer Festlegung der Gesamtdauer | 475 | ||
| bb) Die Unantastbarkeit des Rederechts durch die Festlegung einer Gesamtdauer der Aussprache | 476 | ||
| cc) Die Verteilung der Redezeit auf die Fraktionen | 478 | ||
| (1) Die grundsätzliche Zulässigkeit der Festsetzung von Fraktionsredezeiten | 478 | ||
| (2) Proportionale oder paritätische Bemessung der Fraktionsredezeiten | 479 | ||
| (3) Die Behandlung fraktionsloser und abweichender Abgeordneter | 482 | ||
| b) Der Schluß der Debatte | 484 | ||
| c) Die individuelle Beschränkung der Redezeit | 486 | ||
| aa) Die Notwendigkeit der Gewährleistung einer Mindestrededauer | 486 | ||
| bb) Die Beachtung der Mindestredezeit in der parlamentarischen Praxis | 487 | ||
| cc) Die Bedeutung der Gleichheit der Abgeordneten für die Bemessung der Redezeit | 489 | ||
| Wesentliche Arbeitsergebnisse | 492 | ||
| Literaturverzeichnis | 511 |
