Hypothetische Ermittlungsverläufe im System der Beweisverbote
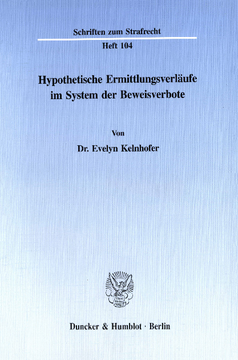
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Hypothetische Ermittlungsverläufe im System der Beweisverbote
Schriften zum Strafrecht, Vol. 104
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einführung | 17 | ||
| Teil A: Hypothesen als strafrechtliches Instrumentarium | 21 | ||
| I. Hypothetik | 21 | ||
| II. Parallele zum materiellen Strafrecht: Die Figur rechtmäßigen Alternativverhaltens bei der objektiven Zurechnung | 22 | ||
| 1. Problemstellung und Systematik | 22 | ||
| 2. Bisher entwickelte Lösungsansätze | 24 | ||
| 3. Kritische Auseinandersetzung: Berücksichtigungsfähigkeit und Beschaffenheit rechtmäßigen Alternativverhaltens | 26 | ||
| a) Zulässigkeit hypothetischer Erwägungen bei der Erfolgs-/Risikozurechnung? | 26 | ||
| b) Art der Berücksichtigung hypothetischer Erwägungen | 27 | ||
| c) Dogmatische Grundlage für die Beachtlichkeit hypothetischer Erwägungen | 28 | ||
| d) Begrenzung zurechnungsrelevanter hypothetischer Erwägungen (Hypothesebildung) | 31 | ||
| e) Überprüfung der gegen die Risikoerhöhungslehre vorgebrachten Einwände | 34 | ||
| aa) Beurteilungsbasis für die Risikoerhöhung | 34 | ||
| bb) Umwandlung der Erfolgsdelikte in Gefährdungsdelikte | 35 | ||
| cc) Verstoß gegen den „in dubio pro reo”– Grundsatz | 37 | ||
| dd) Vereitelung der Demonstrationsfunktion des Erfolgs und Fehlen gesteigert rechtsfriedenstörender Sachverhalte | 40 | ||
| 4. Ergebnis und Anschlußproblem des zur Zurechnung notwendigen Ausmaßes der Risikodifferenz | 42 | ||
| III. Hinführende Beispielfälle zur Hypotheserelevanz im Strafprozeß | 43 | ||
| Teil B: Beweisverbotslehre als dogmatischer Ort hypothetischer Ermittlungsverläufe | 47 | ||
| I. Systematik und Terminologie der Beweisverbote | 47 | ||
| 1. Berechtigung einer „Lehre von den Beweisverboten” | 47 | ||
| 2. Terminologie | 48 | ||
| II. Beweisverbotslehren im einzelnen | 49 | ||
| 1. Unterscheidung zwischen beweisgerichteten und anderen Verboten | 50 | ||
| 2. Revisionsrechtlicher Ansatz (unter Berücksichtigung der Rechtskreistheorie des BGH) | 51 | ||
| 3. Schutzzwecklehren | 54 | ||
| a) Wahrheitsfindung | 55 | ||
| b) Prävention | 56 | ||
| aa) Spezialpräventive Funktion | 56 | ||
| bb) Generalpräventive Funktion | 57 | ||
| cc) Disziplinierung der Strafverfolgungsbehörden | 59 | ||
| c) Schutz der Rechte des einzelnen | 62 | ||
| aa) Sicherung der Individual- und Grundrechte | 62 | ||
| bb) „Fair trial”-Gedanke | 64 | ||
| 4. Abwägungslehre | 66 | ||
| a) Dogmatischer Ansatz | 67 | ||
| b) Kriterien bei der Abwägung | 69 | ||
| c) Verhältnis zur Schutzzwecklehre | 70 | ||
| III. Diskussion und Ergebnis | 71 | ||
| 1. Kritik an der Schutzzwecklehre | 71 | ||
| 2. Legitimation der Abwägungslehre | 73 | ||
| Teil C: Derzeitiger Stand der Diskussion hypothetischer Überlegungen bei der strafprozessualen Verwertbarkeit von Beweismitteln | 81 | ||
| I. Verlaufshypothesen im Rahmen der „begrifflichen Ansätze” | 81 | ||
| II. Praktikabilität hypothetischer Argumentation | 83 | ||
| 1. Feststellungsschwierigkeiten bei der Ermittlung hypothetischer Verläufe | 84 | ||
| 2. Gefahr der Umgehung von Verwertungsverboten | 84 | ||
| 3. Abhängigkeit erfolgreicher Hypothesebildung vom Zufall | 85 | ||
| 4. Unterstellung rechtmäßiger Beweisermittlungsmöglichkeit als Ausgleich für den gesetzlichen Beweismittelverzicht | 86 | ||
| III. Gesetzessystematik und hypothetische Erwägungen | 88 | ||
| 1. Hypothesebildung als der StPO immanentes Element | 88 | ||
| a) Hypotheserelevanz als Grundsatz | 88 | ||
| b) Argument aus den neuen Zufallsfundregelungen | 89 | ||
| 2. Systemfremdheit hypothetischer Überlegungen | 90 | ||
| a) Argument aus §§ 136a III (2), 69 III StPO | 90 | ||
| b) Prinzipien des Revisionsrechts | 91 | ||
| aa) Beweisverwertungsverbote als revisionsrechtliches Institut | 92 | ||
| bb) Unzulässigkeit von Hypothesebildungen aufgrund der Regelung des § 338 StPO | 94 | ||
| cc) Sinnlosigkeit von Hypothesebildungen wegen § 337 StPO | 95 | ||
| c) Vorrang der Nachholung | 96 | ||
| IV. Verknüpfung zwischen Fehler und Beweismittel bzw. Urteil | 99 | ||
| 1. Argument der Kausalität | 99 | ||
| a) Fehlende bzw. überholende Kausalität | 100 | ||
| b) Kausalität als maßgebliche Verknüpfung von Fehler und Beweismittel | 101 | ||
| 2. Erfolgreiche Verlaufshypothese als Weg der Fehlerkompensation | 102 | ||
| V. Schutzzweck der verletzten Verfahrensnorm | 104 | ||
| 1. Irreparabilität der Rechtsverletzung | 104 | ||
| 2. Beweisverbote als Konsequenz informatorischer Schutzansprüche | 107 | ||
| 3. Schutzzwecküberlegung als begrenzende Konkretisierung der Verhältnismäßigkeit der (Beweis-)Mittel | 111 | ||
| 4. Verwertungsverbote als Folge der Gefährdung des Prozeßziels einer gerechten Urteilsfindung | 113 | ||
| 5. Realer und finaler Zusammenhang zwischen Beweisverstoß und Urteil | 116 | ||
| 6. Vereinbarkeit der Berücksichtigung der konkreten Verlaufshypothese mit dem Schutzzweck der jeweils verletzten Norm | 119 | ||
| VI. Abwägungsansatz | 127 | ||
| 1. Verlaufshypothese als Aspekt bei der Beurteilung der Schwere des Verfahrensverstoßes | 127 | ||
| 2. Keine Berücksichtigungsfähigkeit von Hypothesen bei der Abwägung | 128 | ||
| 3. Hypotheseberücksichtigung im Rahmen der Abwägungslehre | 129 | ||
| a) Hypothetischer Ermittlungsverlauf als Abwägungskriterium | 130 | ||
| b) Hypotheseberücksichtigung als der Abwägung vorgeschaltete Prüfungsstufe des normativen Zusammenhangs | 136 | ||
| Teil D: Legitimation von Verlaufshypothesen im Strafprozeß und deren systematische Einordnung | 141 | ||
| I. Grundsätzliche Einbringbarkeit von Verlaufshypothesen im Strafprozeß | 141 | ||
| 1. Zulässigkeit hypothetischer Erwägungen im Prozeßrecht | 141 | ||
| 2. Berücksichtigungsfähigkeit von Verlaufshypothesen bezüglich strafprozessualer Beweisermittlungen | 143 | ||
| II. Einordnung hypothetischer Erwägungen in den Vorgang der Ermittlung von Verwertungsverboten | 145 | ||
| 1. Diskussion der Vorschläge zur systematischen Einordnung | 146 | ||
| a) Verhältnis Kausalität – „hypothetische Kausalverläufe” | 146 | ||
| aa) Begriff der Kausalität und Bedeutung für die Verwertungsverbote | 147 | ||
| bb) Einordnung einzelner Fallgruppen | 148 | ||
| cc) Unterschiede bei der Prüfung des tatsächlichen und des normativen Zusammenhangs | 153 | ||
| b) Hypothetischer Ermittlungsverlauf als ein dem Normschutzzweckgedanken zuzuordnender Aspekt? | 154 | ||
| aa) Schutzzweck der Norm als den Zusammenhang zwischen Handeln und Erfolg bestimmendes Kriterium | 155 | ||
| bb) Einzelne Fallgruppen | 157 | ||
| aaa) Beweisverbote als Belastungsverbote | 158 | ||
| bbb) Öffentliche Interessen oder Dritte schützende Normen | 160 | ||
| ccc) „Außerprozessuale” Schutzgüter des Beschuldigten | 163 | ||
| cc) Verhältnis des Schutzzweckgedankens zur Verlaufshypothese | 167 | ||
| c) Hypothetischer Ermittlungsverlauf als Abwägungsfaktor? | 169 | ||
| aa) Hypothetische Überlegungen und Abwägungslehre | 170 | ||
| bb) Überprüfung der Hypotheseeinpassung als Abwägungsfaktor | 170 | ||
| aaa) Grundsätzliche Zuordnungsschwierigkeiten im Rahmen der Abwägungslehre | 171 | ||
| bbb) Widerspruch: hypothetischer Ermittlungsverlauf – Abwägungsfaktor | 172 | ||
| 2. Folgerung des Standorts hypothetischer Überlegungen im Prüfungsstufenaufbau | 175 | ||
| a) Hypothetischer Ermittlungsverlauf als eigenständige Prüfungsstufe vor der umfassenden Interessenabwägung | 175 | ||
| b) Reihenfolge der einzelnen Prüfungsstufen zur Feststellung von Verwertungsverboten | 176 | ||
| aa) „Tatsächliche” Ebene: Kausalität | 177 | ||
| bb) „Normative” Ebene: „Zurechnungszusammenhang” | 177 | ||
| aaa) Schutzbereich der Norm | 178 | ||
| bbb) Hypothetischer Ermittlungsverlauf | 178 | ||
| cc) Abwägung der Interessen | 180 | ||
| dd) „Mindestschranke”: Kernbereich der Grundrechte | 183 | ||
| aaa) Herleitung und Begründung eines „unantastbaren Bereichs” | 183 | ||
| bbb) Abgrenzung des „hypothese- und abwägungsfesten” Bereichs | 187 | ||
| ccc) Folgen für das Prüfungsschema | 191 | ||
| c) Prüfungsdiagramm | 193 | ||
| Teil E: Berücksichtigung von Verlaufshypothesen in den einzelnen Fallgruppen | 195 | ||
| I. Grundkonstellation durch rechtswidriges staatliches Handeln erlangter unmittelbarer Beweismittel | 195 | ||
| 1. Prinzip der Berücksichtigungsfähigkeit von „Hypothesen rechtmäßiger Beweiserlangung” | 195 | ||
| 2. Hypothese bezüglich Beschuldigten- oder Zeugenaussage bzw. Beschuldigten- oder Zeugenverhalten? | 196 | ||
| 3. Gewährleistung präventiver Garantie als Ausnahme? | 198 | ||
| a) Argumentation in der Literatur | 199 | ||
| b) Kritische Stellungnahme | 200 | ||
| 4. Annex: ausdrückliches Verwertungsverbot aus § 136a III (2) StPO | 203 | ||
| a) Klarstellungen zu Kausalität und Schutzzweck von § 136a III (2) StPO | 203 | ||
| b) Verlaufshypothesebildung (bezüglich der Aussage) bei § 136a III (2) StPO? | 205 | ||
| aa) Stand in Rechtsprechung und Literatur | 206 | ||
| bb) Lösung im Rahmen des hier vorgeschlagenen Ansatzes | 208 | ||
| II. Fehlende Rechtswidrigkeit staatlichen Handelns bei der Beweiserlangung | 211 | ||
| 1. Gesetzlich normierte Verwertungsverbote bei nicht rechtswidriger Beweismittelgewinnung | 211 | ||
| a) Verdeutlichung des Problems anhand § 252 StPO | 212 | ||
| b) Anknüpfung von Verlaufshypothesen? | 212 | ||
| 2. Selbständige Beweisverwertungsverbote | 213 | ||
| a) Einordnung in die vorliegende (Fall-)Kategorie | 213 | ||
| b) Ermittlung verfassungsrechtlicher Beweisverwertungsverbote in Literatur und Rechtsprechung | 214 | ||
| c) Verfassungsrechtliche Beweisverwertungsverbote im Rahmen des hier verfolgten Ansatzes und Hypotheserelevanz | 215 | ||
| aa) Verwertungsverbotsermittlung durch (einzelfallorientierte) Abwägung | 215 | ||
| bb) Relevanz hypothetischer Erwägungen? | 216 | ||
| cc) Verfassungsrechtliche Beweisverwertungsverbote mit „Vorwirkung” | 216 | ||
| 3. Zufallsfunde (§ 100a StPO) | 217 | ||
| a) Bestimmung der Untersuchungserkenntnisse und personenbezogene Anknüpfung | 219 | ||
| aa) Abschichtung der Zufallsfunde von den Untersuchungserkenntnissen | 220 | ||
| bb) Regelungsprinzip des § 100a II StPO | 223 | ||
| b) Begriff(-sbestimmung) der Zufallsfunde anhand § 100a StPO | 224 | ||
| c) Verwertbarkeit von Zufallsfunden in Literatur und Rechtsprechung | 225 | ||
| d) Behandlung der Zufallsfundproblematik im Rahmen des hier verfochtenen Ansatzes | 228 | ||
| aa) Notwendigkeit hypothetischer Überlegungen zur Problemlösung | 228 | ||
| bb) Tatsächliche Möglichkeit einer Hypothesebildung | 229 | ||
| cc) Übertragbarkeit der die Hypotheseberücksichtigung stützenden Argumentation | 230 | ||
| dd) Darstellung der Hypothese | 231 | ||
| ee) Ergebnis und dessen Überprüfung | 235 | ||
| ff) Besonderheiten bei der Abwägung | 239 | ||
| 4. Durch Handeln Privater erlangte Beweismittel | 239 | ||
| a) Eingrenzung der Problematik | 239 | ||
| b) Problemlösungen in Rechtsprechung und Literatur | 241 | ||
| c) Beurteilung der Beweiserlangung Privater anhand des hier verfolgten Ansatzes | 244 | ||
| aa) Verdeutlichung des Verwertbarkeitsproblems | 244 | ||
| bb) Grundsätzliche Lösung nach den oben aufgestellten Regeln | 246 | ||
| cc) Besonderheiten bei der hypothetischen Prüfung | 246 | ||
| III. Mittelbare Beweismittel und weitere Ermittlungen | 248 | ||
| 1. Relevanz hypothetischer Ermittlungsverläufe bezüglich mittelbarer Beweismittel | 249 | ||
| a) Grundsätzliches zur Verwertbarkeit mittelbarer Beweismittel (Fernwirkungsproblematik) | 250 | ||
| aa) Meinungsstand zum Fernwirkungsproblem | 250 | ||
| bb) Hier zugrunde liegender Ansatz | 255 | ||
| b) Einpassung hypothetischer Ermittlungsverläufe | 256 | ||
| c) Klarstellungen und Folgerungen zur Anknüpfung „übergreifender Hypothesen” und „Rückausnahmen” | 257 | ||
| 2. Hypothetische Ermittlungsverläufe beim Anknüpfen an unverwertbare Beweismittel zu neuen Ermittlungen | 260 | ||
| a) Einordnung und Ansätze zur Lösung des Problems in der Literatur | 260 | ||
| b) Diskussion und Lösungsvorschlag | 263 | ||
| Teil F: Bildung hypothetischer Ermittlungsverläufe | 267 | ||
| I. Schlußfolgerungen aus dem bisher Dargelegten zu Grenzen und Beschaffenheit der Hypothesebildung | 267 | ||
| 1. Bezugsobjekt der Hypothese: konkretes Beweismittel | 267 | ||
| 2. Unterschiedliche Arten von Hypothesen | 269 | ||
| a) Unterscheidung nach dem gedanklichen Substitut | 269 | ||
| aa) Hypothese bezüglich derselben Ermittlungsmaßnahme | 270 | ||
| bb) Hypothese bezüglich eines anderen Ermittlungswegs | 271 | ||
| b) Unterscheidung nach Aufgaben | 272 | ||
| aa) „Hypothese rechtmäßiger Beweiserlangung” | 273 | ||
| bb) „Hypothese finaler Beweiserlangung” | 273 | ||
| cc) „Übergreifende Hypothese” | 274 | ||
| 3. Konkrete Hypothesebildung auf „ex post” zu beurteilender Tatsachenbasis | 276 | ||
| a) Auf die konkret vorliegenden Umstände abhebende Bildung der Hypothese | 276 | ||
| b) Beurteilungsbasis “ex post” | 279 | ||
| II. Anforderungen an eine „erfolgreiche” Hypothese | 280 | ||
| 1. „Angelegtsein” des hypothetischen Ermittlungswegs in den bisherigen Ermittlungen | 281 | ||
| a) Inhaltliche Klärung des Erfordernisses und Relevanz bezüglich der einzelnen Hypothesearten | 281 | ||
| b) Rechtfertigung des Erfordernisses? | 282 | ||
| 2. Erforderlicher Wahrscheinlichkeitsgrad des Hypotheseeintritts | 285 | ||
| a) Notwendigkeit und Bezugspunkt des Wahrscheinlichkeitsmaßstabs | 286 | ||
| b) Stellungnahmen in der Literatur | 288 | ||
| c) Eigener Vorschlag | 292 | ||
| aa) Herleitung und Begründung der Lösung | 293 | ||
| bb) Unterschied zu bisher vertretenen Lösungen und Resultatsvergleich | 294 | ||
| III. Beweisverfahren bei der Hypothese(-feststellung) | 295 | ||
| 1. Tendenzen und Argumentation in der Literatur | 296 | ||
| 2. Diskussion und Lösung | 298 | ||
| Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 301 | ||
| Literaturverzeichnis | 305 |
