Die gegenläufige betriebliche Übung
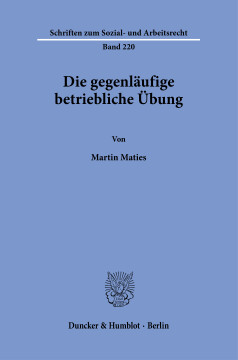
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die gegenläufige betriebliche Übung
Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht, Vol. 220
(2003)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Der Arbeitgeber kann sehr leicht auf Grund einer betrieblichen Übung einer neuen Verpflichtung unterliegen, deren Begründung er sich gegebenenfalls nicht bewusst gewesen ist. Der Autor widmet sich in seiner Untersuchung der Beseitigung der betrieblichen Übung mittels einer gegenläufigen bzw. negativen betrieblichen Übung. Auf diesem Weg setzt er sich mit den aktuell in Praxis und Lehre vertretenen Auffassungen zur Rechtsnatur des Anspruchs auseinander und zeigt die der jeweiligen Theorie entsprechenden Beseitigungsmöglichkeiten im Einzelnen auf. Hierbei ist im Besonderen auch auf die st. Rspr. des BAG zur Vertragstheorie und auf die hervorstechenden Entscheidungen aus den Jahren 1997 und 1999 einzugehen, in denen das BAG erstmalig eine negative betriebliche Übung anerkannt hat.Der Verfasser stellt im weiteren Verlauf den Rechtscharakter der betrieblichen Übung fest und hebt die einzelnen anspruchsbegründenden Merkmale heraus. Anschließend analysiert er die so erarbeiteten Merkmale auf ihre anspruchsbegründende Wirkung hin und arbeitet die Möglichkeit der Rückführung der entstandenen Ansprüche durch die Beseitigung der begründenden Faktoren mittels des Symmetriegedankens heraus. Martin Maties behandelt insbesondere auch die Bedeutung unterschiedlicher Inhalte einer betrieblichen Übung und die Stellung des öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers im Vergleich zum privaten. Abschließend untersucht er die Individualübung und die Konkretisierung als Rechtsinstitut und zeigt hinsichtlich Rechtsqualität und Beseitigung die Parallele zur betrieblichen Übung auf.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 17 | ||
| Einleitung | 21 | ||
| Kapitel 1: Zur Historie der betrieblichen Übung | 24 | ||
| A. Entstehungsgeschichte und Entwicklung der betrieblichen Übung | 24 | ||
| I. Allgemeines | 24 | ||
| II. Entwicklung | 26 | ||
| III. Allgemein anerkannte tatsächliche Voraussetzungen | 26 | ||
| Kapitel 2: Die rechtliche Einordnung der betrieblichen Übung | 28 | ||
| A. Auffassungen zur Rechtsnatur | 28 | ||
| I. Normative Theorien | 31 | ||
| 1. Konkrete Ordnung des Betriebs | 32 | ||
| 2. Betriebliches Gewohnheitsrecht | 33 | ||
| II. Schuldrechtliche Verpflichtungstheorien | 33 | ||
| 1. Vertragstheorie | 34 | ||
| 2. Vertrauens(-haftungs)theorie | 36 | ||
| B. Konsequenzen der einzelnen Theorien für die Beseitigung der betrieblichen Übung | 37 | ||
| I. Normative Theorien | 37 | ||
| II. Vertragstheorie | 39 | ||
| 1. Die einvernehmliche Vertragsänderung | 40 | ||
| a) Die gegenläufige Übung nach dem Urteil des BAG ν. 26. 03. 1997 | 41 | ||
| aa) Antrag des Arbeitgebers | 43 | ||
| bb) Annahme durch die Arbeitnehmer | 44 | ||
| (1) Objektiver Tatbestand einer Willenserklärung | 44 | ||
| (a) Unmittelbarkeitsgebot | 46 | ||
| (b) Verkehrssitte | 48 | ||
| (c) Schutzwürdiges Vertrauen | 49 | ||
| (aa) Treuepflicht | 49 | ||
| (bb) Spiegelbildliches Schweigen | 50 | ||
| (cc) Schutzwürdigkeit | 52 | ||
| (d) Ergebnis zum objektiven Tatbestand | 53 | ||
| (2) Subjektiver Tatbestand einer Willenserklärung | 53 | ||
| (3) Zugang als Wirksamkeitserfordernis gem. § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB | 54 | ||
| (a) Entbehrlichkeit gem. § 151 Satz 1 Variante 1 BGB (Verkehrssitte) | 55 | ||
| (b) Entbehrlichkeit gem. § 151 Satz 1 Variante 2 BGB (Verzicht) | 55 | ||
| (4) Inhalt der Willenserklärungen / Rechtsfolge | 56 | ||
| cc) Fazit zur gegenläufigen Übung auf Basis der Vertragstheorie | 57 | ||
| b) Bestätigung des Urteils vom 26. 03. 1997 durch Urteil vom 04. 05. 1999 | 58 | ||
| c) Rechtsfolgenbetrachtung bei Widerspruch durch die Arbeitnehmer | 59 | ||
| d) Fazit zur einvernehmlichen Vertragsänderung | 61 | ||
| 2. Andere Beseitigungsmöglichkeiten vertraglicher Ansprüche | 62 | ||
| a) Die Änderungskündigung | 62 | ||
| aa) Unkündbare oder schwer Kündbare | 63 | ||
| bb) Massenänderungskündigung | 64 | ||
| cc) Soziale Rechtfertigung und Kündigungsschutzklagen | 64 | ||
| dd) Schriftform und Betriebsratsbeteiligung | 65 | ||
| ee) Fazit zur Änderungskündigung als Beseitigungsmöglichkeit | 65 | ||
| b) Teilkündigung | 66 | ||
| c) Kollektive Kündigung | 67 | ||
| d) Die ablösende Betriebsvereinbarung | 67 | ||
| e) Störung der Geschäftsgrundlage § 313 Abs. 1 BGB und ergänzende Vertragsauslegung / Aussetzungsrecht | 70 | ||
| 3. Zusammenfassung der Beseitigungsmöglichkeiten aus Sicht der Vertragstheorie | 72 | ||
| III. Vertrauenstheorie | 73 | ||
| C. Bestimmung der Rechtsnatur | 74 | ||
| I. Argumente für und gegen die normativen Theorien | 75 | ||
| 1. Dogmatische Betrachtung | 75 | ||
| 2. Neu eintretende Arbeitnehmer | 79 | ||
| 3. Würdigung der Rechtsprechung auf Basis der normativen Theorien | 79 | ||
| 4. Arbeitsrechtliche Besonderheiten | 80 | ||
| II. Argumente für und gegen die Vertragstheorie | 81 | ||
| 1. Dogmatische Betrachtung | 82 | ||
| a) Fiktion einer Willenserklärung | 84 | ||
| aa) Objektiver Tatbestand | 84 | ||
| bb) Subjektiver Tatbestand | 89 | ||
| (1) Willenstheorie | 89 | ||
| (2) Potentielles Erklärungsbewusstsein / Erklärungstheorie | 90 | ||
| b) Ausschluss der Anfechtungsmöglichkeit | 91 | ||
| aa) Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes | 92 | ||
| bb) Rechtsfolgenirrtum | 93 | ||
| cc) Ergebnis zu Anfechtbarkeit | 94 | ||
| c) Hindernisse aus dem allgemeinen Zivilrecht | 96 | ||
| aa) Formvorschriften | 96 | ||
| bb) Annahmeerklärung | 97 | ||
| 2. Neu eintretender Arbeitnehmer | 97 | ||
| 3. Würdigung der Rechtsprechung auf Basis der Vertragstheorie | 99 | ||
| 4. Arbeitsrechtliche Besonderheiten | 100 | ||
| 5. Ergebnis | 101 | ||
| III. Argumente für und gegen die Vertrauenstheorie | 102 | ||
| 1. Dogmatische Betrachtung | 102 | ||
| 2. Neu eintretende Arbeitnehmer | 104 | ||
| 3. Würdigung der Rechtsprechung auf Basis der Vertrauenstheorie | 107 | ||
| 4. Arbeitsrechtliche Besonderheiten | 108 | ||
| IV. Gemeinsamkeiten der Theorien | 108 | ||
| V. Fazit zur Rechtsnatur | 109 | ||
| D. Konsequenzen für die Beseitigung | 110 | ||
| Kapitel 3: Die rechtliche Zuordnung der Tatbestandselemente der betrieblichen Übung | 112 | ||
| A. Entstehungsvoraussetzungen einer betrieblichen Übung | 112 | ||
| I. Vertrauenstatbestand | 113 | ||
| 1. Leistung bzw. Verhalten des Arbeitgebers | 114 | ||
| 2. Wiederholte Erbringung | 117 | ||
| 3. Prognose | 120 | ||
| a) Freiwilligkeitsvorbehalt | 121 | ||
| b) Widerrufsvorbehalt | 125 | ||
| c) Umstände des Einzelfalls | 127 | ||
| 4. Beispielsfall zum Vertrauenstatbestand | 130 | ||
| II. Zurechenbarkeit des Vertrauenstatbestandes | 130 | ||
| 1. Normvollzug | 131 | ||
| 2. Erkennbarer vermeintlicher Normvollzug | 131 | ||
| 3. Kein (erkennbarer) Normvollzug | 133 | ||
| a) Gesetzliche Wertung | 133 | ||
| b) Verschuldensprinzip | 134 | ||
| c) Risikoprinzip | 135 | ||
| III. Schutzwürdiges Vertrauen der Arbeitnehmer | 136 | ||
| 1. Vertrauen | 137 | ||
| a) Vertrauen des Einzelnen - Vertrauen der Belegschaft | 138 | ||
| b) Abstrakt - konkret | 138 | ||
| 2. Kausalität | 139 | ||
| 3. Schutzwürdigkeit | 139 | ||
| a) Irrtumsfälle des Arbeitgebers | 139 | ||
| b) Irrtumsfreie betriebliche Übung | 141 | ||
| IV. Vertrauensinvestition | 145 | ||
| V. Zusammenfassung | 149 | ||
| B. Differenzierung zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Arbeitgeber? | 150 | ||
| Kapitel 4: Veränderungen der Anspruchsgrundlage durch Zeitablauf? | 155 | ||
| Kapitel 5: Die Symmetrie zwischen Begründung und Beseitigung der betrieblichen Übung | 158 | ||
| A. Der Symmetriegedanke | 158 | ||
| B. Übertragung des Symmetriegedankens auf die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen der betrieblichen Übung | 160 | ||
| I. Vertrauenstatbestand | 160 | ||
| II. Zurechenbarkeit des Vertrauenstatbestandes | 161 | ||
| III. Schutzwürdiges Vertrauen der Arbeitnehmer | 162 | ||
| IV. Vertrauensinvestition | 164 | ||
| V. Sachlicher Grund | 165 | ||
| 1. Erforderlichkeit | 165 | ||
| 2. Anforderungen | 167 | ||
| VI. Beseitigung durch Betriebsvereinbarung | 168 | ||
| VII. Zusammenfassung | 170 | ||
| Kapitel 6: Die betriebliche Übung und ihre Beendigung - ein allgemeines Modell für alle Fälle | 171 | ||
| A. Das Altersruhegeld | 171 | ||
| B. Die arbeitnehmerbelastende betriebliche Übung | 172 | ||
| Kapitel 7: Die Individualübung: Ein eigenes Rechtsinstitut? | 175 | ||
| A. Die Individualübung | 175 | ||
| I. Die Individualübung als eigenständiges Institut | 175 | ||
| II. Die Konkretisierung | 176 | ||
| 1. Tatsächliches Erscheinungsbild - Anforderungen | 177 | ||
| 2. Rechtliche Einordnung | 178 | ||
| 3. Folgen der Einordnung | 180 | ||
| Zusammenfassung | 182 | ||
| Literaturverzeichnis | 184 | ||
| Entscheidungsregister | 194 | ||
| Sachwortverzeichnis | 201 |
