Der Echtheitsbegriff im Tatbestand der Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
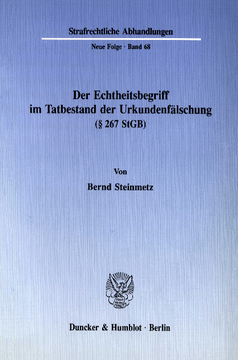
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Echtheitsbegriff im Tatbestand der Urkundenfälschung (§ 267 StGB)
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 68
(1991)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 15 | ||
| Einleitung | 21 | ||
| 1. Abschnitt: Grundlagen des Echtheitsbegriffes | 24 | ||
| I. Der Ausstellerbegriff des § 267 StGB | 24 | ||
| A. Der Anscheinsaussteller und der Urheber einer Urkunde | 24 | ||
| B. Die Geistigkeitstheorie als Grundlage beider „Ausstellerbegriffe“? | 26 | ||
| II. Inhalt der Geistigkeitstheorie | 28 | ||
| A. Entstehung aus der Körperlichkeitstheorie | 28 | ||
| 1. Einsatz von Herstellungsgehilfen bei der Urkundenverkörperung | 28 | ||
| a) Bedeutung der Körperlichkeitstheorie für die Echtheit | 28 | ||
| b) Bedeutung der Körperlichkeitstheorie für die Urkundsqualität | 29 | ||
| c) Maschinell erstellte Erklärungen | 30 | ||
| d) Das Problem der „Depeschenfälschung“ nach altem Recht | 31 | ||
| 2. Zeichnen mit fremdem Namen | 32 | ||
| B. Die frühe Rechtsprechung des Reichsgerichts | 33 | ||
| C. Jüngere Rechtsprechung und Lehre | 35 | ||
| 1. Das „geistige Herrühren“ | 35 | ||
| 2. Der „Erklärende“ oder der „Erklärer“ als Aussteller | 38 | ||
| 3. Allgemeingültige Ausstellerbestimmung oder Spezialregel für Vertretungsfälle? | 39 | ||
| 4. Der Hauptanwendungsfall: Das Zeichnen mit fremdem Namen | 40 | ||
| a) Genaue Bezeichnung der Fallgruppe | 40 | ||
| b) Das „Konformitätsargument“ | 41 | ||
| 5. Grenzen der Konformität zwischen Zivilrecht und Strafrecht | 42 | ||
| 6. Bisherige Kritik an der Geistigkeitstheorie | 43 | ||
| III. Das Rechtsgut des § 267 StGB | 44 | ||
| A. Sicherheit und Zuverlässigkeit des Rechtsverkehrs | 44 | ||
| B. Schutz der „Institution der Urkunde“ | 44 | ||
| C. Schutz des Beweisverkehrs | 45 | ||
| D. Vertrauen auf Authentizität von Urkunden | 47 | ||
| 2. Abschnitt: Grundsätzliche Kritik der Geistigkeitstheorie | 50 | ||
| I. Sprachliche Mängel des Begriffes „Geistiges Herrühren“ | 50 | ||
| A. Nicht jede geistige Urheberschaft ist ein „geistiges Herrühren“ | 51 | ||
| B. „Geistiges Herrühren“ im Rechtssinne? | 53 | ||
| II. Behandlung der offenen Stellvertretung in Rechtsprechung und Schrifttum | 54 | ||
| A. Zivilrechtliche Ausnahme als Grundfall für den strafrechtlichen Echtheitsbegriff | 54 | ||
| B. Fehlende Erörterungen zur offenen, nicht vorgetäuschten Stellvertretung | 55 | ||
| C. Anwendung der Geistigkeitstheorie auf die Fälle der offenen (nicht vorgetäuschten) Stellvertretung | 59 | ||
| D. Der Urkundenaussteller bei der offenen, nicht vorgetäuschten Stellvertretung | 60 | ||
| 1. Offene Vertretung natürlicher Personen | 60 | ||
| a) Vertreter oder Vertretener als Aussteller? | 60 | ||
| b) Ausstellerbestimmung anhand des betroffenen Rechtsgutes | 62 | ||
| c) Der Vertreter ohne Vertretungsmacht als Hersteller einer unechten Urkunde? | 64 | ||
| 2. Offene Vertretung von Firmen und Behörden | 66 | ||
| a) Ausstellereigenschaft von Firmen und Behörden | 66 | ||
| b) Zurücktreten der unterzeichnenden Person gegenüber dem Firmennamen oder der Behördenbezeichnung? | 68 | ||
| aa) Eigenständige Bedeutung des Namens des Unterzeichners | 70 | ||
| bb) Undurchschaubarkeit der Befugnisse bei Behörden oder Firmen? | 72 | ||
| c) Bestimmung des Ausstellers als „Tatfrage“? | 73 | ||
| d) Der Aussteller bei offener Vertretung von Firmen oder Behörden | 76 | ||
| aa) Gleichbehandlung der offenen Vertretung von Firmen oder Behörden mit der offenen Vertretung natürlicher Personen | 76 | ||
| bb) Der Firmenname oder die Behördenbezeichnung als zusätzliches Individualisierungsmerkmal | 78 | ||
| E. Schlußfolgerungen für die offene Stellvertretung bei vorgetäuschtem Vertretungsvermerk | 79 | ||
| 1. Vorgetäuschte offene Vertretung einer natürlichen Person | 79 | ||
| 2. Vorgetäuschte offene Vertretung von Firmen oder Behörden | 80 | ||
| F. Unanwendbarkeit der Geistigkeitstheorie auf jegliche offene Stellvertretung | 83 | ||
| 3. Abschnitt: Kritik der Geistigkeitstheorie im Rahmen der üblicherweise erörterten Anwendungsfälle | 87 | ||
| I. Verwendung eines nicht zustehenden Namens | 88 | ||
| A. Der Normalfall: Unechtheit der Urkunde aufgrund einer Ausstellertäuschung | 88 | ||
| B. Ausnahmen für die Verwendung eines falschen Namens | 90 | ||
| 1. Keine Ausstellerangabe bei offener oder versteckter Anonymität | 90 | ||
| a) Anonymität aufgrund des Täterwillens? | 91 | ||
| b) Objektiv begründete Anonymität | 95 | ||
| aa) Zeichnung mit unleserlicher Unterschrift | 95 | ||
| bb) Verwendung historischer oder literarischer Namen | 97 | ||
| cc) Verwendung von „Allerweltsnamen“ | 100 | ||
| 2. Künstlernamen, Decknamen, Spitznamen und auf Dauer gebrauchte Falschnamen | 103 | ||
| 3. Möglichkeit einer Namenstäuschung ohne Identitätstäuschung? | 107 | ||
| a) Eingrenzung der Fallkonstellation | 109 | ||
| b) Bloße Namenstäuschung aufgrund des Täterwillens? | 110 | ||
| aa) Keine Berücksichtigung subjektiver Kriterien bei der Bestimmung der Echtheit | 112 | ||
| bb) Der Anscheinsaussteller bei der sogenannten bloßen Namenstäuschung | 115 | ||
| c) Berücksichtigung des Täterwillens bei dem Merkmal „Zur Täuschung im Rechtsverkehr“ | 118 | ||
| 4. Zur Frage der Identitätstäuschung bei fehlendem Interesse am Namen | 121 | ||
| 5. Rein objektiver, strenger Echtheitsbegriff bei der Verwendung eines falschen, nicht zustehenden Namens | 127 | ||
| C. Der Hauptfall der Geistigkeitstheorie: Das Zeichnen mit fremdem Namen | 128 | ||
| 1. Weitere Konkretisierung der vom Zeichnen mit fremdem Namen umfaßten Fälle | 129 | ||
| a) „Zeichnen“ nicht nur im Sinne von „Unterzeichnen“ | 129 | ||
| b) Differenzierung zwischen Dispositiv- und Zeugnisurkunden? | 130 | ||
| 2. Die Behandlung des Zeichnens mit fremdem Namen im Zivilrecht | 134 | ||
| a) Das „Handeln unter fremdem Namen“ | 134 | ||
| b) Zivilrechtliche Wirkungen des Zeichnens mit dem Namen des Vertretenen | 137 | ||
| 3. Kritische Betrachtung der Konformitätserwägungen | 141 | ||
| a) Konformität beim Zeichnen mit fremdem Namen | 141 | ||
| aa) Prüfung der Kriterien, die zur zivilrechtlichen Wirksamkeit des Zeichnens mit fremdem Namen führen | 143 | ||
| bb) Die mögliche „Fremdhändigkeit“ der eigenhändigen Unterschrift bei § 126 BGB | 147 | ||
| cc) Nachträgliche Genehmigung bei vollmachtloser Verwendung des fremden Namens | 150 | ||
| b) Konformität bei sonstiger Verwendung eines falschen Namens | 153 | ||
| c) Beschränkung des Konformitätsarguments auf bestimmte Fälle der Stellvertretung? | 157 | ||
| d) Ungeeignetheit der Konformitätserwägungen für den Echtheitsbegriff des § 267 StGB | 161 | ||
| 4. Verwendung des Namens einer vertretenen natürlichen Person (Verdeckte Vertretung) | 162 | ||
| a) Der Anscheinsaussteller beim Zeichnen mit fremdem Namen | 162 | ||
| b) Der Urheber beim Zeichnen mit fremdem Namen | 164 | ||
| aa) Der Wille des Unterzeichners zur Vertretung des Namensträgers | 167 | ||
| bb) Der Wille des Namensträgers zum Vertretensein | 175 | ||
| aaa) Folgen der Berücksichtigung des Willens zum Vertretensein für die Bestimmung des Urhebers der Urkunde | 176 | ||
| bbb) Der „wahre Wille“ des Namensträgers | 183 | ||
| cc) Rechtliche Zulässigkeit der verdeckten Stellvertretung | 187 | ||
| aaa) Vertretungsverbote und Eigenhändigkeitserfordernisse | 189 | ||
| bbb) Berücksichtigung von Eigenhändigkeitserfordernissen bei der Unterzeichnung, nicht aber bei der Niederschrift? | 194 | ||
| ccc) Einfluß von Wirksamkeitserwägungen auf den Echtheitsbegriff | 196 | ||
| ddd) Die herrschende Meinung als „modifizierte Körperlichkeitstheorie?“ | 201 | ||
| dd) Ungeeignetheit der üblicherweise genannten drei Voraussetzungen zur Bestimmung des Urhebers einer Urkunde beim Zeichnen mit fremdem Namen | 204 | ||
| 5. Verdeckte Vertretung von Firmen oder Behörden | 206 | ||
| a) Der Anscheinsaussteller der Urkunde | 206 | ||
| b) Der Urheber der Urkunde | 215 | ||
| D. Echtheit trotz Verwendung eines nicht zustehenden Namens | 218 | ||
| II. Ausstellertäuschung trotz Verwendung des eigenen Namens | 218 | ||
| A. Bezug dieser Fallgruppe zur Geistigkeitstheorie | 220 | ||
| B. Unabhängigkeit des Echtheitsbegriffes von subjektiven Kriterien | 221 | ||
| C. Einzelfälle zur Unechtheit trotz Verwendung des eigenen Namens | 222 | ||
| 4. Abschnitt: Fazit der kritischen Auseinandersetzung mit der Geistigkeitstheorie | 233 | ||
| I. Ungeeignetheit der Geistigkeitstheorie für den Echtheitsbegriff des § 267 StGB | 233 | ||
| A. Zusammenfassung der Kritik | 233 | ||
| B. Weitere Einzelfälle, die die Unanwendbarkeit der Geistigkeitstheorie belegen | 236 | ||
| II. Rückkehr zu einer modifizierten Form der Körperlichkeitstheorie | 243 | ||
| A. Keine Lösung der Probleme bei der Ausstellerbestimmung mit Hilfe anderer, die Geistigkeitstheorie modifizierender Ansätze | 243 | ||
| B. Grundlage jeglicher Echtheitsbestimmung: Vertrauen auf das körperliche Herrühren vom Aussteller | 245 | ||
| C. Modifizierung der reinen körperlichen Betrachtungsweise durch Einbeziehung von Herstellungsgehilfen in die körperliche Ausstellerbestimmung | 248 | ||
| D. Die Ausstellerbestimmung nach einer „modifizierten Körperlichkeitstheorie“ | 252 | ||
| E. Auswirkungen der „modifizierten Körperlichkeitstheorie“ auf die in dieser Arbeit erörterten Fallgruppen | 259 | ||
| 1. Ständige Berücksichtigung einer körperlichen Betrachtungsweise | 259 | ||
| 2. Das Zeichnen mit fremdem Namen, eine Form des Herstellens einer unechten Urkunde! | 260 | ||
| III. Ergebnis und Ausblick | 263 | ||
| Literaturverzeichnis | 266 |
