Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform 2002 auf den Unternehmenskauf
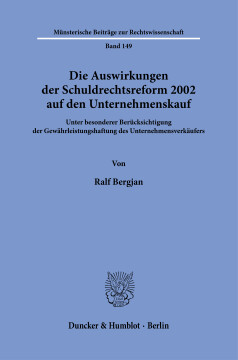
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Auswirkungen der Schuldrechtsreform 2002 auf den Unternehmenskauf
Unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistungshaftung des Unternehmensverkäufers
Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft, Vol. 149
(2003)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Das am 01.01.2002 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts hat zu grundlegenden Änderungen im allgemeinen Leistungsstörungs- sowie im Kaufrecht geführt. Der Autor befasst sich mit den unmittelbaren Auswirkungen dieser Schuldrechtsreform auf die Haftung des Unternehmensverkäufers. Er behandelt vertiefend die Gewährleistungshaftung des Unternehmensverkäufers im Vergleich zur bisherigen Rechtslage. Hierbei wird die Haftung des Verkäufers beim asset deal und beim share deal jeweils unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2001 geltenden sowie der durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz geschaffenen Rechtslage untersucht.Weiterhin zeigt der Verfasser insbesondere die für die praktische Gestaltung von Unternehmenskaufverträgen bedeutenden Änderungen auf und kommt zu dem Ergebnis, dass die Anwendbarkeit des Kaufvertragsrechts der §§ 433 ff. BGB auf den Unternehmenskauf nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann, und dass sich die Haftung des Unternehmensverkäufers deshalb grds. auch nach dem vorrangigen Kaufgewährleistungsrecht der §§ 434 ff. BGB richtet. Zudem erfasst der Beschaffenheitsbegriff des § 434 Abs. 1 S. 1 BGB nicht mehr nur körperliche, sondern jetzt auch unkörperliche Eigenschaften der Kaufsache, was zu einer Erweiterung des Beschaffenheitsbegriffs geführt hat.Durch die uneingeschränkte Geltung des Kaufgewährleistungsrechts ergibt sich, dass sowohl vergangenheits- als auch zukunftsbezogene Verkäuferangaben über Unternehmenskennziffern die Beschaffenheit des Unternehmens prägen und hierauf regelmäßig das Kaufrecht Anwendung findet. Die Erweiterung des Beschaffenheitsbegriffs führt auf Rechtsfolgenseite jedoch zu Einschränkungen beim Unternehmenskauf: So gelten bspw. höhere Anforderungen für die zum Rücktritt oder zum Schadensersatz statt der ganzen Leistung führende Voraussetzung der Erheblichkeit einer Pflichtverletzung i. S. d. §§ 323 Abs. 5 S. 2, 281 Abs. 1 S. 3 BGB. Beim asset deal beschränkt sich die gesetzliche Haftung - trotz der Streichung des § 437 Abs. 1 BGB a. F. - weiterhin auf die Verität des verkauften Gesellschaftsanteils. Schließlich zeigt Ralf Bergjan, dass wie bisher selbständige Garantien vereinbart werden können.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| § 1 Einführung | 21 | ||
| I. Fragestellung | 22 | ||
| II. Gang der Darstellung | 23 | ||
| § 2 Die Geschichte des deutschen Schuldrechts | 25 | ||
| I. Entwicklung des Schuldrechts | 25 | ||
| 1. Ursprung des deutschen Schuldrechts | 26 | ||
| 2. Das Schuldrecht im Rahmen der Entwürfe zum BGB | 26 | ||
| II. Entwicklung des Schuldrechts nach In-Kraft-Treten des BGB | 28 | ||
| 1. Schuldrechtliche Vorschriften außerhalb des BGB | 30 | ||
| 2. Weiterentwicklung des Schuldrechts durch Rechtsprechung und Literatur | 33 | ||
| a) Verschulden bei Vertragsschluss | 33 | ||
| b) Positive Forderungsverletzung | 34 | ||
| c) Wegfall der Geschäftsgrundlage | 35 | ||
| 3. Vertragstypisierung | 37 | ||
| III. Schuldrechtsmodernisierung | 37 | ||
| 1. Geschichte der Schuldrechtsreform | 38 | ||
| 2. Inhaltliche und strukturelle Änderungen durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz | 41 | ||
| a) Verjährungsrecht | 41 | ||
| b) Leistungsstörungsrecht | 42 | ||
| aa) Aufnahme von Rechtsinstituten | 43 | ||
| bb) Änderungen der Leistungsstörungsarten | 43 | ||
| (1) Unmöglichkeit | 44 | ||
| (2) Pflichtverletzung | 45 | ||
| (3) Rücktritts-, Widerrufs- und Rückgaberecht der §§ 346 ff. BGB | 47 | ||
| c) Integration von Verbraucherschutzgesetzen | 47 | ||
| d) Kaufrecht | 49 | ||
| aa) Strukturelle und systematische Änderungen | 49 | ||
| (1) Nacherfüllung | 52 | ||
| (2) Rücktritt und Minderung | 53 | ||
| (3) Schadensersatz statt der Leistung und Aufwendungsersatz | 54 | ||
| bb) Inhaltliche Änderungen | 56 | ||
| (1) Sachmangelbegriff | 57 | ||
| (2) Verjährungsfristen fiir Mängelansprüche | 59 | ||
| (3) Verbrauchsgüterkauf | 59 | ||
| e) Überleitungsvorschriften | 60 | ||
| § 3 Der Unternehmenskauf unter Berücksichtigung des neuen Schuldrechts | 61 | ||
| I. Kauf eines Unternehmens | 61 | ||
| 1. Unternehmen als Gegenstand eines Verpflichtungsvertrags | 62 | ||
| 2. Unternehmensbegriff | 63 | ||
| a) Rechtsprechung | 64 | ||
| b) Literatur | 65 | ||
| c) Stellungnahme unter Berücksichtigung neuen Schuldrechts | 66 | ||
| d) Zwischenergebnis | 67 | ||
| 3. Vertragstypisierung | 67 | ||
| a) Rechtsprechung | 68 | ||
| b) Herrschende Lehre | 70 | ||
| c) Teil der Literatur | 70 | ||
| d) Stellungnahme unter Berücksichtigung neuen Schuldrechts | 71 | ||
| e) Zwischenergebnis | 73 | ||
| II. Arten des Unternehmenskaufs | 73 | ||
| 1. Echter Unternehmenskauf (asset deal) | 74 | ||
| a) Sachenrechtlicher Spezialitätsgrundsatz | 74 | ||
| b) Einordnung als Sach- oder Rechtskauf? | 75 | ||
| aa) Entwicklung der Rechtsprechung | 76 | ||
| bb) Schrifttum | 77 | ||
| cc) Stellungnahme unter Berücksichtigung neuen Schuldrechts | 79 | ||
| dd) Zwischenergebnis | 81 | ||
| c) Der Unternehmenskauf als Stückkauf | 82 | ||
| 2. Anteilskauf (share deal) | 82 | ||
| a) Typisierung nach bisherigem Schuldrecht | 83 | ||
| aa) Rechtsprechung | 84 | ||
| bb) Literatur | 84 | ||
| b) Typisierung nach neuem Schuldrecht | 85 | ||
| c) Exkurs: Nichtigkeit eines Anteilskaufvertrags bei anfänglich objektiver Unmöglichkeit? | 87 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 87 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 89 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 90 | ||
| III. Pflichten des Unternehmensverkäufers | 90 | ||
| 1. Echter Unternehmenskauf | 91 | ||
| 2. Anteilskauf | 93 | ||
| IV. Form des Unternehmenskaufvertrags | 95 | ||
| 1. Allgemeine Formvorschriften | 95 | ||
| a) Bisherige Rechtslage | 96 | ||
| b) Neue Rechtslage | 97 | ||
| 2. Formvorschriften für echten Unternehmenskauf | 98 | ||
| a) Mitverkauf von Grundstücken | 98 | ||
| b) Mitverkauf von GmbH-Gesellschaftsanteilen | 99 | ||
| 3. Formvorschriften für Anteilskauf | 100 | ||
| a) Verkauf von GmbH-Gesellschaftsanteilen | 100 | ||
| b) Verkauf von Anteilen anderer Gesellschaften | 102 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 102 | ||
| V. Anwendbarkeit der Verbraucherschutzbestimmungen | 103 | ||
| 1. Verbraucherdarlehen gem. §§ 491 ff. BGB | 103 | ||
| a) Persönlicher Anwendungsbereich | 104 | ||
| aa) Unternehmer i. S. d. § 14 BGB | 104 | ||
| (1) Natürliche Person, juristische Person, rechtsfähige Personengesellschaft | 105 | ||
| (2) Gewerbliche oder selbständig berufliche Tätigkeit | 106 | ||
| bb) Verbraucher i. S. d. § 13 BGB | 107 | ||
| (1) Grenzfälle zwischen privatem und gewerblichem Kauf beim Anteilskauf | 109 | ||
| (a) Kapitalgesellschaften | 109 | ||
| (b) Personengesellschaften | 110 | ||
| (2) Existenzgründerdarlehen beim echten Unternehmenskauf | 111 | ||
| b) Sachlicher Anwendungsbereich | 112 | ||
| c) Rechtsfolgen | 112 | ||
| d) Zwischenergebnis | 113 | ||
| 2. Verbrauchsgüterkauf gem. §§ 474 ff. BGB | 114 | ||
| 3. Allgemeine Geschäftsbedingungen gem. §§ 305 ff. BGB | 115 | ||
| VI. Anwendbarkeit handelsrechtlicher Vorschriften | 117 | ||
| 1. Handelsgeschäft gem. §§ 343 f. HGB | 117 | ||
| a) Echter Unternehmenskauf | 118 | ||
| b) Anteilskauf | 119 | ||
| 2. Handelskauf gem. §§ 373 ff. HGB | 120 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 121 | ||
| VII. Ergebnis | 121 | ||
| § 4 Die neue Gewährleistungshaftung des Unternehmensverkäufers im Vergleich zur bisherigen Rechtslage | 124 | ||
| I. Haftung beim echten Unternehmenskauf. | 124 | ||
| 1. Haftung aus Kaufgewährleistungsrecht | 125 | ||
| a) Anwendbarkeit des Kaufgewährleistungsrechts | 125 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 126 | ||
| (1) Sachmängelgewährleistungsvorschriften der §§ 459 ff. BGB a. F. analog | 126 | ||
| (2) Lehre vom Verschulden bei Vertragsschluss | 127 | ||
| (3) Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage | 128 | ||
| (4) Irrtum über die Kalkulationsgrundlage | 129 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 129 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 131 | ||
| b) Sach- oder Rechtsmängelgewährleistungsrecht? | 132 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Kaufrecht | 132 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Kaufrecht | 133 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 136 | ||
| c) Der Sachmangelbegriff beim Unternehmenskauf | 136 | ||
| aa) Vereinbarte Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB | 136 | ||
| (1) Bisheriger Fehlerbegriff i. S. d. § 459 Abs. 1 BGB a. F. | 137 | ||
| (a) Rechtsprechung | 139 | ||
| (aa) Qualitätsmängel | 139 | ||
| (bb) Quantitätsmängel | 140 | ||
| (cc) Zusicherung von Unternehmenszahlen | 141 | ||
| (b) Schrifttum | 142 | ||
| (aa) Qualitätsmängel | 142 | ||
| (bb) Quantitätsmängel | 143 | ||
| (cc) Zusicherungen von Unternehmenszahlen | 144 | ||
| (2) Neuer Beschaffenheitsbegriff i. S. d. § 434 Abs. 1 S. 1 BGB | 144 | ||
| (a) Allgemeines | 145 | ||
| (b) Besonderheiten beim Unternehmenskauf | 148 | ||
| (aa) Qualitätsmängel | 148 | ||
| (bb) Quantitätsmängel | 150 | ||
| (cc) Zusicherung von Unternehmenszahlen | 151 | ||
| (dd) Zwischenergebnis | 154 | ||
| (c) Fehlen ausdrücklicher Beschaffenheitsvereinbarungen | 154 | ||
| (aa) Eignung für vorausgesetzte Verwendung gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGB | 155 | ||
| (bb) Gewöhnliche Verwendung und übliche Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB | 156 | ||
| (α) Anwendbarkeit des § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB auf Unternehmenskäufe | 157 | ||
| (β) Gewöhnliche Verwendung gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Var. 1 BGB | 158 | ||
| (γ) Übliche Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Var. 2 BGB | 159 | ||
| (cc) Werbeaussagen gem. § 434 Abs. 1 S. 3 BGB | 160 | ||
| (dd) Zwischenergebnis | 161 | ||
| (3) Sonderfall mangelhafter Einzelgegenstände oder -rechte | 162 | ||
| (a) Beurteilung nach bisherigem Kaufrecht | 162 | ||
| (b) Beurteilung nach neuem Kaufrecht | 163 | ||
| (aa) Sachmängel gem. § 434 BGB | 164 | ||
| (bb) Rechtsmängel gem. § 435 BGB | 165 | ||
| (cc) Zwischenergebnis | 166 | ||
| bb) Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft als Sachmangel nach neuem Kaufrecht? | 166 | ||
| (1) Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft gem. § 459 Abs. 2 BGB a. F | 166 | ||
| (a) Eigenschaft | 167 | ||
| (aa) Rechtsprechung | 167 | ||
| (bb) Schrifttum | 170 | ||
| (b) Zusicherung | 171 | ||
| (2) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 171 | ||
| cc) Sonstige Erweiterungen des Sachmangelbegriffs gem. § 434 BGB | 176 | ||
| d) Gefahrübergang | 177 | ||
| e) Gesetzlicher Haftungsausschluss des § 442 Abs. 1 BGB | 179 | ||
| aa) Streichung des § 464 BGB a. F | 180 | ||
| bb) Grob fahrlässige Unkenntnis bei Nichtvornahme einer Unternehmen sprüfung? | 182 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 184 | ||
| f) Verjährung der kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche | 185 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Kaufrecht | 185 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Kaufrecht | 187 | ||
| (1) Abbedingung der gesetzlichen Verjährungsfrist | 189 | ||
| (2) Sonderfall der Verjährungshemmung bei außergerichtlichen Anspruchsverhandlungen gem. § 203 BGB | 190 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 192 | ||
| g) Rechtsbehelfe des Unternehmenskäufers bei Vorliegen eines Unternehmensmangels | 193 | ||
| aa) Nacherfüllungsanspruch gem. §§ 437 Nr. 1, 439 BGB | 194 | ||
| (1) Unmöglichkeit der Mangelbeseitigung gem. § 275 Abs. 1 BGB | 196 | ||
| (2) Leistungsverweigerungsrecht gem. § 275 Abs. 2 und 3 BGB | 197 | ||
| (3) Leistungsverweigerungsrecht gem. § 439 Abs. 3 S. 1 BGB | 199 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 201 | ||
| bb) Rücktritt vom Unternehmenskaufvertrag gem. §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 440, 323, 326 Abs. 5 BGB | 202 | ||
| (1) Fristsetzung zur Mangelbeseitigung | 203 | ||
| (2) Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 323 Abs. 2 | 204 | ||
| (a) Ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung nach Nr. 1 | 204 | ||
| (b) Relative Fixgeschäfte nach Nr. 2 | 206 | ||
| (c) Interessenfortfall nach Nr. 3 | 208 | ||
| (d) Abbedingung des Fristsetzungserfordernisses nach § 323 Abs. 1 BGB | 210 | ||
| (3) Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 440 S. 1 BGB | 210 | ||
| (a) Fehlgeschlagene Mangelbeseitigung gem. § 440 S. 1 Var. 2 BGB | 211 | ||
| (b) Unzumutbarkeit der Mangelbeseitigung gem. § 440 S. 1 Var. 3 BGB | 212 | ||
| (4) Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 326 Abs. 5 BGB | 213 | ||
| (5) Rücktritt vor Fälligkeit gem. § 323 Abs. 4 BGB | 214 | ||
| (6) Quantitative Teilleistung gem. § 323 Abs. 5 S. 1 BGB | 215 | ||
| (7) Unerheblichkeit der Pflichtverletzung gem. § 323 Abs. 5 S. 2 BGB | 216 | ||
| (a) Allgemeines | 217 | ||
| (b) Besonderheiten beim echten Unternehmenskauf. | 218 | ||
| (aa) Erhöhte Anforderungen an die Erheblichkeit der Pflichtverletzung | 218 | ||
| (bb) Beurteilungsmaßstab | 220 | ||
| (cc) Darlegungs- und Beweislast | 221 | ||
| (dd) Ausschluss des § 323 Abs. 5 S. 2 BGB bei Abgabe einer Garantie | 222 | ||
| (8) Ausschluss des Rücktrittsrechts gem. § 323 Abs. 6 BGB | 223 | ||
| (9) Rückabwicklung des Unternehmenskaufvertrags gem. §§ 346 ff. BGB | 224 | ||
| (a) Pflichten des Unternehmenskäufers | 224 | ||
| (b) Pflichten des Unternehmensverkäufers | 225 | ||
| (c) Zwischenergebnis | 226 | ||
| cc) Kaufpreisminderung gem. §§ 437 Nr. 2 Var. 2, 441 BGB | 227 | ||
| dd) Schadensersatz gem. §§ 437 Nr. 3 Var. 1, 440, 280, 281, 283,311 a BGB | 229 | ||
| (1) Pflichtverletzungsschadensersatz i. V. m. § 280 Abs. 1 BGB | 230 | ||
| (2) Ersatz des Verzögerungsschadens i. V. m. §§ 280 Abs. 1 und 2, 286 BGB | 232 | ||
| (3) Schadensersatz statt der Leistung | 233 | ||
| (a) Anspruch gem. §§ 437 Nr. 3 Var. 1, 440, 280 Abs. 1 und 3 Var. 1, 281 BGB | 234 | ||
| (aa) Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1 und 3 Var. 1,281 BGB | 234 | ||
| (α) Großer Schadensersatz | 235 | ||
| (β) Kleiner Schadensersatz | 236 | ||
| (γ) Wahlrecht des Unternehmens Verkäufers | 237 | ||
| (bb) Unerheblichkeit der Pflichtverletzung gem. §281 Abs. 1 S. 3 BGB | 238 | ||
| (b) Anspruch gem. §§ 437 Nr. 3 Var. 1, 280 Abs. 1 und 3 Var. 3, 283 BGB | 239 | ||
| (c) Anspruch gem. §§ 437 Nr. 3 Var. 1,311a Abs. 2 BGB | 240 | ||
| (4) Zwischenergebnis | 241 | ||
| ee) Aufwendungsersatz gem. §§ 437 Nr. 3 Var. 2, 284 BGB | 242 | ||
| 2. Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss | 244 | ||
| a) Konkurrenzverhältnisse | 244 | ||
| aa) Kaufgewährleistungsrecht der §§ 434 ff. BGB | 244 | ||
| (1) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 244 | ||
| (a) Rechtsprechung | 246 | ||
| (b) Schrifttum | 246 | ||
| (2) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 247 | ||
| (a) Allgemeines Konkurrenzverhältnis | 247 | ||
| (aa) Vorrang des Kaufgewährleistungsrechts | 248 | ||
| (bb) Rückabwicklung des Kaufvertrags gem. § 249 S. 1 BGB im Wege der Naturalrestitution | 250 | ||
| (cc) Arglist des Verkäufers | 251 | ||
| (b) Besonderheiten beim Unternehmenskauf | 252 | ||
| (c) Zwischenergebnis | 254 | ||
| bb) Anfechtungsrecht nach § 123 BGB | 256 | ||
| (1) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 257 | ||
| (a) Rechtsprechung | 257 | ||
| (b) Schrifttum | 258 | ||
| (2) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 259 | ||
| (a) Allgemeines Konkurrenzverhältnis | 259 | ||
| (b) Besonderheiten beim Unternehmenskauf | 260 | ||
| (c) Zwischenergebnis | 261 | ||
| b) Sorgfaltspflichtverletzungen | 261 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 261 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 264 | ||
| (1) Bedeutung der Sorgfaltspflichtverletzung im Kaufrecht | 265 | ||
| (2) Besonderheiten beim Unternehmenskauf | 266 | ||
| (a) Sorgfaltspflichtverletzung durch positives Tun | 266 | ||
| (b) Aufklärungspflichtverletzungen durch Unterlassen | 268 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 270 | ||
| c) Verjährung | 271 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 271 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 272 | ||
| 3. Ergebnis | 273 | ||
| a) Haftung des Unternehmensverkäufers nach neuem Kaufrecht | 273 | ||
| b) Haftung des Unternehmensverkäufers aus Verschulden bei Vertragsschluss | 275 | ||
| II. Haftung beim Anteilskauf | 276 | ||
| 1. Haftung aus Kaufgewährleistungsrecht | 277 | ||
| a) Anwendbarkeit des Kaufgewährleistungsrechts | 277 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 277 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 278 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 279 | ||
| b) Heranziehung des kaufrechtlichen Rechtsmängelgewährleistungsrechts | 279 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Kaufrecht | 279 | ||
| (1) Grundsatz der Anwendbarkeit des Rechtsmängelgewährleistungsrechts | 280 | ||
| (2) Ausnahme beim Verkauf sämtlicher oder die Gesellschaft beherrschender Gesellschaftsanteile | 281 | ||
| (a) Ergänzende Rechtsprechung des BGH | 282 | ||
| (b) Konkretisierungsvorschläge durch das Schrifttum | 283 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Kaufrecht | 285 | ||
| (1) Haftung des Rechtsverkäufers | 285 | ||
| (a) Haftungsumfang | 287 | ||
| (b) Verschuldensmaßstab | 288 | ||
| (c) Zwischenergebnis | 290 | ||
| (2) Haftung des Anteilsverkäufers | 290 | ||
| (a) Grundsatz | 290 | ||
| (b) Besonderheiten beim Verkauf die Gesellschaft beherrschender Anteile | 291 | ||
| (aa) Analoge Anwendung des § 434 BGB | 291 | ||
| (bb) Beherrschende Unternehmensstellung | 293 | ||
| (cc) Weitere Konsequenzen bei Anwendbarkeit des § 434 BGB | 294 | ||
| (dd) Zwischenergebnis | 295 | ||
| c) Verjährung | 296 | ||
| d) Rechtsbehelfe des Anteilskäufers | 298 | ||
| 2. Haftung aus Verschulden bei Vertragsschluss | 300 | ||
| a) Konkurrenzverhältnis zum Rechtsmängelgewährleistungsrecht nach bisherigem Recht | 300 | ||
| b) Konkurrenzverhältnis zum Kaufgewährleistungsrecht nach neuem Recht | 301 | ||
| c) Zwischenergebnis | 302 | ||
| 3. Ergebnis | 303 | ||
| III. Haftung unabhängig von der Art des Unternehmenskaufs | 303 | ||
| 1. Positive Forderungsverletzung | 304 | ||
| a) Konkurrenzverhältnis zum Kaufgewährleistungsrecht | 304 | ||
| aa) Beurteilung nach bisherigem Kaufrecht | 304 | ||
| bb) Beurteilung nach neuem Kaufrecht | 306 | ||
| b) Verjährung | 307 | ||
| c) Zwischenergebnis | 308 | ||
| 2. Störung der Geschäftsgrundlage | 309 | ||
| a) Beurteilung nach bisherigem Schuldrecht | 309 | ||
| b) Beurteilung nach neuem Schuldrecht | 310 | ||
| c) Zwischenergebnis | 312 | ||
| 3. Ergebnis | 312 | ||
| IV. Haftung durch Übernahme selbständiger Garantien | 312 | ||
| 1. Selbständige Garantien und Haftungsausschlüsse nach bisherigem Schuldrecht | 313 | ||
| a) Selbständige Garantien | 314 | ||
| b) Haftungsausschlüsse | 316 | ||
| 2. Selbständige Garantien und Haftungsausschlüsse nach neuem Schuldrecht | 318 | ||
| a) Garantien | 318 | ||
| aa) Unselbständige Garantien gem. § 443 BGB | 319 | ||
| bb) Selbständige Garantien gem. §§ 311, 241 BGB | 320 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 321 | ||
| b) Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gem. § 444 BGB | 321 | ||
| aa) Allgemeines | 322 | ||
| (1) Problem des Haftungsausschlusses bei Übernahme einer Garantie | 322 | ||
| (2) Teleologische Reduktion des Garantiebegriffs in § 444 Var. 2 BGB | 323 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 325 | ||
| bb) Besonderheiten beim Unternehmenskauf | 325 | ||
| (1) Arglistiges Verschweigen gem. § 444 Var. 1 BGB | 327 | ||
| (2) Übernahme einer Garantie gem. § 444 Var. 2 BGB | 329 | ||
| (3) Zwischenergebnis | 330 | ||
| 3. Ergebnis | 330 | ||
| § 5 Bedeutung der Überleitungsvorschriften für die Haftung des Unternehmensverkäufers nach neuem Schuldrecht | 332 | ||
| § 6 Zusammenfassung der wichtigen Änderungen | 335 | ||
| Literaturverzeichnis | 339 | ||
| Sachwortverzeichnis | 351 |
