Vorsatz und Rechtsirrtum im Allgemeinen Strafrecht und im Steuerstrafrecht
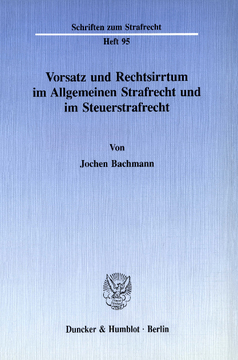
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Vorsatz und Rechtsirrtum im Allgemeinen Strafrecht und im Steuerstrafrecht
Schriften zum Strafrecht, Vol. 95
(1993)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Einführung | 13 | ||
| Teil 1: Vorsatz und Rechtsirrtum im Allgemeinen Strafrecht | 17 | ||
| A. Begriffliche Grundlagen | 17 | ||
| I. Die Bedeutung des Rechtsguts für das Strafrecht | 17 | ||
| II. Der Begriff der Norm | 18 | ||
| III. Der Begriff des normativen Tatbestandsmerkmals | 20 | ||
| IV. Der Begriff des Blankettstrafgesetzes | 23 | ||
| 1. Das Auseinanderfallen von Blankettnorm und Ausfüllungsnorm | 23 | ||
| 2. Das Auseinanderfallen von strafgesetzsetzender und blankettausfüllender Instanz | 24 | ||
| 3. Die Bedeutung der Abgrenzung der Blankettmerkmale von den Tatbestandsmerkmalen | 25 | ||
| a. Die Bedeutung der Abgrenzung für den objektiven Tatbestand | 25 | ||
| b. Die Bedeutung der Abgrenzung für die Irrtumsproblematik | 26 | ||
| c. Die Bedeutung der Abgrenzung im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 GG und § 2 Abs. 4 StGB | 26 | ||
| 4. Die Abgrenzung im Hinblick auf die Irrtumsproblematik | 28 | ||
| a. Abgrenzungsformeln der herrschenden Meinung | 28 | ||
| b. Weiterführung dieser Formeln | 30 | ||
| B. Der Vorsatz als Kenntnis der Tatumstände | 34 | ||
| I. Der Vorsatz bezüglich der (normativen) Tatbestandsmerkmale | 34 | ||
| 1. Vorsatz und Bedeutungskenntnis | 35 | ||
| a. Die Parallelbeurteilung in der Laiensphäre | 36 | ||
| b. Die Reduktion des Vorsatzes auf Tatsachenkenntnis: Kindhäuser und Dopslaff | 39 | ||
| (1) Kindhäuser | 40 | ||
| (2) Dopslaff | 42 | ||
| 2. Vorsatz und Tatsachenkenntnis | 43 | ||
| 3. Vorsatz und Unrechtsbewußtsein | 46 | ||
| 4. Vorsatz und Subsumtionsirrtum | 47 | ||
| 5. Vorsatz und Rechtsirrtum | 48 | ||
| a. Kuhlens Unterscheidung von strafrechtlichem und außerstrafrechtlichem Irrtum | 49 | ||
| (1) Die Unterscheidung von Tat- und Rechtsirrtum | 50 | ||
| (2) Die Unterscheidung von strafrechtlichem und außerstrafrechtlichem Rechtsirrtum | 57 | ||
| b. Der Rechtsirrtum im Vorfeld des Tatbestandes: Blei und Herzberg | 64 | ||
| c. Hafts Unterscheidung zwischen gegenstandsbezogenem und begriffsbezogenem Irrtum | 66 | ||
| d. Zusammenfassung | 68 | ||
| II. Der Vorsatz bezüglich der Blankettausfüllungsnormen | 69 | ||
| C. Der umgekehrte Irrtum | 73 | ||
| I. Der Umkehrschluß als formales Argument in der Diskussion um den Irrtum zuungunsten | 75 | ||
| 1. Der logische Gehalt des Umkehrschlusses | 75 | ||
| 2. Die Reichweite des Umkehrschlusses | 77 | ||
| 3. Die Anwendung des Umkehrschlusses auf § 16 StGB | 78 | ||
| a. Die Argumentation des Reichsgerichts | 79 | ||
| b. Spendel | 82 | ||
| c. Sax | 84 | ||
| d. Ergebnis | 86 | ||
| II. Der Umkehrschluß als inhaltliches Argument | 89 | ||
| 1. Umkehrprinzip und Tatirrtum | 91 | ||
| 2. Umkehrprinzip und Rechtsirrtum | 91 | ||
| a. Die strikte Anwendung des Umkehrprinzips | 94 | ||
| b. Die Ablehnung des Umkehrprinzips beim Rechtsirrtum | 95 | ||
| (1) Burkhardt | 97 | ||
| (2) Jakobs | 100 | ||
| (3) Stellungnahme | 101 | ||
| c. Differenzierende Lösungen | 107 | ||
| (1) Schlüchters Argument der mangelhaften Sachverhaltssicht | 107 | ||
| (2) Das Argument der „sozialen Erfahrungsbeziehung” – Probst | 111 | ||
| (3) Heidingsfelder | 114 | ||
| (a) Die Unterscheidung zwischen normbereichsbestimmenden und normbereichsneutralen Vorfeldnormen | 114 | ||
| (b) Stellungnahme | 118 | ||
| d. Zusammenfassung | 123 | ||
| III. Rechtsfolgen des umgekehrten Irrtums | 125 | ||
| 1. Der Begriff des Versuchs | 125 | ||
| 2. Der Strafgrund des Versuchs | 127 | ||
| a. Objektive Versuchstheorien | 127 | ||
| b. Die subjektive Theorie | 129 | ||
| c. Vermittelnde Auffassungen | 130 | ||
| (1) Die dualistische Theorie | 130 | ||
| (2) Die Eindruckstheorie | 131 | ||
| (3) Die Kritik an der Eindruckstheorie durch Zaczyk und seine interpersonale Versuchstheorie | 131 | ||
| (4) Kritik und Modifizierung der Eindruckstheorie | 137 | ||
| 3. Die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs | 138 | ||
| a. Die Untauglichkeit des Subjekts | 138 | ||
| b. Der absolut untaugliche Versuch | 140 | ||
| 4. Folgerungen für den umgekehrten Rechtsirrtum | 141 | ||
| 5. Die Vereinbarkeit der Lösung mit den §§ 22, 23 StGB | 142 | ||
| D. Ergebnisse des ersten Teils | 143 | ||
| Teil 2: Vorsatz und Rechtsirrtum im Steuerstrafrecht | 145 | ||
| A. Die Entwicklung der Irrtumslehre bei der Steuerhinterziehung | 145 | ||
| I. Die Entwicklung vor Einführung der RAO | 145 | ||
| II. Die Entwicklung nach Einführung der RAO | 147 | ||
| 1. Die Irrtumsregelungen der RAO | 147 | ||
| 2. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts | 148 | ||
| 3. Der Meinungsstand in der älteren Literatur | 149 | ||
| 4. Die Rechtsprechung nach 1945 | 150 | ||
| B. Die Steuerhinterziehung durch Handeln, § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 151 | ||
| I. Der objektive Tatbestand des § 370 AO | 151 | ||
| 1. Das Rechtsgut der Steuerhinterziehung | 151 | ||
| 2. Die Merkmale des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 154 | ||
| a. Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen | 154 | ||
| (1) Der Begriff der Tatsache | 154 | ||
| (2) Steuerlich erhebliche Tatsachen | 155 | ||
| b. Die Steuerverkürzung | 156 | ||
| II. Der Vorsatz der Steuerhinterziehung | 158 | ||
| 1. Welzels Begründung der Steueranspruchstheorie | 160 | ||
| 2. In der Literatur erhobene Einwände | 160 | ||
| a. Warda | 161 | ||
| b. Maiwald | 163 | ||
| c. Roxin | 164 | ||
| d. Meyer | 165 | ||
| 3. Die Blanketteigenschaft des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 167 | ||
| a. Die formelle Blanketteigenschaft des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 167 | ||
| b. Die materielle Blanketteigenschaft des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 168 | ||
| (1) Das Merkmal der „steuerlichen Erheblichkeit” als Blankettbegriff | 168 | ||
| (2) Das Merkmal „Steuerverkürzung” als Blankettbegriff | 169 | ||
| (3) Andere Anknüpfungspunkte der Blanketteigenschaft | 172 | ||
| (4) Ergebnis | 173 | ||
| 4. Schlußfolgerungen für den subjektiven Tatbestand | 173 | ||
| a. Verkürzungsvorsatz und Anspruchskenntnis | 173 | ||
| b. Die Steuerverkürzung als Rechtspflichtmerkmal | 175 | ||
| c. Verkürzungsvorsatz und Tatsachenkenntnis | 177 | ||
| d. Steueranspruchstheorie und Kompensationsverbot | 178 | ||
| e. Ergebnis | 180 | ||
| III. Der Verbotsirrtum im Rahmen des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 181 | ||
| IV. Der umgekehrte Irrtum bei § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO | 182 | ||
| C. Die Steuerhinterziehung durch Unterlassen, § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO | 186 | ||
| I. Die Unterscheidung von Handeln und Unterlassen bei § 370 Abs. 1 AO | 186 | ||
| 1. Lütts normlogische Bedenken | 187 | ||
| 2. Das Machen unvollständiger Angaben | 189 | ||
| 3. Das Machen unrichtiger Angaben | 189 | ||
| a. Unrichtige Angaben über steueranspruchsbegründendeTatsachen | 189 | ||
| b. Unrichtige Angaben über steuermindernde Tatsachen | 190 | ||
| 4. Ergebnis | 193 | ||
| II. Vorsatz und Rechtsirrtum bei § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO | 194 | ||
| III. Der umgekehrte Irrtum bei § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO | 196 | ||
| 1. Grundsätze | 196 | ||
| 2. Die Entscheidung des Kammergerichts vom 9. September 1981 | 197 | ||
| D. Der Bannbruch, § 372 AO | 199 | ||
| I. Der Tatbestand des § 372 AO | 199 | ||
| II. Vorsatz und Rechtsirrtum bei § 372 AO | 202 | ||
| E. Ergebnisse des zweiten Teils | 202 | ||
| Schlußbetrachtung | 204 | ||
| Literaturverzeichnis | 205 |
