Anstiftervorsatz und Tatbestimmtheit
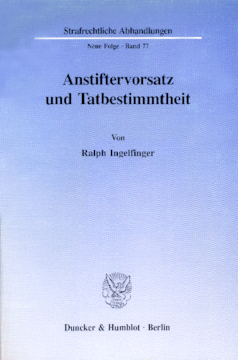
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Anstiftervorsatz und Tatbestimmtheit
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 77
(1992)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Erster Teil: Einführung und Meinungsstand | 17 | ||
| § 1 Einführung | 17 | ||
| A. Problemstellung | 17 | ||
| B. Parallelfälle | 20 | ||
| C. Grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten | 21 | ||
| § 2 Der Meinungsstand | 23 | ||
| A. Die Entscheidung des BGH | 23 | ||
| I. Der Sachverhalt der Entscheidung | 23 | ||
| II. Das Ergebnis des BGH | 24 | ||
| B. Der vorgefundene Meinungsstand | 25 | ||
| I. Frühere Rechtsprechung zum Bestimmtheitsproblem | 25 | ||
| 1. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts | 25 | ||
| a) RGSt 1, 110 | 25 | ||
| b) RGSt 34, 327 | 26 | ||
| c) Weitere Entscheidungen | 27 | ||
| 2. Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs für die Britische Zone | 28 | ||
| 3. Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs | 28 | ||
| a) BGHSt 6, 359 | 28 | ||
| b) BGHSt 15, 276 | 29 | ||
| 4. Analyse der Rechtsprechung zum Bestimmtheitsproblem vor BGHSt 34, 63 | 29 | ||
| II. Der Stand der Meinungen in der Literatur vor der Grundsatzentscheidung des BGH | 31 | ||
| 1. Allgemeine Lehrbuch- und Kommentarliteratur | 31 | ||
| a) Neuere Stellungnahmen | 31 | ||
| b) Ältere Stellungnahmen | 34 | ||
| 2. Speziellere Untersuchungen | 35 | ||
| a) Die Auffassung Montenbrucks | 35 | ||
| b) Die Auffassung Drehers | 37 | ||
| aa) Der Standpunkt | 37 | ||
| bb) Kritische Stellungnahme | 38 | ||
| c) Die Auffassung Rogalls | 40 | ||
| III. Zusammenfassung zu dem vom BGH vorgefundenen Meinungsstand | 41 | ||
| C. Die Gründe der neuen Entscheidung des BGH und die Folgen des Urteils für das Bestimmtheitsproblem | 42 | ||
| I. Die Begründung des BGH | 42 | ||
| II. Die Konsequenzen der neuen Entscheidung für das notwendige Maß an Bestimmtheit | 43 | ||
| III. Kritische Würdigung der Entscheidung des BGH | 45 | ||
| D. Die Reaktionen auf die Entscheidung des BGH | 46 | ||
| I. Allgemeine Lehrbuch- und Kommentarliteratur | 46 | ||
| II. Die Auffassung Roxins und seine Kritik an dem BGH | 47 | ||
| 1. Der Standpunkt Roxins | 47 | ||
| 2. Kritische Stellungnahme | 49 | ||
| a) Kritik an dem Abstellen auf die „wesentlichen Dimensionen des Unrechts" | 49 | ||
| b) Kritik an der Begründung Roxins | 53 | ||
| III. Die Auffassung Herzbergs und seine Kritik an Roxin und dem BGH | 59 | ||
| 1. Der Standpunkt Herzbergs | 59 | ||
| 2. Die Kritik an dem BGH und Roxin | 60 | ||
| 3. Kritik an den Thesen Herzbergs | 62 | ||
| a) Berechtigung der Kritik Herzbergs | 62 | ||
| b) Kritik an dem Topos des „rechtlich relevanten Risikos" | 62 | ||
| aa) Gesichtspunkt des „erlaubten Risikos" | 62 | ||
| bb) Anwendung der Lehre von der objektiven Zurechnung auf Fälle der „unbestimmten Anstiftung" | 65 | ||
| (1) Inhalt der Lehre | 65 | ||
| (2) Lösung der Fälle der „unbestimmten Anstiftung" mit Hilfe der Lehre von der objektiven Zurechnung | 66 | ||
| c) Allgemeine Kritik an der These Herzbergs | 69 | ||
| E. Zusammenfassung und Ausblick | 70 | ||
| Zweiter Teil: Entwicklung einer eigenen Lösung | 73 | ||
| § 1 Die dogmatische Einordnung des Bestimmtheitsproblems | 73 | ||
| A. Praktische Bedeutung der Einordnung | 74 | ||
| B. Analyse der entscheidungserheblichen Konstellationen | 75 | ||
| I. Fälle mit intensiver Konkretisierungsleistung des Tatveranlassers | 76 | ||
| II. Fälle mit geringer Konkretisierungsleistung des Tatveranlassers | 77 | ||
| III. Konkludente Anstiftung und objektiv bestimmter Verhaltensvorschlag | 78 | ||
| C. „Bestimmen" als objektiv-subjektive Sinneinheit | 79 | ||
| § 2 Herleitung des Erfordernisses der Tatbestimmtheit | 82 | ||
| A. Die Begrenzungsfunktion des Anstiftervorsatzes | 83 | ||
| I. Ausgangspunkt | 83 | ||
| II. Die allgemeinen Grenzen des Vorsatzbegriffs | 86 | ||
| 1. Die Konkretheit des Bezugspunktes | 86 | ||
| 2. Mindestanforderungen an die psychologische Beschaffenheit des Vorsatzes | 88 | ||
| 3. Zusammenfassung der allgemeinen Vorsatzgrenzen | 89 | ||
| III. Anstiftervorsatz und Haftungsbegrenzung | 89 | ||
| 1. Anstiftervorsatz und Kenntnis subsumtionsrelevanter Umstände | 89 | ||
| a) Streng tatbestandsorientierte Haupttatbezogenheit des Anstiftervorsatzes | 90 | ||
| aa) Folgen | 90 | ||
| (1) Das Stufenverhältnis | 91 | ||
| (2) Das aliud-Verhältnis | 92 | ||
| (3) Zusammenfassung zu den Folgen einer streng tatbestandsorientierten Haupttatbezogenheit des Anstiftervorsatzes | 93 | ||
| bb) Streng tatbestandsorientierte Haupttatbezogenheit des Vorsatzes und Haftungsbegrenzung | 93 | ||
| b) Mögliche Lockerungen der streng tatbestandsorientierten Haupttatbezogenheit | 94 | ||
| aa) Anwendung der Regeln der Wahlfeststellung | 94 | ||
| (1) Die Meinungen Montenbrucks und Baumanns | 94 | ||
| (2) Kritik an den Thesen Montenbrucks und Baumanns | 96 | ||
| (a) Anwendung der Wahlfeststellungsregeln auf „Abweichungsfälle" | 96 | ||
| (b) Anwendung der Wahlfeststellungsregeln auf Fälle mit unbestimmter Vorstellung | 97 | ||
| (aa) Verstoß gegen den Grundsatz „nullum crimen sine lege" | 98 | ||
| (bb) Verstoß gegen das Schuldprinzip | 99 | ||
| (3) Bisherige Erkenntnisse; erste Folgerungen | 100 | ||
| bb) Lockerung der streng tatbestandsorientierten Haupttatbezogenheit bei tatbestandlichem Näheverhältnis | 100 | ||
| c) Ergebnis zu den Vorsatzanforderungen hinsichtlich subsumtionsrelevanter Umstände | 105 | ||
| 2. Haftungsbegrenzung und Kenntnis von weiteren Umständen der Haupttat über den tatbestandlichen Rahmen hinaus | 106 | ||
| 3. Psychologischer Gehalt des Anstiftervorsatzes | 107 | ||
| IV. Ergebnis zur Begrenzungsfunktion des Vorsatzes | 110 | ||
| Β. Tatbestimmtheit und Legitimation der Anstifterstrafe | 111 | ||
| I. Der Strafgrund der Teilnahme im allgemeinen | 112 | ||
| 1. Die Schuld- bzw. Unrechtsteilnahmetheorien | 113 | ||
| a) Die Schuldteilnahmetheorie | 113 | ||
| b) Die Unrechtsteilnahmetheorie | 113 | ||
| 2. Die Verursachungstheorien | 115 | ||
| a) Die reine Verursachungstheorie | 115 | ||
| b) Die akzessorietätsorientierte Verursachungstheorie | 116 | ||
| 3. Die Solidarisierung mit fremden Unrecht als Strafgrund der Teilnahme (Schumann) | 117 | ||
| a) Ausgangspunkt | 117 | ||
| b) Stellungnahme | 119 | ||
| II. Der besondere Strafgrund der Anstiftung | 120 | ||
| 1. Der Korrumpierungsgedanke als zusätzlicher Strafgrund | 121 | ||
| 2. Neidlinger | 121 | ||
| 3. Schulz und Bloy | 122 | ||
| 4. Stellungnahme | 123 | ||
| III. Unterschiede des Rechtsgutsangriffs des Anstifters im Gegensatz zum Gehilfen | 124 | ||
| IV. Straf grund der Anstiftung und zwingendes Mindestmaß an Tatbestimmtheit | 127 | ||
| 1. Ausgangspunkt Verursachungstheorie | 127 | ||
| 2. Verursachungstheorie und Tatbestimmtheit | 128 | ||
| V. Der Grundsatz der Gleichbestrafung und die darin vorausgesetzte gleiche Strafwürdigkeit von Anstifter und Täter | 130 | ||
| 1. Der Grundsatz der Gleichbestrafung | 131 | ||
| 2. Begründungen für die Rechtfertigung der tätergleichen Strafe | 131 | ||
| a) Das Einheitstäterprinzip und die Urheberschaft | 131 | ||
| b) Der extensive Täterbegriff | 131 | ||
| c) Die besondere Gefährlichkeit der Anstiftung | 132 | ||
| 3. Ansätze in der Literatur auf Basis der Gleichwertigkeit von Anstifter- und Täterhandlung und deren Nutzbarkeit für die Tatbestimmtheitsproblematik | 133 | ||
| a) Die verschiedenen Konzeptionen | 133 | ||
| aa) Der Gedanke der Kollusion | 134 | ||
| bb) Die Lehre vom Unrechtspakt (Puppe) | 134 | ||
| cc) Der Tatentschluß in Abhängigkeit vom Willen des Anstifters (Jakobs) | 135 | ||
| b) Nutzbarkeit der vertretenen Ansätze für das Problem der Tatbestimmtheit | 135 | ||
| VI. Gleichbestrafungsgrundsatz und Tatbestimmtheit (Die eigene Ansicht zum Bestimmtheitsproblem) | 137 | ||
| 1. „Unbestimmte Anstiftung" als intellektuelle Unterordnung | 137 | ||
| 2. Die voluntative Beziehung des Anstifters zur Tat | 140 | ||
| a) Andere Anstiftungsfälle mit schwacher intellektueller Einflußnahme des Tatveranlassers | 140 | ||
| aa) Der Standpunkt der h. L. und der Rechtsprechung zur Problematik des Tatgeneigten und bedingt Tatentschlossenen | 141 | ||
| bb) Der Ansatz Neidlingers | 142 | ||
| (1) Der Ausgangspunkt | 142 | ||
| (2) Die Konkretisierung des Dominanzgedankens durch Neidlinger | 142 | ||
| cc) Stellungnahme | 143 | ||
| b) Die „voluntative Dominanz" des Veranlassers | 144 | ||
| 3. Wechselwirkung von intellektueller und voluntativer Anstiftungskomponente | 148 | ||
| a) Ausgangspunkt | 148 | ||
| b) Folgen für die eigene Ansicht zur Tatbestimmtheit | 149 | ||
| C. Zusammenfassung des eigenen Ansatzes | 150 | ||
| § 3 Verhältnis des eigenen Ansatzes zu anderen Fallgruppen der Tatbestimmtheit | 151 | ||
| A. Verhältnis zu § 111 StGB | 151 | ||
| B. Verhältnis zur Beihilfe | 154 | ||
| I. Meinungsstand zur Tatbestimmtheit bei der Beihilfe | 154 | ||
| II. Folgen des eigenen Ansatzes für die Beihilfe im allgemeinen | 156 | ||
| III. „Unbestimmte Anstiftung" als psychische Beihilfe | 157 | ||
| C. Verhältnis zur mittelbaren Täterschaft | 159 | ||
| I. Vergleich der Bestimmtheitsproblematik | 159 | ||
| II. Verhältnis der mittelbaren Täterschaft zu den dem eigenen Ansatz zugrundeliegenden Maßprinzipien | 160 | ||
| D. Verhältnis zu § 30 II StGB (Verbrechensverabredung) | 162 | ||
| I. Problemstellung | 162 | ||
| II. Meinungsstand zum Bestimmtheitsproblem | 162 | ||
| III. Stellungnahme | 163 | ||
| IV. Vergleich mit der eigenen Ansicht zur Anstiftung | 165 | ||
| E. Verhältnis zur vorsätzlichen actio libera in causa | 166 | ||
| I. Problemstellung | 166 | ||
| II. Vergleich mit der eigenen Ansicht zur Anstiftung | 169 | ||
| F. Verhältnis zu § 241 StGB (Bedrohung) | 170 | ||
| I. Problemstellung | 170 | ||
| II. Bestimmtheit des Verbrechens bei § 241 StGB | 171 | ||
| III. Vergleich mit der Bestimmtheitsproblematik bei der Anstiftung | 172 | ||
| § 4 Zusammenfassung des eigenen Standpunktes und Ausblick auf den weiteren Gang der Untersuchung | 173 | ||
| § 5 Präzisierung des eigenen Ansatzes | 175 | ||
| A. Einzelfälle mit „voluntativer Dominanz" | 175 | ||
| I. Fälle mit extremem „Übergewicht" des Hintermannes | 175 | ||
| II. Fälle der Willensbeugung (Nötigungsfälle) | 177 | ||
| III. Notstandsähnliche seelische Beeinflussung | 178 | ||
| IV. Andere Fälle mit „voluntativer Dominanz" des Anstifters | 179 | ||
| 1. Der „Bravo" | 179 | ||
| 2. Bandenchef | 181 | ||
| 3. Organisatorische Machtapparate | 183 | ||
| V. Zusammenfassung zu Fällen mit „voluntativer Dominanz" | 185 | ||
| B. Präzisierung der intellektuellen Komponente | 185 | ||
| I. Die Fälle der Anstiftung eines Tatentschlossenen zur Tatänderung (sog. Umstimmungsfälle) | 187 | ||
| 1. Einführung in die Problematik | 187 | ||
| 2. Einzelfälle und Lösungen | 188 | ||
| a) Änderung der Tatzeit oder des Tatortes | 189 | ||
| b) Änderungen der Ausführungsweise | 190 | ||
| c) Der Austausch des Tatobjektes bzw. des Opfers | 191 | ||
| aa) Personenbezogene Rechtsgüter | 192 | ||
| bb) Sachbezogene Rechtsgüter | 192 | ||
| (1) Der Austausch des Tatobjektes | 192 | ||
| (2) Der Austausch des Opfers | 193 | ||
| 3. Übertragung auf das Problem der Tatbestimmtheit bei der Anstiftung | 194 | ||
| a) Denkbare hypothetische Übertragungsregeln | 194 | ||
| b) Überprüfung der hypothetischen Regeln | 194 | ||
| aa) Konkrete Ergebnisse aufgrund der Hypothesen | 194 | ||
| bb) Tragfähigkeit der Hypothesen | 195 | ||
| 4. Erste Folgerungen für das Problem der Tatbestimmtheit | 196 | ||
| a) Unterschiedliche Bedeutung der verschiedenen Merkmale | 196 | ||
| b) Das Lenkungsmoment | 196 | ||
| II. Die Abweichungs- bzw. Exzeßfälle | 198 | ||
| 1. Einführung in die Problematik | 198 | ||
| 2. Einteilung in systematische Gruppen | 199 | ||
| a) Abweichungen in der Tatzeit | 200 | ||
| b) Abweichungen vom vorgestellten Tatort | 201 | ||
| c) Abweichungen in der Handlungsmodalität | 201 | ||
| d) Abweichungen in der Intensität der Rechtsgutsverletzung | 202 | ||
| e) Abweichungen hinsichtlich des Tatobjektes oder des Rechtsgutsträgers | 202 | ||
| aa) Unbewußte Abweichungen | 202 | ||
| bb) Bewußte Abweichungen | 204 | ||
| (1) Delikte mit personenbezogenen Rechtsgütern | 204 | ||
| (2) Delikte mit (auch) sachbezogenen Rechtsgütern | 204 | ||
| 3. Übertragung der Abweichungsregeln auf die Problematik der Tatbestimmtheit | 206 | ||
| a) Berechtigung der Übertragung | 206 | ||
| b) Die Prämissen der Übertragung | 207 | ||
| 4. Einzelergebnisse der Übertragung und Überprüfung der Hypothesen | 208 | ||
| a) Tatzeit und Tatort | 208 | ||
| b) Handlungsmodalität | 208 | ||
| c) Intensität der Rechtsgutsverletzung | 209 | ||
| d) Tatobjekt bzw. Rechtsgutsträger | 209 | ||
| III. Folgerungen für die Tatbestimmtheit | 210 | ||
| 1. Das Lenkungsmoment als wesentliches Kennzeichen der intellektuellen Anstiftung | 210 | ||
| a) Ausgangspunkt | 210 | ||
| b) Das Lenkungsmoment als typisches Merkmal der Anstiftung in intellektueller Hinsicht | 211 | ||
| c) Der Lenkungsgedanke als Rechtfertigung der Gleichbestrafung von Anstifter und Täter | 212 | ||
| 2. Anforderungen an die intellektuelle Seite der Anstiftung (das Maß der Bestimmtheit) | 215 | ||
| a) Ausgangspunkt | 215 | ||
| b) Erfolgsdelikte | 216 | ||
| c) Tätigkeitsdelikte | 219 | ||
| IV. Zusammenfassung des eigenen Ansatzes | 220 | ||
| § 6 Lösung der Problemfälle mit Hilfe des gefundenen Ansatzes | 223 | ||
| A. Allgemeinere Vorstellung des Anstifters von der Haupttat als der tatbestandliche Rahmen | 223 | ||
| Fall 1 | 223 | ||
| B. Die Haupttat ist in der Vorstellung des Anstifters nur dem Tatbestande nach umschrieben | 224 | ||
| Fall 2 | 224 | ||
| C. Kenntnis des Anstifters über den Tatbestand hinaus | 225 | ||
| I. Kenntnis der Art und Weise der Begehung | 225 | ||
| Fall 2 a | 225 | ||
| II. Kenntnis der „wesentlichen Unrechtsdimensionen" | 226 | ||
| Fall 2 b | 226 | ||
| III. Das Tatobjekt ist gattungsmäßig bestimmt | 226 | ||
| Fall 3 | 226 | ||
| Fall 4 | 227 | ||
| Fall 5 | 228 | ||
| Der Fall des BGH | 229 | ||
| Ergebnis der Untersuchung | 232 | ||
| Literaturverzeichnis | 237 |
