Grund und Grenzen des strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips auf der Basis eines generalpräventiv-funktionalen Schuldmodells
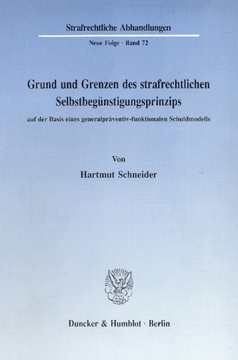
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Grund und Grenzen des strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips auf der Basis eines generalpräventiv-funktionalen Schuldmodells
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 72
(1991)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Kapitel 1: Einleitung | 15 | ||
| I. Problemstellung | 15 | ||
| 1. Der allgemeine Ausgangspunkt der Selbstbegünstigungsdiskussion | 16 | ||
| 2. Zwei Problemkomplexe im besonderen | 18 | ||
| II. Ablauf und Grenzen der vorliegenden Untersuchung | 23 | ||
| Erster Teil: Der strafprozessuale „nemo-tenetur“-Grundsatz und das strafrechtliche Schuldprinzip | 27 | ||
| Kapitel 2: Der „nemo-tenetur“-Grundsatz und das strafrechtliche Selbstbegünstigungsprinzip | 27 | ||
| I. Der Regelungsumfang des „nemo-tenetur“-Grundsatzes | 28 | ||
| 1. Die traditionelle Inhaltsbestimmung | 28 | ||
| a) Recht zur Passivität | 28 | ||
| b) Grenzen des privilegierenden Regelungsgehalts | 30 | ||
| 2. Neuere Ansätze zur Erweiterung des Regelungsgehalts | 31 | ||
| a) Grundsätzliche Öffnung des Rechtsinstituts für aktive Verhaltensweisen (Kühne) | 31 | ||
| aa) Ausgangsthesen | 31 | ||
| bb) Stellungnahme | 32 | ||
| b) Differenzierung nach Zwangsformen (Reiß) | 34 | ||
| aa) Vis compulsiva als neuer Abgrenzungsmaßstab | 34 | ||
| bb) Stellungnahme | 35 | ||
| II. Rechtstheoretische, insbesondere verfassungsrechtliche Begründung | 37 | ||
| 1. Verfassungsrechtliche Ausgangspunkte | 37 | ||
| 2. Herleitung aus dem Rechtsstaatsprinzip | 38 | ||
| a) Vorüberlegungen zum Rechtsstaatsverständnis | 38 | ||
| b) Der „nemo-tenetur“-Grundsatz als Ausfluß althergebrachter rechtsstaatlicher Überzeugungen | 40 | ||
| c) Auswirkungen der rechtsstaatlichen Verankerung auf die personale Schutzrichtung | 42 | ||
| 3. Herleitung aus Art. 2 I und 1 I GG | 43 | ||
| a) Die „nemo-tenetur“-Konzeption Rogalls | 43 | ||
| b) Kritik der würderechtlichen Ableitung von „nemo tenetur“ | 45 | ||
| III. Exkurs: Auswirkungen auf die Unterlassungsdogmatik | 50 | ||
| 1. Ausgangslage | 50 | ||
| 2. Lösung der Unterlassungskonstellationen | 51 | ||
| Kapitel 3: Auswirkungen moderner Schuldkonzeptionen auf das Verständnis des strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips | 54 | ||
| I. Problemstellung | 54 | ||
| II. Das Verhältnis von Schuld und Prävention im Rahmen moderner Schuldmodelle | 56 | ||
| 1. Der soziale Schuldbegriff als Grundlage präventiv durchstrukturierter Schuldmodelle | 56 | ||
| 2. Das Modell der Integrationsprävention – kriminalpolitische Öffnungsklausel präventiv durchstrukturierter Schuldmodelle | 60 | ||
| 3. Einzelne generalpräventiv-funktionale Schuldkonzeptionen – dargestellt am Beispiel des § 35 I StGB | 63 | ||
| a) Die Verzahnung von Schuld und Prävention | 64 | ||
| aa) Generalpräventive Elemente der Entschuldigung | 66 | ||
| bb) Generalpräventive Elemente der Gegenausnahmen | 67 | ||
| b) Generalpräventiv-funktionale Schuldaspekte im Rahmen von § 20 StGB | 68 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 70 | ||
| III. Kritik und Anti-Kritik der generalpräventiv-funktionalen Schuldkonzeptionen | 71 | ||
| 1. Überblick über die Einwände der Kritiker generalpräventiv beeinflußter Schuldmodelle | 71 | ||
| 2. Empirische Einwände | 72 | ||
| a) Stoßrichtung der Kritik | 72 | ||
| b) Kritik empirisch motivierter Bedenken | 73 | ||
| aa) Verifikationsdefizite | 73 | ||
| bb) Rationaler Vorsprung funktionaler Modelle | 74 | ||
| 3. Verfassungsrechtliche Gerechtigkeitseinwände | 78 | ||
| a) Stoßrichtungen der Kritik (Übermaßstrafen; Menschenwürdeverletzung; Bestrafung Schuldunfähiger) | 78 | ||
| b) Würdigung der verfassungsrechtlich abgeleiteten Bedenken | 80 | ||
| aa) Vorüberlegungen | 80 | ||
| bb) Zum Vorwurf präventionsbedingter Bestrafung Schuldunfähiger | 82 | ||
| cc) Zum Vorwurf präventionsindizierter Übermaßstrafen | 84 | ||
| dd) Zum Vorwurf der Menschenwürdeverletzung | 87 | ||
| 4. Präventionsunabhängige Erklärungen des § 35 I StGB? | 93 | ||
| a) Präsentation des kompensatorischen Entschuldigungsmodells (Rudolphi) | 94 | ||
| b) Strafrechtsdogmatische Defizite des notstandsspezifischen Kompensationsmodells | 95 | ||
| IV. Zusammenfassung und Folgerungen für die Untersuchung des strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips | 97 | ||
| Zweiter Teil: Analyse von selbstbegünstigungsrelevanten Straftatbeständen | 99 | ||
| 1. Abschnitt: Fälle belastender Selbstbegünstigung | 99 | ||
| Kapitel 4: Gewaltsame Selbstbegünstigung | 99 | ||
| I. Verdeckungsmord | 100 | ||
| 1. Verdeutlichung der Selbstbegünstigungsproblematik | 100 | ||
| 2. Historische Entwicklung des Mordmerkmals „Verdeckungsabsicht“ | 103 | ||
| a) § 211 RStGB bis zur Reform des Jahres 1943 | 103 | ||
| b) Nachkriegsentwicklung bis zum E 62 | 105 | ||
| 3. Das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht vor dem Hintergrund eines kriminalpolitisch-funktionalen Schuldverständnisses | 107 | ||
| a) Schuldspezifische Ausgangslage | 107 | ||
| b) Generalpräventive Wertungsfaktoren | 109 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 110 | ||
| II. Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenverkehr | 112 | ||
| 1. Die §§ 315 III Nr. 2 und 315 b III StGB im Selbstbegünstigungskontext | 112 | ||
| 2. Zur Auslegung minder schwerer Selbstbegünstigungsfälle im Rahmen der §§ 315 III Nr. 2 und 315 b III StGB | 113 | ||
| a) Ansätze zur Erfassung von Selbstbegünstigungskonstellationen | 114 | ||
| b) Ausklammerung von Selbstbegünstigungskonstellationen auf der Basis strafrahmenmodifizierender halbabstrakter Wertgruppen | 115 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 116 | ||
| III. Gefangenenmeuterei | 117 | ||
| 1. Verdeutlichung der Selbstbegünstigungsproblematik | 117 | ||
| 2. Generalpräventive Gründe der Strafschärfung | 118 | ||
| IV. Räuberischer Diebstahl | 121 | ||
| 1. Verdeutlichung der Selbstbegünstigungsproblematik | 121 | ||
| 2. Gründe für die strafschärfende Bewertung der Selbstbegünstigungsabsicht | 123 | ||
| a) Die sog. „Hätte-auch“-These des Reichsgerichts | 123 | ||
| aa) Komparative Ausgangserwägung | 123 | ||
| bb) Kritik | 124 | ||
| b) Generalpräventive Erklärungsansätze | 125 | ||
| 3. Zur Auslegung des Absichtsmerkmals | 127 | ||
| a) Beschränkung auf materielle Vorteilssicherung? | 127 | ||
| b) Zur generalpräventiv-dogmatischen Notwendigkeit der Erfassung reiner Strafvereitelungsfälle | 128 | ||
| V. Zusammenfassung | 129 | ||
| Kapitel 5: Verkehrsunfallflucht (§ 142 StGB) | 131 | ||
| I. Die selbstbegünstigungsspezifische Spannungslage des § 142 StGB | 131 | ||
| 1. Kriminologischer Hintergrund | 131 | ||
| 2. Schutzzweck und kriminalpolitische Leitgedanken des § 142 StGB | 133 | ||
| a) § 142 StGB als Vermögensgefährdungsdelikt | 133 | ||
| b) Kriminalpolitische Leitgedanken | 135 | ||
| aa) Individualethische Erklärungen | 135 | ||
| bb) Verkehrsspezifische Erklärungen | 136 | ||
| II. Verfassungskonforme Auslegung des § 142 StGB | 137 | ||
| 1. Passivpflichten | 140 | ||
| a) Die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit im Lichte eines traditionellen „nemo-tenetur“-Verständnisses | 140 | ||
| b) Abweichende verfassungsrechtliche Beurteilung unter Verweis auf den Gemeinschuldner-Beschluß (Reiß) | 140 | ||
| c) Stellungnahme | 142 | ||
| aa) Generelle Stoßrichtung des Gemeinschuldner-Beschlusses | 142 | ||
| bb) Auswirkungen auf einzelne Auslegungsfragen | 144 | ||
| 2. Aktivpflichten | 148 | ||
| a) Zur Unbedenklichkeit der Vorstellungspflicht | 149 | ||
| b) Verfassungsrechtlich gebotene Restriktion der nachträglichen Meldepflichten | 149 | ||
| III. Zusammenfassung | 152 | ||
| 2. Abschnitt: Delikte mit entlastender Selbstbegünstigung | 154 | ||
| Kapitel 6: Selbstbegünstigungsprivilegien im Rahmen der sogenannten Anschlußdelikte (§§ 257–259 StGB) | 154 | ||
| I. Strafvereitelung | 154 | ||
| 1. Selbstbegünstigungsabsicht im Rahmen des § 258 I, II StGB | 155 | ||
| a) Dogmatische Ausgangslage und schuldpsychologische Privilegienerklärung | 155 | ||
| b) Notwendigkeit der Anreicherung schuldpsychologischer Modelle um generalpräventive Erklärungsfaktoren | 157 | ||
| 2. Selbstbegünstigungsabsicht im Rahmen des § 258 V StGB | 160 | ||
| a) Reichweite der Selbstbegünstigungsklausel | 160 | ||
| b) Fälle ungeklärter Vortat-Beteiligung | 162 | ||
| aa) Postpendenzerwägungen | 163 | ||
| bb) Wahlfeststellungserwägungen | 164 | ||
| cc) „In-dubio-pro-reo“-Grundsatz | 169 | ||
| II. Sachliche Begünstigung | 169 | ||
| 1. Selbstbegünstigungsabsicht im Rahmen des § 257 I, III 1 StGB | 169 | ||
| a) Konkurrenzrechtliche Erklärung der Selbstbegünstigungsprivilegien | 169 | ||
| b) Sonderprobleme im Rahmen des § 257 III 1 StGB | 170 | ||
| aa) Verfolgungshindernisse | 171 | ||
| bb) Zurechenbarkeit von Vortat-Exzessen über § 257 III 1 StGB? | 172 | ||
| 2. Die Sonderregelung des § 257 III 2 StGB | 175 | ||
| a) Ablehnende Stellungnahmen im strafrechtlichen Schrifttum | 176 | ||
| b) Kritik der teilnahmespezifischen Ablehnungsgründe | 176 | ||
| III. Hehlerei | 179 | ||
| 1. Unstreitig privilegierte Selbstbegünstigungshandlungen | 179 | ||
| 2. Umstrittene Selbstbegünstigungskonstellationen | 179 | ||
| a) Fälle des strafbaren Beuterückerwerbs durch den Ersttäter | 179 | ||
| b) Straflose Beuteübernahme durch den Mittäter der Vortat | 183 | ||
| c) Strafbare Beuteübernahme durch den Anstifter zur Vortat | 184 | ||
| IV. Zusammenfassung | 186 | ||
| Kapitel 7: Die Gefangenenbefreiung | 187 | ||
| I. Die Gefangenenselbstbefreiung | 187 | ||
| 1. Präsentation und Kritik herkömmlicher Begründungen der Straflosigkeit der Selbstbefreiung | 187 | ||
| 2. Generalpräventiv-kriminalpolitische Privilegienerklärung | 190 | ||
| II. Selbstbegünstigungsmotivierte Beteiligung an der Fremdbefreiung | 193 | ||
| 1. Ausgangsfälle im Lichte der höchstrichterlichen Rechtsprechung | 193 | ||
| 2. Herkömmliche Stellungnahmen des strafrechtlichen Schrifttums | 196 | ||
| a) Rechtsgut- und teilnahmespezifische Erklärungsansätze | 196 | ||
| b) Schuldpsychologische Erklärungsansätze | 201 | ||
| 3. Straflosigkeit der selbstbegünstigungsmotivierten Anstiftung auf der Basis eines kriminalpolitisch-funktionalen Schuldverständnisses | 203 | ||
| a) Einschlägigkeit der normativen Isolierungsthese? | 203 | ||
| b) Straflosigkeit infolge faktischer Isolationstechniken | 205 | ||
| 4. Selbstbegünstigungskonforme Rechtsfortbildung im Hinblick auf § 258 V StGB | 208 | ||
| a) Präsentation und Kritik der herkömmlich vertretenen Güterpolarität | 209 | ||
| b) Dogmatische Folgerungen der Rechtsgüterharmonisierungen | 213 | ||
| Kapitel 8: Aussagedelikte | 215 | ||
| I. Selbstbegünstigung im Rahmen der §§ 153 und 154 StGB | 216 | ||
| 1. Gründe für die Straflosigkeit der Beschuldigtenlüge | 216 | ||
| a) Strafprozessualer Erklärungsansatz | 217 | ||
| b) Materiell-rechtlicher Erklärungsansatz (Lehmann) | 218 | ||
| c) Historischer Erklärungsansatz (v. Liszt) | 219 | ||
| 2. Auswirkungen der selbstbegünstigungsfreundlichen Tatbestandsfassung auf Anstiftungskonstellationen? | 221 | ||
| a) Norminterne Schulderwägungen | 221 | ||
| b) Privilegienerweiterung durch Rechtsfortbildung? | 224 | ||
| II. Die personale Reichweite des Selbstbegünstigungsprivilegs aus § 157 I StGB | 226 | ||
| 1. Herkömmliche Erklärungsansätze | 226 | ||
| 2. Der rein schuldpsychologische Deutungsversuch Bemmanns | 229 | ||
| 3. Zur Notwendigkeit ergänzender generalpräventiver Erklärungsmomente (Sonderopfer) | 230 | ||
| Dritter Teil: Die Reichweite der Selbstbegünstigungsprivilegien im Rahmen der §§ 145 d II Nr. 1 und 164 StGB | 237 | ||
| 1. Abschnitt: Die selbstbegünstigungskonforme Rechtsanwendung des § 145 d II Nr. 1 StGB | 237 | ||
| Kapitel 9: Die Berücksichtigung des Selbstbegünstigungsgedankens im Rahmen des § 145 d StGB durch Rechtsprechung und Schrifttum | 237 | ||
| I. Ausgangspunkte der selbstbegünstigungsspezifischen Spannungslage der Beteiligtentäuschung | 237 | ||
| II. Aktuelle Tendenzen zur Privilegierung der Selbstbegünstigungsabsicht | 240 | ||
| 1. Selbstbegünstigungskonforme Behandlung der Fälle des Abstreitens der Tatbegehung | 241 | ||
| a) Strafprozessuale Ausgangsüberlegungen | 241 | ||
| b) Kritische Würdigung des „nemo-tenetur“-Ansatzes | 243 | ||
| aa) Erwägungen zum Regelungsgehalt | 243 | ||
| bb) Erwägungen zur beweisrechtlichen Verarbeitung | 245 | ||
| 2. Selbstbegünstigungskonforme Behandlung der Fälle der Verdachtsablenkung | 249 | ||
| a) Erstellung von Fallgruppen | 249 | ||
| aa) Verdachtsablenkung und Gefahrenanalyse | 250 | ||
| bb) Alibi-Fälle und Schutzzwecknormativierung | 252 | ||
| b) Kritik der rechtsgutorientierten Privilegierungstendenzen | 254 | ||
| aa) Schwachpunkte der normativen Rechtsgutbetrachtung | 255 | ||
| bb) Schwachpunkte der rechtsgutorientierten Gefahrenbetrachtung | 260 | ||
| 3. Fallgruppenübergreifende Restriktionstendenzen innerhalb des subjektiven Tatbestandes | 265 | ||
| a) Ausgangserwägungen zur Vorsatzbestimmung (Eignungsthese) | 265 | ||
| b) Kritik der subjektiven Eignungsthese | 266 | ||
| III. Ergebnis | 270 | ||
| Kapitel 10: Globale Lösungsansätze zur selbstbegünstigungskonformen Rechtsanwendung des § 145 d II Nr. 1 StGB | 271 | ||
| I. Die strafrechtliche Konkurrenzlehre? | 271 | ||
| 1. Konzept einer selbstbegünstigungsfreundlichen Auslegung der Subsidiaritätsklausel | 271 | ||
| 2. Kritik der Konkurrenzlösung | 273 | ||
| a) Kriminalpolitische Vorbehalte | 273 | ||
| b) Konkurrenzrechtliche Bedenken | 274 | ||
| II. Selbstbegünstigungskonforme Rechtsfortbildung | 277 | ||
| 1. Methodologische Vorüberlegungen | 278 | ||
| 2. Vergleich der Regelungszwecke der §§ 145 d II Nr. 1 und 258 StGB | 280 | ||
| a) These der Güterpolarität | 280 | ||
| b) Rechtsgütervergleich | 282 | ||
| c) Schutzzweckbetrachtung auf der Basis einer ganzheitlichen Funktionsanalyse | 282 | ||
| aa) Richtigkeits- und Effektivitätsschutz im Rahmen des § 258 StGB | 283 | ||
| bb) Verfehltheit einer Differenzierung nach Regelungszwecken und Schutzreflexen | 286 | ||
| cc) Kriminalpolitische Aspekte | 290 | ||
| 3. Planwidrigkeit der Gesetzeslücke | 292 | ||
| a) Plankonformität der Regelungslücke im Lichte neuerer Gesetzesänderungen? | 292 | ||
| aa) Ausgangsthese | 293 | ||
| bb) Kritik | 294 | ||
| b) Regelungspläne des historischen Gesetzgebers | 296 | ||
| c) Zwischenergebnis | 298 | ||
| 4. Verbrechenssystematische Umsetzung der Rechtsfortbildung | 298 | ||
| a) Alternativen in Gestalt der Tatbestands- bzw. Schuldlösung | 298 | ||
| b) Dogmatische und kriminalpolitische Vorzugswürdigkeit der Schuldlösung | 300 | ||
| III. Zusammenfassung | 301 | ||
| 2. Abschnitt: Die „selbstbegünstigungskonforme“ Rechtsanwendung des § 164 StGB | 302 | ||
| Kapitel 11: Die Stellung des Straftatbestandes der falschen Verdächtigung im Selbstbegünstigungskontext | 302 | ||
| I. Lösungsansätze zur Privilegierung selbstbegünstigender Falschverdächtigungen | 303 | ||
| 1. Dogmatischer Ausgangspunkt | 303 | ||
| 2. Kritik der herkömmlichen Lösungsansätze | 305 | ||
| a) Verfehltheit prozessualer Lösungsmodelle | 305 | ||
| b) Schwachpunkte der rechtsgutorientierten Gefährlichkeitsanalyse | 307 | ||
| II. Alternative Ansätze zur Privilegierung selbstbegünstigender Falschverdächtigungen | 308 | ||
| 1. Selbstbegünstigungskonforme Auslegung des Tatbestandes | 309 | ||
| a) Auslegung des Tatbestandsmerkmals Verdächtigung | 309 | ||
| b) Auslegung des subjektiven Tatbestandes | 311 | ||
| c) Zwischenergebnis | 314 | ||
| 2. Selbstbegünstigungskonforme Rechtsfortbildung des Tatbestandes? | 314 | ||
| a) Bestimmung des durch § 164 StGB geschützten Rechtsguts | 315 | ||
| aa) Vier denkbare Rechtsgutbestimmungen | 315 | ||
| bb) Zur Vorzugswürdigkeit der rein privatschützenden Sichtweise | 316 | ||
| cc) Auswirkungen einer rein privatschützenden Sichtweise | 319 | ||
| b) Analoge Heranziehung des § 193 StGB? | 320 | ||
| III. Zusammenfassung | 322 | ||
| Vierter Teil: Versuch einer Systematisierung der selbstbegünstigungsrelevanten Straftatbestände | 325 | ||
| Kapitel 12: Allgemeine Systematisierungsansätze | 325 | ||
| I. Einleitende Vorbemerkungen | 325 | ||
| II. Monokausale Modelle | 326 | ||
| 1. Rechtsgutorientierte Systematisierungsansätze | 327 | ||
| a) Ausgangsthesen | 327 | ||
| b) Würdigung des rechtsgutorientierten Modells | 328 | ||
| 2. Verhaltensbezogene (aktionale) Systematisierungsansätze | 332 | ||
| a) Ausgangsthesen | 332 | ||
| b) Würdigung des aktionalen Modells | 333 | ||
| aa) Privilegierender Bereich | 333 | ||
| bb) Belastender Bereich | 334 | ||
| III. Strukturierung der privilegierten Selbstbegünstigung auf der Basis unterschiedlicher Modelle | 336 | ||
| 1. Formale und materiale Aspekte der privilegierten Vorteilssicherung | 337 | ||
| 2. Formale Aspekte der strafvereitelnden Selbstbegünstigung | 340 | ||
| a) Rechtsgutorientierte Grundlage der Systematik | 340 | ||
| b) Aktionale Ergänzungen in Form der Privilegienverengung auf Flucht und Lüge | 343 | ||
| c) Zwischenergebnis | 345 | ||
| Kapitel 13: Gründe für die Privilegierung strafvereitelnder Selbstbegünstigungshandlungen | 346 | ||
| I. Herkömmliche Erklärungsansätze | 347 | ||
| 1. Konkurrenzrechtliche Modelle | 347 | ||
| a) Ausgangsthesen | 347 | ||
| b) Schwachpunkte der konkurrenzrechtlichen Erklärungsmodelle | 348 | ||
| aa) Empirische Erwägungen | 348 | ||
| bb) Rechtliche Erwägungen | 349 | ||
| 2. Prozessuale Erklärungsansätze | 352 | ||
| a) „Ne-bis-in-idem“-Ansatz | 352 | ||
| aa) Ausgangsthesen | 352 | ||
| bb) Kritik | 353 | ||
| b) Unschuldsvermutung, Art. 6 II EMRK | 355 | ||
| aa) Ausgangsthesen | 355 | ||
| bb) Kritik | 356 | ||
| c) „Nemo-tenetur“-Ansatz | 358 | ||
| aa) Ausgangsthesen | 358 | ||
| bb) Kritik | 358 | ||
| 3. Schuldspezifische Erklärungsansätze | 360 | ||
| a) Der Gedanke der notstandsähnlichen Zwangslage vor dem Hintergrund kompensatorischer Entschuldigungsmodelle | 361 | ||
| aa) Ausgangsthesen | 361 | ||
| bb) Kritik | 363 | ||
| b) Zumutbarkeitsmodelle | 365 | ||
| aa) Rein psychologische Modelle | 365 | ||
| bb) Ethisierende Menschenwürde-Erklärung | 368 | ||
| II. Erklärung der selbstbegünstigungsspezifischen Strafvereitelungsprivilegien auf der Grundlage eines gemischt-funktionalen Schuldmodells | 372 | ||
| 1. Einleitende Vorbemerkungen | 372 | ||
| 2. Kriminalpolitische Gründe für die Privilegienbeschränkung auf staatsschützende Rechtspflegedelikte | 374 | ||
| a) Zur Ausgrenzung privatschützender Delikte | 374 | ||
| b) Zur Privilegienverengung auf staatliche Rechtspflegedelikte | 378 | ||
| aa) Ausgrenzung von Delikten mit gesellschaftlichen Rechtsgütern | 378 | ||
| bb) Ausgrenzung von Delikten mit akzidentiellem Rechtspflegebezug | 379 | ||
| 3. Generalpräventiv-kriminalpolitische Gründe für die Straflosigkeit der Basishandlungen „Flucht“ und „Lüge“ | 382 | ||
| a) Die kriminalpolitische Bewertung selbstbegünstigender Lügen | 383 | ||
| b) Die kriminalpolitische Bewertung selbstbegünstigender Fluchthandlungen | 385 | ||
| Literaturverzeichnis | 389 |
