Freiheitsschutz als ein Zweck des Deliktsrechts
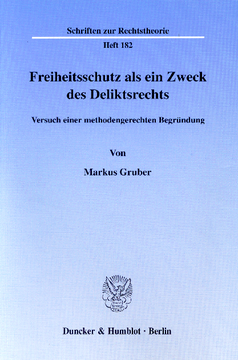
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Freiheitsschutz als ein Zweck des Deliktsrechts
Versuch einer methodengerechten Begründung
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 182
(1998)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 15 | ||
| 1. Abschnitt: Einleitung | 17 | ||
| A. Kurzüberblick über die Themenkomplexe der Arbeit | 17 | ||
| B. Notwendigkeit methodisch-theoretischer Stellungnahme | 18 | ||
| C. Zweckbegründung als Umsetzung methodisch-theoretischer Ergebnisse | 24 | ||
| D. Dogmatisches Anliegen: Zweck Freiheitsschutz | 25 | ||
| E. Ausblick | 27 | ||
| 2. Abschnitt: Methodischer Teil - Zweck: Begriff und Begründung | 28 | ||
| A. Kurzüberblick über die Vorgehensweise | 28 | ||
| B. Bestimmung des methodischen Ausgangspunktes | 29 | ||
| I. Einordnung der Theorieproblematik | 29 | ||
| 1. Vergleichbarkeit methodischer Konzeptionen: Begriffe und „Grundbegriffe" | 29 | ||
| 2. Anforderungen für die Arbeit hier | 36 | ||
| II. Hier zugrundegelegte methodische Konzeptionen | 37 | ||
| 1. Vorbemerkung - Überblick | 37 | ||
| 2. Auswahlkriterien | 38 | ||
| a) „Herrschend", „herkömmlich" | 38 | ||
| aa) Bedeutung von „herrschend" | 38 | ||
| bb) Gründe fur die Wahl des Kriteriums „herrschend" | 40 | ||
| cc) Gründe für die Wahl des Kriteriums „herkömmlich" | 42 | ||
| dd) „Herrschende" oder „herkömmliche" Methodik | 43 | ||
| b) Ergänzende Auffassungen | 45 | ||
| 3. Hier zugrundegelegte methodische Konzeptionen | 46 | ||
| a) „Herrschende" oder „herkömmliche" Konzeptionen | 46 | ||
| b) „heuere" Ansätze | 48 | ||
| IIΙ. „Vergleichbarkeit" der zugrundegelegten methodischen Ansätze | 48 | ||
| 1. Erfordernis der Vergleichbarkeit oder Kombinierbarkeit | 48 | ||
| 2. Nachweis einer Vergleichbarkeit oder Kombinierbarkeit | 48 | ||
| 3. Hindernis für Vergleichbarkeit oder Kombinierbarkeit? | 51 | ||
| a) Vorbemerkung | 51 | ||
| b) Entscheidungsfindungs- oder Begründungszusammenhang? | 51 | ||
| c) Konsequenzen einer solchen Unterscheidung | 52 | ||
| d) Terminologische Konsequenzen? | 54 | ||
| IV. Kennzeichnung des hier zugrundegelegten methodischen Konzepts | 55 | ||
| C. Vorbereitung einer Analyse von Zweckargumentation | 56 | ||
| I. Versuch einer Klärung des Begriffs Zweck | 56 | ||
| 1. Vorbemerkung - Abgrenzung | 56 | ||
| 2. Ermittlung eines allgemeinen Sprachgebrauchs | 61 | ||
| II. Beispiele für die Argumentation mit Zwecken von Normengruppen | 63 | ||
| 1. Vorbemerkung | 63 | ||
| a) Begründung der Auswahl | 64 | ||
| aa) Auswertung dogmatischer Arbeiten | 64 | ||
| bb) Erörterung von Zwecken des Schadens- und Deliktsrechts | 65 | ||
| cc) Keine Auswertung von Rechtsprechungsbeispielen | 66 | ||
| dd) Keine Beschränkung auf Erörterungen von „Zwecken" | 67 | ||
| b) Sinn einer vorgezogenen Wiedergabe von Beispielen | 68 | ||
| c) Vorgehensweise bei der Darstellung | 68 | ||
| 2. Zwecke des Deliktsrechts | 70 | ||
| a) Kötz | 70 | ||
| b) Mertens | 77 | ||
| c) Deutsch | 81 | ||
| d) Lehre vom Normzweck | 86 | ||
| e) Andere | 90 | ||
| 3. Zwecke des Schadensrechts | 96 | ||
| a) Vorbemerkung | 96 | ||
| b) Schiemann | 98 | ||
| c) Andere | 101 | ||
| IIΙ. Methodisch-theoretische Ausführungen zu Zwecken: Beispiele | 105 | ||
| 1. Vorbemerkung | 105 | ||
| 2. Beispiele | 106 | ||
| a) Fikentscher | 106 | ||
| b) Larenz | 108 | ||
| c) Mittenzwei | 112 | ||
| d) Andere | 114 | ||
| IV. Zusammenfassung | 115 | ||
| D. Analyse von Zweckargumentation | 117 | ||
| I. Darstellung des Argumentationsganges | 117 | ||
| II. Analyse der Begriffe des Zwecks und des Mittels | 117 | ||
| 1. Vorbemerkung | 117 | ||
| 2. Grundstruktur teleologischer Argumentation | 120 | ||
| a) Teleologische Begründung der Interpretation einer Einzelnorm | 120 | ||
| b) Zweckbegründung | 123 | ||
| 3. Zweckargumentation als Folgenargumentation | 125 | ||
| a) Vorbemerkung | 125 | ||
| b) Folgenberücksichtigung | 126 | ||
| c) Teleologische Argumentation als Folgenberücksichtigung | 129 | ||
| d) Konsequenzen einer solchen Sichtweise | 131 | ||
| 4. Begriffsklärung: „Zwecke", „Zustände", „Ereignisse", „Prinzipien" | 133 | ||
| 5. Konkurrierende Auffassungen von teleologischer Argumentation? | 135 | ||
| 6. Zusammenfassung und Ausblick | 138 | ||
| IIΙ. Objektiv-teleologische Argumentation | 140 | ||
| 1. Objektiv-teleologische Argumentation | 140 | ||
| 2. Zulässigkeit obj ektiv-teleologischer Argumentation | 141 | ||
| IV. Abgrenzung: Zweck - Auslegungsziel - Auslegungsmethode | 143 | ||
| 1. Notwendigkeit einer Abgrenzung | 143 | ||
| 2. Trennung von Auslegungszielen und -methoden | 144 | ||
| 3. Rangfolge- statt Auslegungszieldiskussion | 148 | ||
| 4. Ergebnis | 150 | ||
| V. Objektive Zwecke und die „Rangfolgediskussion" | 151 | ||
| 1. Darstellung der Problematik | 151 | ||
| 2. „Rangfolgediskussion" und objektiv-teleologische Argumentation | 152 | ||
| VI. Mögliche und zulässige Inhalte von Zwecken | 154 | ||
| VII. Zwecke von Normengruppen | 155 | ||
| 1. Problematik | 155 | ||
| 2. Bestimmung von Normengruppen | 156 | ||
| 3. „Anwendung" von Normengruppen | 157 | ||
| VIII. Möglichkeit und Zulässigkeit mehrerer Zwecke? | 158 | ||
| 1. Problematik | 158 | ||
| 2. Möglichkeit und Zulässigkeit einer Mehrheit von Zwecken | 159 | ||
| 3. Gewichtung von Zwecken im Vorfeld einer Einzelfallentscheidung | 161 | ||
| IX. Orte der Argumentation mit Zwecken | 162 | ||
| 1. Argumentationspraxis | 162 | ||
| 2. Besonderheiten des hier zugrundegelegten Zweckverständnisses? | 165 | ||
| 3. „Verwendungsmöglichkeiten" konkreter Zwecke | 166 | ||
| 4. Objektiv-teleologische Argumentation im Schadens- und Deliktsrecht | 166 | ||
| X. Zusammenfassung von D | 168 | ||
| E. Begründung von Zweckbehauptungen | 168 | ||
| I. Ziel - Rahmenbedingungen einer Begründung | 168 | ||
| II. „de lege lata" als Zulässigkeitsvoraussetzung für Argumente? | 172 | ||
| 1. Fragestellung | 172 | ||
| 2. Argumentation „de lege ferenda" | 173 | ||
| 3. Gesetzesbindung und teleologische Argumentation | 175 | ||
| III. Rückgriff auf andere canones als Argumente? | 176 | ||
| 1. Problematik | 176 | ||
| 2. Zweckbegründung und Wortsinngrenze | 176 | ||
| 3. Verbundenheit der canones | 178 | ||
| 4. „Systematische" Argumente | 179 | ||
| IV. Verfassungsrechtliche „Argumente"? | 181 | ||
| 1. Beispiele verfassungsrechtlicher Zweckbegründung | 181 | ||
| 2. Problemstellung | 183 | ||
| 3. Grundrechte im Zivilrecht | 184 | ||
| a) Privatrechtswirkung von Grundrechten | 184 | ||
| b) Umfang der Einwirkung von Grundrechten auf das Privatrecht | 185 | ||
| c) Grenzen verfassungskonformer Auslegung | 187 | ||
| 4. Doppelte Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Anforderungen | 191 | ||
| 5. Ergebnis | 191 | ||
| V. „Überpositive" Argumente | 192 | ||
| VI. Regeln und formale Anforderungen einer Begründung | 194 | ||
| F. Zusammenfassung und Ausblick | 196 | ||
| 3. Abschnitt: Präzisierung der Fragestellung | 198 | ||
| A. Deliktsrecht | 198 | ||
| I. Vorbemerkung | 198 | ||
| II. Tatsächlich vertretene Auffassungen von Deliktsrecht | 199 | ||
| 1. Notwendigkeit von Kriterien zur Inhalts- und Umfangsbestimmung | 199 | ||
| 2. Rechtswidrigkeit | 200 | ||
| 3. Verschulden | 203 | ||
| 4. „Wandlungen des Deliktsrechts" - Bedürfnis nach neuen Kriterien? | 204 | ||
| IIΙ. Hier zugrundegelegte Auffassung von Deliktsrecht | 206 | ||
| 1. Allgemeine Anforderungen an Normengruppen | 206 | ||
| 2. Begriffsmerkmale des Deliktsrechts | 206 | ||
| IV. Deliktsrecht als „sinnvoller" Gegenstand einer Untersuchung? | 208 | ||
| Β. Handlungsfreiheit des Einzelnen | 210 | ||
| I. Beispiele von Freiheitsumschreibungen | 210 | ||
| II. Hier zugrundegelegtes Verständnis individueller Handlungsfreiheit | 212 | ||
| 1. Notwendigkeit und Problematik einer Begriffsbestimmung | 212 | ||
| 2. Hier zugrundegelegter Freiheitsbegriff | 213 | ||
| ΙII. Allgemeine Handlungsfreiheit iSv Art. 2 I GG - Abgrenzung | 216 | ||
| IV. Besondere Freiheiten | 218 | ||
| V. „Freiheitsschutz" zulässiger Inhalt eines gesetzlichen Zwecks? | 219 | ||
| 4. Abschnitt: Begründung des Zwecks Freiheitsschutz | 220 | ||
| A. Empirischer Teil der Zweckbegründung | 220 | ||
| I. Vorbemerkung | 220 | ||
| II. Freiheitsschutz und Anwendung des Deliktsrechts | 220 | ||
| ΙII. Deliktsrecht und Freiheit als rechtliche Freiheit | 221 | ||
| IV. Deliktsrecht und Freiheit als faktische Freiheit | 223 | ||
| 1. Mögliche tatsächliche Beschränkungen von Freiheit | 223 | ||
| 2. Deliktsrecht und Freiheitsbeeinträchtigung | 225 | ||
| 3. Modifikationen eines faktischen Freiheitsbegriffs erforderlich? | 228 | ||
| 4. Einzelne Probleme einer Präventionsargumentation | 229 | ||
| 5. Versicherungsschutz als Einwand gegen Präventionswirkungen? | 233 | ||
| a) Einordnung des Einwands | 233 | ||
| b) Argumente gegen diesen Einwand | 234 | ||
| V. Freiheitsbeeinträchtigung durch negatorische Ansprüche | 238 | ||
| VI. Ergebnis | 239 | ||
| B. Normativer Teil der Zweckbegründung | 239 | ||
| I. Vorbemerkung | 239 | ||
| II. Argumente fur einen „Zweck" Freiheitsschutz | 243 | ||
| 1. Tatsächliche Freiheitsbeeinträchtigungen als „Argument"? | 243 | ||
| a) Fragestellung | 243 | ||
| b) Verweis auf allgemeine Folgenargumentation | 244 | ||
| c) Bloße Beeinträchtigung als „Argument"? | 245 | ||
| 2. Verfassungsrechtliche Argumente | 246 | ||
| a) Inhaltliche Eingrenzung auf Art. 2 I GG | 246 | ||
| b) Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit durch Art. 2 I GG | 249 | ||
| aa) Allgemeines Freiheitsrecht als Auffangtatbestand | 250 | ||
| bb) Vorbehalt der „verfassungsmäßigen Ordnung" | 250 | ||
| cc) Besondere Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit | 252 | ||
| c) Ergebnis | 255 | ||
| 3. Systematische Argumente | 256 | ||
| a) Vergleich Deliktsrecht mit Vertragsrecht | 256 | ||
| b) Deliktsrecht und Freiheitsschutz | 259 | ||
| aa) Einordnung | 259 | ||
| bb) Absage an die „große Generalklausel" | 260 | ||
| cc) Verschuldensprinzip als deliktsrechtliches Strukturelement | 263 | ||
| dd) Weitere Strukturelemente des Deliktsrechts | 265 | ||
| 4. „Wandlungen" des Deliktsrechts und Freiheitsschutz | 266 | ||
| 5. Allgemein „vernünftige" Argumente | 273 | ||
| a) Vorbemerkung | 273 | ||
| b) Erhaltung von Freiräumen als Mittel zu bestimmten Zwecken | 274 | ||
| c) „Effiizienzkriterium" und Freiheitsschutz | 275 | ||
| IIΙ. Zusammenfassung von Β | 280 | ||
| 5. Abschnitt: Anwendungsbeispiele und Abgrenzungen | 282 | ||
| A. Der Zweck Freiheitsschutz in der konkreten Rechtsanwendung | 282 | ||
| I. Orte der Anwendung | 282 | ||
| II. Zweck Freiheitsschutz im Verhältnis zu anderen Zwecken | 283 | ||
| IIΙ. Beispiele der Argumentation mit einem Zweck Freiheitsschutz | 287 | ||
| 1. Internationales Deliktsrecht | 287 | ||
| 2. Freiheitsschutz im Bereich Fahrlässigkeitsprüfung | 287 | ||
| 3. Freiheitsschutz und Beweislastumkehr | 288 | ||
| 4. Zweck Freiheitsschutz im Rahmen von § 847 BGB | 289 | ||
| 5. „Appellcharakter" | 290 | ||
| B. Abgrenzungen | 291 | ||
| I. Vorbemerkung | 291 | ||
| II. Abgrenzungen | 291 | ||
| 1. Zweck Freiheitsschutz als Möglichkeit der Haftungsbegrenzung | 291 | ||
| 2. „Zweck" Freiheitsschutz und Freiheitsschutz als „Interesse" | 292 | ||
| 6. Abschnitt: Zusammenfassung und Schlußbemerkung | 297 | ||
| A. Ziele dieser Arbeit und Vorgehensweise | 297 | ||
| I. Teleologische Argumentation | 297 | ||
| II. Freiheitsschutz als Zweck des Deliktsrechts | 298 | ||
| III. Einordnung und Abgrenzung dieses Zwecks | 300 | ||
| B. Zusammenfassung der Ergebnisse im einzelnen | 300 | ||
| C. Argumente gegen Kritik an objektiv-teleologischer Argumentation | 302 | ||
| D. Schlußbemerkung | 304 | ||
| Rechtsprechung | 305 | ||
| Literaturverzeichnis | 306 | ||
| Sachregister | 313 |
