Zurechnung und »Vorverschulden«
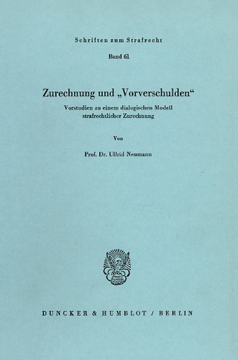
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Zurechnung und »Vorverschulden«
Vorstudien zu einem dialogischen Modell strafrechtlicher Zurechnung
Schriften zum Strafrecht, Vol. 61
(1985)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| A. Einleitung | 13 | ||
| B. Zurechnungsstrukturen in Fällen strafbarkeitsrelevanten Vorverschuldens | 24 | ||
| I. Das Tatbestandsmodell | 24 | ||
| 1. Das Tatbestandsmodell als Deutungsmuster in der Rechtsdogmatik: Die actio libera in causa | 24 | ||
| a) Das Problem | 24 | ||
| b) Der Standpunkt der h. M.; dogmatische Inkonsequenzen | 25 | ||
| c) Abweichende Deutungen | 41 | ||
| aa) Das Ausnahmemodell | 41 | ||
| bb) Das Pflichtmodell | 45 | ||
| 2. Das Tatbestandsmodell im Gesetz: Der Vollrauschtatbestand (§ 323 a StGB) | 50 | ||
| a) Die Problematik der herrschenden Meinung zur Struktur des § 323 a StGB | 50 | ||
| aa) Das Unrecht des Vollrauschdelikts | 51 | ||
| 1) Die angebliche Unrechtsindifferenz der Rauschtat | 51 | ||
| 2) Das Sichberauschen als tatbestandsmäßiges Unrecht | 56 | ||
| 3) Die Gleichbewertung des vorsätzlichen und des fahrlässigen Sichbetrinkens | 72 | ||
| bb) Dogmatische Inkonsequenzen der herrschenden Meinung | 74 | ||
| 1) Die Kausalität des Rausches für die Rauschtat | 75 | ||
| 2) Die Bedeutung der rauschbedingten Handlungsunfähigkeit | 78 | ||
| 3) Der subjektive Tatbestand bei § 323 a StGB | 79 | ||
| 4) Probleme der Teilnahmedogmatik beim Vollrauschtatbestand (§ 323 a StGB) | 83 | ||
| 5) Rücktritt | 91 | ||
| 6) Strafprozessuale Probleme des § 323 a StGB | 93 | ||
| α) Der Urteilstenor | 93 | ||
| β) Die Privatklage | 94 | ||
| γ) Die Nebenklage | 95 | ||
| δ) Berauschung und Rauschtat als dieselbe Tat i. S. des § 264 StPO | 96 | ||
| ε) Die Rauschtat als Haftgrund nach § 112 a StPO | 99 | ||
| cc) Kriminalpolitische Probleme und die Versuche ihrer Bewältigung | 100 | ||
| 1) Die Trennung des Rauschbegriffs von dem Gesichtspunkt der Schuldfähigkeit | 101 | ||
| 2) Das Problem einer Wahlfeststellung zwischen § 323 a StGB und dem Rauschdelikt | 109 | ||
| 3) Der Rückgriff auf das in dubio-Prinzip | 115 | ||
| b) Die Idee der Risikohaftung | 118 | ||
| aa) Die Theorie Schweikerts | 119 | ||
| bb) Die Theorie Hardwigs | 122 | ||
| cc) Das Risiko eines rückwirkenden Verbots des Sich-Berauschens (Jakobs) | 124 | ||
| c) § 323 a StGB als Ausnahmeregelung zu § 20 StGB | 125 | ||
| 3. Dogmatische Grenzen des Tatbestandsmodells: Die Behandlung der selbstverschuldeten Trunkenheit bei der Strafzumessung | 128 | ||
| a) Die Bedeutung der Strafzumessungsdogmatik für die Frage der Zurechnungsstruktur; mögliche Bedenken | 128 | ||
| aa) Die Eigenständigkeit der Strafzumessungsschuld | 129 | ||
| bb) Der fakultative Charakter der Strafrahmenmilderung nach § 21 StGB | 131 | ||
| b) Die Behandlung der selbstverschuldeten Trunkenheit bei der Strafzumessung in Rechtsprechung und Lehre | 131 | ||
| c) Mögliche Zurechnungsstrukturen | 134 | ||
| aa) Das Kompensationsmodell | 134 | ||
| bb) Das Ausnahmemodell | 140 | ||
| II. Alternative von Tatbestandsmodell und Ausnahmemodell: Die vorsätzliche Notwehrprovokation | 142 | ||
| 1. Die Problemstruktur | 142 | ||
| 2. Verschiedene Lösungsversuche | 143 | ||
| a) Fehlen des Verteidigungswillens | 143 | ||
| b) Einwilligung des Provokateurs | 143 | ||
| c) Die fehlende „Gebotenheit“ der Verteidigung | 144 | ||
| d) Die Idee der Garantenstellung | 144 | ||
| e) Die Verneinung eines Angriffs des Provozierten | 148 | ||
| 3. Die actio illicita in causa | 148 | ||
| a) Der Grundgedanke der actio illicita in causa | 148 | ||
| b) Bedenken gegen die Lösung über die actio illicita in causa | 149 | ||
| aa) Die Schwierigkeiten einer kausalen Deutung der Verletzungshandlung | 149 | ||
| bb) Die Überlastung des Tatbestands | 150 | ||
| cc) Das Problem der Rechtswidrigkeit der Provokation | 151 | ||
| dd) Notwehr gegen die Provokation? | 152 | ||
| 4. Der Rückgriff auf das Rechtsmißbrauchsprinzip | 154 | ||
| a) Der Grundgedanke der Anwendung des Rechtsmißbrauchsprinzips auf die Provokationsfälle | 154 | ||
| b) Bedenken gegen die Heranziehung des Rechtsmißbrauchsprinzips | 154 | ||
| aa) Das Verdikt der „Leerformel“ | 156 | ||
| bb) Die Voraussetzungen des Rechtsmißbrauchsprinzips | 156 | ||
| cc) Grundsätzliche Vorbehalte gegen die Anwendung des Rechtsmißbrauchsprinzips auf die strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe | 159 | ||
| 5. Die Befugnis zur Verteidigung der Rechtsordnung | 161 | ||
| a) „Schutzprinzip“ und „Rechtsbewährungsprinzip“ als Grundprinzipien des Notwehrrechts | 161 | ||
| b) Kritik | 162 | ||
| aa) Das Problem der Verteidigung der Rechtsordnung als solcher | 162 | ||
| bb) Die Mehrdeutigkeit des Begriffs der Rechtsbewährung | 168 | ||
| 6. Lösungsvorschlag | 176 | ||
| a) Die grundsätzlichen Möglichkeiten | 176 | ||
| b) Die Anerkennung dogmatischer Regeln zweiter Stufe | 177 | ||
| aa) Die Struktur dieser Regeln | 177 | ||
| bb) Die latente Anerkennung von Metaregeln in der bisherigen Diskussion | 179 | ||
| cc) Die Notwendigkeit der Anerkennung von Argumentationsregeln | 182 | ||
| III. Tatbestandsmodell oder Pflichtmodell? Die Zurechnungsstruktur in den Fällen des Übernahmeverschuldens | 186 | ||
| 1. Die Lösung auf der Ebene der Schuld | 187 | ||
| 2. Die Lösung auf der Ebene des Unrechts: Die Tatbestandsmäßigkeit der „Übernahmehandlung“ | 190 | ||
| 3. Das Vorverhalten als Verletzung einer selbständigen Pflicht | 197 | ||
| a) Die Pflicht zum Unterlassen der Tätigkeitsübernahme | 198 | ||
| b) Die Informations- und Prüfungspflichten | 200 | ||
| 4. Das Übernahmeverschulden als materieller Grund für die Nichtberücksichtigung der mangelnden subjektiven Fähigkeiten | 203 | ||
| IV. Das Kompensationsmodell: Die vom Täter verursachte Gefahr im entschuldigenden Notstand (§ 35 Abs. 1 Satz 2 StGB) | 207 | ||
| 1. Die formale Struktur der Zurechnung | 207 | ||
| 2. Die materiale Struktur der Zurechnung | 208 | ||
| a) Die Idee der Kompensation der Unrechtsminderung | 209 | ||
| aa) Das Problem der Unrechtsminderung bei § 35 StGB | 209 | ||
| bb) Der Wegfall einer relevanten Unrechtsminderung in den Fällen einer besonderen Gefahrtragungspflicht des Notstandstäters | 218 | ||
| b) Der Rückgriff auf die actio libera in causa | 224 | ||
| c) Die kriminalpolitische Deutung | 226 | ||
| d) Lösungsvorschlag: Die Interpretation im Rahmen des „Stufenmodells“ | 231 | ||
| V. Verschiedene Zurechnungsmodelle: Der verschuldete Affekt | 240 | ||
| 1. Die Schuldrelevanz des „normalpsychologischen“ Affekts | 240 | ||
| 2. Begründungen für die Irrelevanz des verschuldeten Affekts | 241 | ||
| a) Der Rückgriff auf die Regelung des Verbotsirrtums | 241 | ||
| b) Die Parallele zum entschuldigenden Notstand (§ 35 StGB) | 246 | ||
| c) Die Lösung über die actio libera in causa | 246 | ||
| d) Der auf die Affektgenese gegründete Vorwurf als „mittelbarer“ Tatschuldvorwurf (Rudolphi) | 248 | ||
| e) Die Bedeutung des § 213 StGB für das Problem des „verschuldeten“ Affekts | 250 | ||
| aa) Die Parallele zu § 213 StGB | 250 | ||
| bb) Die kriminalpolitische Deutung des § 213 StGB | 255 | ||
| VI. Abgrenzung zum Zurechnungsmodell Hruschkas | 260 | ||
| C. Lösungsvorschlag: Die Regeln eines fairen Verantwortungsdialogs als dogmatische Regeln zweiter Stufe | 269 | ||
| I. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung von gesellschaftlichen Zurechnungsregeln | 269 | ||
| 1. Generalprävention und gerechte Zurechnung | 269 | ||
| a) Die Notwendigkeit einer normativen Kontrolle präventiver Zurechnungskriterien | 269 | ||
| b) Die generalpräventive Bedeutung der Regeln gerechter Zurechnung | 272 | ||
| 2. Soziale Zurechnungsregeln und „gerechte“ strafrechtliche Zurechnung | 274 | ||
| a) Die sozialen (alltagsmoralischen) Zurechnungsregeln als Maßstab gerechter strafrechtlicher Zurechnung | 274 | ||
| b) Der Begriff der sozialen (alltagsmoralischen) Zurechnungsregeln | 275 | ||
| II. Die Möglichkeit einer Berücksichtigung von gesellschaftlichen Regeln des Sich-Verantwortens: Der strafrechtliche Verantwortungsdialog | 276 | ||
| 1. Die dialogische Struktur des strafrechtlichen Verantwortlichmachens | 276 | ||
| 2. Das Verhältnis gesellschaftlicher und rechtlicher Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe | 284 | ||
| 3. Abgrenzung zu Hafts Theorie des Schulddialogs | 291 | ||
| III. Ausblick | 294 | ||
| Literaturverzeichnis | 296 |
