Europäischer Finanzausgleich
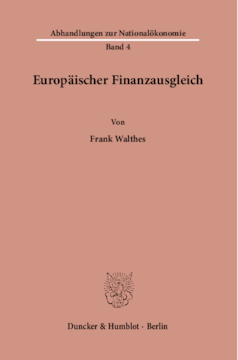
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Europäischer Finanzausgleich
Abhandlungen zur Nationalökonomie, Vol. 4
(1996)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsveneichnis | 9 | ||
| Tabellenverzeichnis | 19 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 21 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 23 | ||
| Verzeichnis der formalen Parameter | 26 | ||
| Vorbemerkungen | 31 | ||
| A. Impressionen und Visionen der europäischen Integration | 31 | ||
| B. Europäischer Finanzausgleich im wissenschaftlichen Schrifttum | 32 | ||
| C. Untersuchungsgegenstand und Methodik der Analyse | 34 | ||
| I. Gegenstand der Untersuchung | 34 | ||
| II. Methodisches Vorgehen | 35 | ||
| 1. Teil: Zur Notwendigkeit eines Europäischen Finanzausgleichs – Problemaufriß und Lösungsweg | 39 | ||
| 1. Kapitel: Regionale Disparitäten in der Europäischen Union | 40 | ||
| A. Auswahl relevanter Vergleichsindikatoren | 40 | ||
| B. Sozioökonomisches Disparitätenmuster im Überblick | 43 | ||
| I. Disparitäten zwischen Mitgliedstaaten | 43 | ||
| II. Disparitäten zwischen Regionen | 47 | ||
| III. Anmerkungen zum Disparitätenmuster | 49 | ||
| C. Wirtschafts- und Wachstumszentren Europas | 50 | ||
| 2. Kapitel: Rechtliche Grundlagen und europäisches Zielsystem | 52 | ||
| A. Paraphierung und Ratifizierung der Maastrichter Beschlüsse | 52 | ||
| I. Maastricht – ein europäischer Kompromiß | 53 | ||
| II. Ratifizierung der Verträge von Maastricht | 55 | ||
| III. Konsequenzen der Karlsruher Urteilsbegründung | 56 | ||
| B. Zielformulierungen der europäischen Union | 57 | ||
| I. Ziele der Präambeln | 59 | ||
| II. Zielvorgaben des Unionsvertrages | 60 | ||
| III. Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche des EG-Vertrages | 61 | ||
| C. Ökonomische Essenz der Zielvorgaben | 63 | ||
| I. Einordnung der Zielformulierungen | 64 | ||
| II. Leitbild “soziale Marktwirtschaft” als ordnungspolitische Zielfunktion der Europäischen Union | 65 | ||
| 3. Kapitel: Kohäsion, Konvergenz und Finanzausgleich | 68 | ||
| A. Europäische Kohäsion | 68 | ||
| I. Zur Bedeutung des Terminus “Kohäsion” | 69 | ||
| II. Postulat der Kohäsion nach Maastricht | 70 | ||
| III. Strukturpolitische Maßnahmen | 72 | ||
| 1. Strukturfonds | 72 | ||
| 2. Kohäsionsfonds | 75 | ||
| 3. Kritische Anmerkungen zur Fondswirtschaft | 76 | ||
| B. Konvergenz als Voraussetzung weiterer Entwicklungsschritte | 79 | ||
| I. Zum Begriff “Konvergenz” | 79 | ||
| II. Implikationen der Europäischen Währungsunion | 80 | ||
| 1. Konvergenzkriterien – Anspruch und Wirklichkeit | 81 | ||
| 2. Ökonomische Folgen für die Mitgliedstaaten | 84 | ||
| C. Theoretische Begründung kohäsionspolitischer Maßnahmen | 87 | ||
| I. Gesichtspunkt der Kompensation | 87 | ||
| II. Wunsch nach Umverteilung | 88 | ||
| III. Aspekt der Entwicklung | 89 | ||
| D. Europäischer Finanzausgleich als Lösungsweg | 90 | ||
| I. Argumente für einen Europäischen Finanzausgleich | 91 | ||
| 1. Kritik am bisherigen Fondssystem | 91 | ||
| 2. Integrationsstufe Europäische Währungsunion | 92 | ||
| 3. Verfassungsauftrag des Europäischen Parlaments | 93 | ||
| 4. Subsidiarität und Föderalismus in Europa | 94 | ||
| 5. Theoretische Gesichtspunkte | 95 | ||
| II. Gegenposition zur Notwendigkeit eines Europäischen Finanzausgleichs | 96 | ||
| III. Fazit: Europäischer Finanzausgleich als Untersuchungsgegenstand | 97 | ||
| 2. Teil: Theorie und Deduktion des Europäischen Finanzausgleichs | 99 | ||
| 4. Kapitel: Elemente eines finanzföderalistischen Referenzsystems | 100 | ||
| A. Ökonomische Theorie des Föderalismus als Ausgangspunkt | 100 | ||
| I. Föderalismus als Struktur- und Organisationsprinzip | 101 | ||
| 1. Synopse alternativer Föderalismuskonzepte | 102 | ||
| 2. Finanzföderalismus aus theoretischer und pragmatischer Sicht | 104 | ||
| II. Multiple Theorie des öffentlichen Sektors im weiteren Sinne | 105 | ||
| 1. Verfassungs- und Bereitstellungsfunktion im dualen System | 105 | ||
| 2. Ressourcen- und Präferenzkosten bei Mehrheitsentscheidung | 107 | ||
| 3. Erweiterung der Musgraveschen Begriffstrias | 109 | ||
| III. Wettbewerb als gemeinsames Organisationsprinzip | 112 | ||
| B. Das föderative Verbundprinzip als Referenzmaßstab | 114 | ||
| I. Prinzip des ökonomischen und politischen Verbundes nach Recktenwald | 114 | ||
| II. Das föderalistische Bezugssystem nach Biehl | 117 | ||
| III. Das erweiterte Verbundprinzip in seiner föderalen Ausprägung | 119 | ||
| C. Ökonomische Theorie des Finanzausgleichs als Argumentationsrahmen | 120 | ||
| I. Inhalt und Terminologie des Finanzausgleichs | 120 | ||
| II. Analyseebenen des Finanzausgleichs | 123 | ||
| 1. Nationaler und internationaler Finanzausgleich | 123 | ||
| 2. Europäischer Finanzausgleich | 125 | ||
| 5. Kapitel: Aufgaben- und Ausgabenzuteilung im passiven Finanzausgleich | 130 | ||
| A. Allokationsfunktion des primären passiven Finanzausgleichs | 130 | ||
| I. Festlegung öffentlicher Aufgaben | 131 | ||
| 1. Marktversagen als Begründung für Staatshandeln | 131 | ||
| a) Technische Unteilbarkeit als Ausgangspunkt | 133 | ||
| b) Internalisierung externer Effekte | 134 | ||
| c) Graduelle Entwicklung eines Kollektivgutschemas | 135 | ||
| 2. Umfang und Grenzen öffentlicher Güter | 137 | ||
| 3. ‘Second-best’ – Theorem staatlichen Handelns | 138 | ||
| 4. Erklärungsbeitrag der Theorie des optimalen Budgets | 139 | ||
| II. Öffentliche Aufgabenträger in einer Multiföderation | 141 | ||
| 1. Optimale Zahl von Aufgabenträgern | 142 | ||
| a) Berücksichtigung individueller Präferenzen | 142 | ||
| b) Zentralisierungsgrad und Anzahl der Körperschaften | 145 | ||
| 2. Gruppierung von öffentlichen Aufgaben | 147 | ||
| a) Zum Problem der optimalen Kollektivgröße | 148 | ||
| b) Heterogenität und Mobilität | 149 | ||
| III. Kompetenzausstattung und Kompetenzdifferenzierung | 150 | ||
| 1. Zuteilung der Entscheidungskompetenz | 152 | ||
| 2. Zuordnung der Durchführungskompetenz | 153 | ||
| 3. Verteilung der Finanzierungskompetenz | 154 | ||
| 4. Horizontale und vertikale Kooperation im Föderalismus | 155 | ||
| IV. Subsidiarität – Handlungsmaxime für die Aufgabenverteilung | 157 | ||
| 1. Gesellschaftliches Handlungs- und Ordnungsprinzip | 157 | ||
| 2. Das Subsidiaritätsprinzip aus ökonomischer Sicht | 159 | ||
| B. Ergänzende Funktion des sekundären passiven Finanzausgleichs | 160 | ||
| I. Zuordnung distributionspolitischer Kompetenzen | 160 | ||
| II. Zuordnung der Stabilisierungsfunktion | 162 | ||
| III. Schlußfoglerungen für distributive und stabilisierende Aufgaben | 163 | ||
| C. Resümee zur Theorie des passiven Finanzausgleichs | 164 | ||
| D. Der passive Finanzausgleich in der Europäischen Union | 165 | ||
| I. Aufgabenbereiche und Ausgabenseite des EU-Budgets | 166 | ||
| 1. “Finanzielle Vorausschau” der Aufgabenbereiche | 166 | ||
| 2. Finanzmittel zur Förderung der Kohäsion | 168 | ||
| 3. Exkurs “Norderweiterung” | 170 | ||
| 4. Asymmetrie der Ausgaben | 172 | ||
| 5. Relative Bedeutung des Ausgabenvolumens | 173 | ||
| II. Beurteilung der Aufgabenverteilung | 174 | ||
| 1. Fehlende Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzips | 175 | ||
| 2. Europäische Kompetenz und Zentralität | 176 | ||
| 3. Europäische Union als optimaler Integrationsraum | 178 | ||
| III. Ausgabenvolumen in Abhängigkeit vom Integrationsstand | 178 | ||
| 6. Kapitel: Primärer aktiver Finanzausgleich: (Europäischer) Finanzausgleich im engeren Sinn | 181 | ||
| A. Einnahmenzuteilung im primären aktiven Finanzausgleich | 181 | ||
| I. Bestimmung öffentlicher Einnahmenarten | 181 | ||
| II. Zuteilung der Einnahmen auf öffentliche Aufgabenträger | 183 | ||
| 1. Entscheidungskompetenz | 184 | ||
| 2. Durchführungskompetenz | 185 | ||
| 3. Ertragskompetenz | 186 | ||
| III. Einnahmenautonomie bei alternativen Verteilungssystemen | 186 | ||
| 1. Unkoordiniertes oder Konkurrenzsystem | 188 | ||
| 2. Koordinierte Systeme | 188 | ||
| B. Resümee zum aktiven Finanzausgleich | 190 | ||
| C. Bewertung des aktiven Finanzausgleichs der Europäischen Union | 191 | ||
| I. Das aktuelle EU-Einnahmensystem | 191 | ||
| 1. Retrospektive der Eigenmittelbeschlüsse | 191 | ||
| 2. Die Eigenmittel der Europäischen Union | 194 | ||
| a) Traditionelle Eigenmittel | 195 | ||
| b) MwSt-Eigenmittel | 197 | ||
| c) BSP-Eigenmittel | 199 | ||
| d) Strukturelle Entwicklung der EU-Eigenmittel | 201 | ||
| 3. Plafondierung als disziplinierendes Instrument | 202 | ||
| 4. Korrekturmechanismen zum Ausgleich von Haushaltsungleichgewichten | 203 | ||
| a) Hintergrund der Implementierung | 204 | ||
| b) Korrekturmechanismen für Großbritannien | 205 | ||
| II. Kritische Würdigung des EU-Einnahmensystems | 206 | ||
| 7. Kapitel: Sekundärer aktiver Finanzausgleich: (Europäischer) Finanzausgleich im engsten Sinn | 212 | ||
| A. Finanzzuweisungen im sekundären aktiven Finanzausgleich | 213 | ||
| I. Ökonomische Begriffsbestimmung | 213 | ||
| II. Arten von Finanzzuweisungen | 213 | ||
| III. Vertikale und horizontale Ausgestaltung | 215 | ||
| B. Modelltheoretische Implikationen ausgewählter Zuweisungsarten | 216 | ||
| I. Wirkungen allgemeiner Pauschalzuweisungen | 217 | ||
| II. Wirkungsanalyse einer zweckgebundenen Zuweisung | 219 | ||
| III. Reaktionen auf eine Mitfinanzierungspflicht | 222 | ||
| IV. Bewertung der Implikationen von Finanzzuweisungen | 225 | ||
| 1. Unzureichende Indifferenzkurvenanalyse | 225 | ||
| 2. Sickerverluste und flypaper-Effekt | 226 | ||
| 3. Komplexität und Praktikabilität | 227 | ||
| 4. Handlungsspielräume und Freiheitsgrade | 228 | ||
| C. Ökonomische Ziele von Finanzzuweisungen | 229 | ||
| I. Allokativer Korrekturbedarf | 229 | ||
| II. Distributiver Korrekturbedarf | 230 | ||
| III. Stabilisierung und Verstetigung der öffentlichen Einnahmen | 231 | ||
| D. ‘Fiscal equity’ als distributives Ziel einer föderativen Finanzwirtschaft | 233 | ||
| I. Fiskalische Gleichheit zwischen Körperschaften | 234 | ||
| 1. Musgraves Konzepte im Überblick | 235 | ||
| a) Gleichheit der tatsächlichen Ausgaben | 236 | ||
| b) Gleiche Versorgung mit öffentlichen Leistungen | 237 | ||
| c) Gleiche Unterschiede zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft | 237 | ||
| d) Ausgleich der Finanzkraft | 239 | ||
| e) Gleiche Versorgung pro Einheit eigener Steuereinnahmen | 240 | ||
| f) Gleiche Versorgung pro Einheit eigener Anstrengung | 241 | ||
| 2. Ausgleichskonzepte des MacDougall-Berichtes | 242 | ||
| a) Allgemeines Modell zum Finanzkraftausgleich | 242 | ||
| b) Finanzkraftausgleich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Steuerbelastung | 243 | ||
| c) Finanzkraftausgleich nach dem Repartitionsprinzip | 244 | ||
| d) Verteilung eines fixen Betrages nach Maßgabe der Finanzkraft und der Finanzleistung | 244 | ||
| 3. Fiskalische Gleichheit im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse | 246 | ||
| II. Deckungsrelation von Finanzkraft und Finanzbedarf | 248 | ||
| 1. Ermittlung der Finanzkraft | 249 | ||
| 2. Bestimmung des Finanzbedarfs | 251 | ||
| III. Festlegung des Ausgleichs- bzw. Nivellierungsgrades | 254 | ||
| E. Resümee zum Finanzausgleich im engsten Sinn | 256 | ||
| F. Würdigung des sekundären aktiven Finanzausgleichs der Europäischen Union | 257 | ||
| I. Zuweisungen als Teilmenge europäischer Finanzströme | 257 | ||
| 1. Analytische Differenzierung | 257 | ||
| 2. Versuch einer Quantifizierung | 260 | ||
| 3. Schlußfolgerungen aus der Differenzierung | 261 | ||
| II. Beurteilung des Europäischen Finanzausgleichs im engsten Sinn | 262 | ||
| 8. Kapitel: Politisch-institutionelle Dimension des Europäischen Finanzausgleichs | 266 | ||
| A. Akteure des europäischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses | 267 | ||
| I. Methodik der Neuen Politischen Ökonomie | 267 | ||
| II. Interdependenzmodell der beteiligten Akteure | 269 | ||
| III. Politökonomische Akteure der Europäischen Union | 272 | ||
| 1. Formales Beziehungsgeflecht der europäischen Organe | 273 | ||
| 2. Erweitertes Beziehungsgeflecht mit Nebenorganen und Interessengruppen | 281 | ||
| 3. Totales Beziehungsgeflecht zwischen den europäischen Akteuren | 284 | ||
| B. Tendenzielle Zentralisierung in der Europäischen Union | 286 | ||
| I. Das Delors-II-Paket aus politökonomischer Sicht | 287 | ||
| II. Demokratiedefizit und Zentralisierung | 290 | ||
| III. Epigrammatische Zusammenfassung | 292 | ||
| C. Verteilung der Finanzierungslasten zwischen den Mitgliedstaaten | 293 | ||
| I. Prinzipien einer “gerechten” Lastenverteilung | 293 | ||
| II. Einwände gegen das Konzept der Nettopositionen | 295 | ||
| III. Sensitivitätsanalysen zur Lastenverteilung | 301 | ||
| 1. Formale Inzidenzanalyse der strukturpolitischen Maßnahmen | 301 | ||
| 2. Lastverschiebungen bei den Eigenmitteln | 302 | ||
| IV. Abschließende Anmerkungen zur Lastenverteilung | 303 | ||
| D. Der Europäische Finanzausgleich als ‘Circulus vitiosus’ | 304 | ||
| 9. Kapitel: Modellanalyse: Determinanten und Dimensionen eines subsidiären Europäischen Finanzausgleichs | 306 | ||
| A. Konsequenzen aus der theoretischen Grundlegung | 306 | ||
| I. Kernprobleme der (prä)föderativen Ausgestaltung | 306 | ||
| II. Restriktionen des Europäischen Finanzausgleichs | 309 | ||
| III. Fiktiver Referenzpunkt der Modellanalyse | 310 | ||
| B. Europäischer Finanzausgleich zwischen EU-Mitgliedstaaten | 313 | ||
| I. Der Europäische Finanzausgleich aus horizontaler und vertikaler Sicht | 313 | ||
| II. Zur Zielfunktion des Europäischen Finanzausgleichs | 314 | ||
| III. Aspekte der Ausgestaltung | 316 | ||
| 1. Finanzkraft, Finanzbedarf und Ausgleichsintensität | 316 | ||
| 2. Horizontale Komponente des Finanzausgleichssystems | 319 | ||
| 3. Vertikale Komponente des Finanzausgleichssystems | 320 | ||
| IV. Modellanalyse des europäischen Finanzausgleichsverfahrens | 321 | ||
| 1. Konstitutive Kriterien für das Ausgleichsverfahren | 322 | ||
| 2. Funktionaler Zusammenhang der Ausgangssituation | 324 | ||
| 3. Das kombinierte Finanzausgleichsverfahren | 325 | ||
| 4. Modellergebnis und finanzpolitische Gestaltungsfreiheit | 326 | ||
| V. Kritische Anmerkungen zum modellierten Finanzausgleichsverfahren | 326 | ||
| C. Ein europäisches Rechenexempel | 328 | ||
| I. Ermittlung der Ausgangsdaten | 328 | ||
| II. Vier-Varianten-Rechnung zum Europäischen Finanzausgleich | 330 | ||
| 1. Variante A: Status quo der ‘Juste Retour’ | 332 | ||
| 2. Variante B: Vertikaler Finanzausgleich mit Plafondierung | 332 | ||
| 3. Variante C: Teilausgleich mit horizontalen und vertikalen Komponenten | 333 | ||
| 4. Variante D: Ausgleichsintensität von 90 Prozent | 334 | ||
| III. Anmerkungen zu Variantenvariationen | 334 | ||
| D. Fazit der Modellanalyse | 335 | ||
| 3. Teil: Reformen und Visionen im (prä)föderalen Finanzausgleich der Europäischen Union | 337 | ||
| 10. Kapitel: Reformansätze im passiven und aktiven EU-Finanzausgleich | 338 | ||
| A. Finanzverfassung als Nukleus einer europäischen Gesamtverfassung | 339 | ||
| B. Passiver Finanzausgleich: Reformansätze in der Aufgaben- und Ausgabenstruktur | 340 | ||
| C. Aktiver Finanzausgleich: Alternative EU-Finanzierungsformen | 342 | ||
| I. Das heutige Eigenmittelsystem als Ausgangspunkt | 342 | ||
| II. Umgestaltung des Eigenmittelsystems | 344 | ||
| 1. Anforderungsprofil einer Unionssteuer | 344 | ||
| 2. Synopse alternativer EU-Steuern | 346 | ||
| 3. Reformvorschlag: Regressives und progressives Eigenmittelmix | 354 | ||
| 11. Kapitel: Europäische Visionen: Vertiefung, Erweiterung und Konstitution | 356 | ||
| A. Vertiefung: Chancen einer variablen Geometrie | 356 | ||
| I. Ein Kern integrationsorientierter EU-Mitgliedstaaten | 357 | ||
| II. Kreis oder Matrix der Integration | 358 | ||
| B. Erweiterung: Optionen und Voraussetzungen | 359 | ||
| I. Erweiterung um die Visegrad-Staaten | 360 | ||
| II. Wirtschaftliche Konvergenz als Voraussetzung | 362 | ||
| C. Flexibilität bei Vertiefung und Erweiterung | 364 | ||
| D. Konstitutionelle und institutionelle Aspekte einer europäischen Verfassung | 365 | ||
| I. Konstitutioneller Rahmen der Europäischen Union | 367 | ||
| II. Institutioneller Rahmen der Europäischen Union | 370 | ||
| III. Prinzipien eines föderalen Verfassungsrahmens | 371 | ||
| Resümee: Ein konstruktives Fazit | 375 | ||
| Tabellenanhang | 379 | ||
| Literaturverzeichnis | 400 |
