Verfassungsfunktionen - Vertragsfunktionen
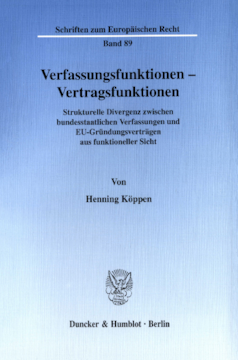
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Verfassungsfunktionen - Vertragsfunktionen
Strukturelle Divergenz zwischen bundesstaatlichen Verfassungen und EU-Gründungsverträgen aus funktioneller Sicht - Ein kritischer, am Beispiel der Neuen Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft rechtsvergleichender Beitrag zur Diskussion um
Schriften zum Europäischen Recht, Vol. 89
(2002)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Anlaß der vorliegenden, von Prof. Dr. François Rigaux (Université Catholique de Louvain, Belgien) betreuten Arbeit war für den Verfasser u. a. die Erkenntnis, daß angesichts des steten Wachstums staatlich-föderativer Parallelerscheinungen im Unionsrecht eine »Vision Europastaat« keineswegs aufgegeben scheint. Exemplarisch sind seiner Darstellung zufolge auch die neuerlichen, weil über eine bloße »Verfassungsförmigkeit« hinausreichenden Bestrebungen nach einer »Europäischen Verfassung« von der überlieferten Konnexität zwischen Verfassung und modernem Staat letztlich nicht zu lösen.Forderungen nach einer »Staatswerdung Europas« hält Henning Köppen die unverändert völkervertragliche, in Zukunft gar immer »zweckverbandlichere« Natur der EU entgegen. Er weist z. T. unüberwindbare strukturelle Divergenzen zwischen bundesstaatlichen Verfassungen und europäischem Primärrecht nach, indem er aus einer umfassenden funktionellen Perspektive deren organisatorische, stabilisatorische und evolutive, legitimatorische, integrative sowie individualrechtsschützende und grundordnende Prämissen und Mechanismen einander gegenüberstellt.In deutlicher Abgrenzung zum gewählten Vergleichsobjekt, der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit ihrer Neuen Bundesverfassung, arbeitet Henning Köppen dabei auch eine mangelhafte, sich nach der EU-Osterweiterung gar rückentwickelnde, außerrechtliche Homogenität unter »den Europäern« als mitentscheidende Ursache für die spürbar abnehmende Fähigkeit der Union heraus, ihr erfolgreiches Binnenmarkt- und Friedenskonzept in Richtung föderativ-vertiefende Formen fortzuentwickeln.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inahltsübersicht | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 15 | ||
| Einleitung: Staatsbezogenheit europäischer Verfassungsbestrebungen | 19 | ||
| I. Ziel, Methode und Gang der Arbeit | 25 | ||
| II. Vergleichsobjekt Eidgenossenschaft | 27 | ||
| A. Organisationsfunktion | 30 | ||
| I. Die bundesstaatliche Verfassung – Arbeitsteilung im „unitarischen Bundesstaat“ | 30 | ||
| 1. Strukturmerkmale des Bundesstaates – Formgebung durch die Gesamtstaatsverfassung | 31 | ||
| 2. Doppelte Staatlichkeit nach Maßgabe der BV | 32 | ||
| 3. Rechtsinhaltliche Zentralmacht des Bundes im Rahmen vertikaler Machtverteilung („Hierarchie“) | 36 | ||
| a) Föderative Institutionenstruktur – Einbußen kantonalen Einflusses | 36 | ||
| b) Gesetzgebung, Vollzug und Bundestreue | 38 | ||
| c) Rechtsprechung | 40 | ||
| d) Auswärtige Gewalt | 41 | ||
| e) Finanzverfassung | 44 | ||
| f) Fortschreitende Unitarisierung | 45 | ||
| II. Die EU-Gründungsverträge – Aufgabenteilung im supranationalen „Staatenverbund“ | 46 | ||
| 1. Strukturmerkmale europäischer Supranationalität – die EU als funktionalistische Kreation ihrer Mitglieder | 47 | ||
| 2. Die EU als rechtsformal völkerrechtliche Verbindung souveräner Nationalstaaten | 51 | ||
| 3. Rechtsinhaltliche Zentralmacht der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen vertikaler Machtverteilung („Kooperation“) | 55 | ||
| a) Supranationale Institutionenstruktur – Wahrung mitgliedstaatlicher „Herrschaft“ | 62 | ||
| b) Normsetzung, Vollzug und Gemeinschaftstreue | 64 | ||
| c) Rechtsprechung | 66 | ||
| d) Auswärtige Gewalt | 68 | ||
| e) Finanzordnung | 68 | ||
| f) Fehlende Anzeichen einer „europäischen Verstaatlichung“ | 70 | ||
| III. Zusammenfassung | 71 | ||
| B. Stabilisierungs- und Evolutionsfunktion | 73 | ||
| I. Die bundesstaatliche Verfassung – „Feste Verfassung“ | 73 | ||
| 1. Wesensmäßige Statik – Evolution nur innerhalb des pouvoir constitué | 74 | ||
| a) Statische Normentypen | 74 | ||
| b) Verfassungsimmanent begrenzte Evolutionspotentiale – Sozialstaatsprinzip | 79 | ||
| 2. Formelle Unverbrüchlichkeit durch Recht und Zwang | 86 | ||
| a) Schriftform | 86 | ||
| b) Normenhierarchie nach Maßgabe der Bundesverfassung | 87 | ||
| c) Erschwerte Verfassungsrevision zum Schutze der Bundesverfassung | 89 | ||
| aa) Ausschließlichkeit und Beachtung formeller Schranken | 90 | ||
| bb) Verfassungsimmanete materielle Schranken | 92 | ||
| cc) Schranken in internationalem Recht | 99 | ||
| d) Kontrolle und Durchsetzung des Bundesrechts | 101 | ||
| e) Andere Stabilisierungsinstrumente – „Wehrhafte Demokratie“ zum Schutze der Verfassung | 104 | ||
| f) Keine Sezession | 105 | ||
| II. Die EU-Gründungsverträge – „Offenes Recht“ | 106 | ||
| 1. Wesensmäßige Dynamik – Evolution des pouvoir constitué selbst (europäischer Integrationsgrundsatz) | 107 | ||
| a) Offene Normentypen und europäische Praxis | 110 | ||
| b) Exogene Integrationsschranken – „offensiv-hemmende“ Wirkung nationaler Struktursicherungsklauseln (Bsp. Art. 23 I, 3 i.V.m. 79 III GG) | 116 | ||
| 2. Formelle Flexibilität durch politischen Konsens | 119 | ||
| a) Normenhierarchie – Offener Dissens | 119 | ||
| b) Erschwerte Vertragsänderung zum Schutze der Mitgliedstaaten | 123 | ||
| aa) Formelle Schranken – Effektivität informeller Vertragsänderung | 123 | ||
| bb) Exogene materielle Schranken – „defensiv-stabilisierende“ Wirkung nationaler Struktursicherungsklauseln (Bsp. Art. 23 I, 1 GG) | 128 | ||
| cc) Schranken in internationalem Recht | 132 | ||
| c) Kontrolle und Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts – keine europäische Zwangsgewalt | 133 | ||
| d) Andere Stabilisierungsinstrumente – Ausnahmeklauseln zum Schutze der Mitgliedstaaten | 135 | ||
| e) Zulässigkeit von Sezession und Auflösung | 136 | ||
| III. Zusammenfassung | 139 | ||
| C. Legitimationsfunktion | 141 | ||
| I. Die bundesstaatliche Verfassung – Volksvermittelte Legitimation | 141 | ||
| 1. Grundlage demokratischer Legitimation – Volkssouveränität | 142 | ||
| a) Verfassungsgebung durch das Volk | 146 | ||
| b) Legitimationsträger Staatsvolk („demokratische Homogenität“) | 149 | ||
| 2. Verwirklichung demokratischer Legitimation – Repräsentative Demokratie | 153 | ||
| a) Volksvertretung als oberste Gewalt im Bunde – Die Bundesversammlung | 157 | ||
| b) (Direkt-)Demokratische Willensbildung – Politische Rechte | 160 | ||
| II. Die EU-Gründungsverträge – Staatenvermittelte Legitimation | 162 | ||
| 1. Grundlage demokratischer Legitimation – Genossenschaftlich geteilte Volkssouveränität | 164 | ||
| a) Kein „europäisches Staatsvolk“ durch Unionsbürgerschaft | 164 | ||
| b) Keine „europäische Volkssouveränität“ durch EP-Parlamentarismus | 166 | ||
| c) Begründung und Rückanbindung europäischer Hoheitsgewalt an die Mitgliedstaaten | 171 | ||
| 2. Verwirklichung demokratischer Legitimation – „institutionelles Gleichgewicht“ für hinreichend effektiven Einfluß mitgliedstaatlicher Repräsentationsorgane | 174 | ||
| a) Staatenvertretung als oberste Gewalt der EG – Die Rolle von Rat und nationalen Parlamenten | 174 | ||
| b) Unionsadäquat beschränkte Rolle des Europäischen Parlaments | 179 | ||
| c) Defizite | 181 | ||
| aa) Rat und nationale Parlamente – Angleichungen durch Nizza | 182 | ||
| bb) Europäisches Parlament | 185 | ||
| 3. Verstärkung staatenvermittelter Legitimation – Wirtschaftliche Problemlösungskompetenz der Gemeinschaft | 188 | ||
| III. Zusammenfassung | 189 | ||
| D. Integrationsfunktion | 191 | ||
| I. Die bundesstaatliche Verfassung – Individuenbezogene Integration | 191 | ||
| 1. Grundlage individuenbezogener Integration – außerrechtliche Einheit des Volkes („bündische Homogenität“) und demokratische Kultur | 193 | ||
| a) Gemeinsame Religion | 196 | ||
| b) Gemeinsame Geschichte | 199 | ||
| c) Gemeinsame geographische und wirtschaftliche Bedingungen | 202 | ||
| d) Gemeinsame Kultur und Sprache | 204 | ||
| e) Die Eidgenossen – Homogenität trotz Vielfalt | 206 | ||
| 2. Ziel und Verwirklichung individuenbezogener Integration – Gewährleistung politischer Freiheitsrechte zur Bildung eines demokratischen Kommunikationssystems | 210 | ||
| a) Politische Parteien | 210 | ||
| b) Direkt-demokratische Elemente | 213 | ||
| c) Politische und andere Freiheitsrecht; ausgrenzende Mechanismen | 214 | ||
| d) Defizite | 217 | ||
| II. Die EU-Gründungsverträge – Politische Zusammenarbeit in sich integrierter Staaten | 220 | ||
| 1. Grundlage gemeinschaftsspezifischer Integration – Heterogenität der Unionsvölker | 221 | ||
| 2. „Sozialadäquat“ begrenzte Verwirklichung individuenbezogener Integration | 236 | ||
| a) Europäische Parteien | 237 | ||
| b) Wahlen und Freiheitsrechte | 240 | ||
| 3. Ziel und Verwirklichung gemeinschaftsspezifischer Integration – Rechtsharmonisierung, kohärente Zusammenarbeit, Friedenssicherung | 244 | ||
| III. Zusammenfassung | 249 | ||
| E. Schutz- und Grundordnungsfunktion | 251 | ||
| I. Die bundesstaatliche Verfassung – Umfassende Verantwortlichkeit eines „Gemeinwesens“ | 251 | ||
| 1. Horizontale Gewaltenteilung zur Sicherung individueller Freiheit | 252 | ||
| 2. Umfassende Achtung der Grundrechte | 257 | ||
| a) Subjektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte | 258 | ||
| b) Objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte – Allseitigkeit des Staatszwecks | 261 | ||
| II. Die EU-Gründungsverträge – Duale Schutzmechanismen eines „Wirtschaftswesens“ | 268 | ||
| 1. „Institutionelles Gleichgewicht“ zur Sicherung effektiven Gemeinschaftshandelns | 269 | ||
| 2. Gemeinschaftsgrundrechte und Grundfreiheiten | 274 | ||
| a) Subjektiv-rechtliche Gehalte | 274 | ||
| aa) Strukturell defizitäre Gewährleistung von Gemeinschaftsgrundrechten | 274 | ||
| (1) Koordination und Kooperation des europäischen und einzelstaatlichen Rechtsschutzes – „Mehrdimensionalität“ nationaler Ausführungs- und gemeinschaftlicher Rechtsakte | 278 | ||
| (2) Unklare Normbereiche | 287 | ||
| (3) „Europafreundliche“ Kognition und Schrankenregelung | 289 | ||
| (4) Defizitäres EG-Prozeßrecht | 292 | ||
| (5) Verbesserungen durch europäische Grundrechtscharta? | 295 | ||
| bb) Innerstaatlich begrenzte Wirkung der Grundfreiheiten | 297 | ||
| b) Objektiv-rechtliche Gehalte – Sachliche Beschränktheit der Union | 301 | ||
| aa) Gemeinschaftsgrundrechte | 303 | ||
| bb) Grundfreiheiten und andere Gemeinschaftsgrundsätze | 307 | ||
| III. Zusammenfassung | 310 | ||
| Schlußbetrachtung: „Wunschtraum Europastaat“ | 312 | ||
| Literaturverzeichnis | 316 | ||
| Stichwortverzeichnis | 336 |
