Internationale Transmission und Koordinierung der Wirtschaftspolitik
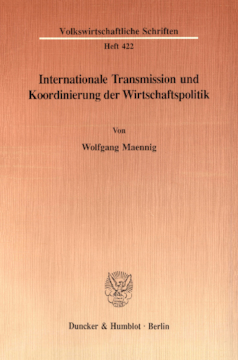
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Internationale Transmission und Koordinierung der Wirtschaftspolitik
Volkswirtschaftliche Schriften, Vol. 422
(1992)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Verzeichnis der Tabellen | 11 | ||
| Verzeichnis der Abbildungen | 12 | ||
| Symbolverzeichnis | 14 | ||
| 1 Einleitung | 15 | ||
| 2 Theorie und Empirie der internationalen Transmission und des internationalen Konjunkturzusammenhanges | 17 | ||
| 2.1 Begriffsklärung | 17 | ||
| 2.2 Die Theorie der internationalen Transmission und des internationalen Konjunkturzusammenhanges | 18 | ||
| 2.2.1 Theorie des internationalen Konjunkturzusammenhanges | 18 | ||
| 2.2.1.1 Gütermärkte | 19 | ||
| 2.2.1.2 Kapitalmärkte | 21 | ||
| 2.2.1.3 Geldmärkte | 22 | ||
| 2.2.1.4 Arbeitsmärkte | 23 | ||
| 2.2.2 Das klassische Mundell-Fleming Modell | 24 | ||
| 2.2.2.1 Flexible Wechselkurse | 24 | ||
| 2.2.2.2 Feste Wechselkurse | 26 | ||
| 2.2.3 Erweiterungen zum Mundell-Fleming Modell | 28 | ||
| 2.2.3.1 Stock versus Flow-Modelle | 28 | ||
| 2.2.3.2 Rationale Erwartungen | 29 | ||
| 2.2.3.3 Erweiterung um Angebotsbedingungen | 31 | ||
| 2.2.3.4 Variationen des Instrumenteneinsatzes | 32 | ||
| 2.2.4 Ein Grundmodell der internationalen Transmission | 33 | ||
| 2.2.4.1 Flexible Preise und indexierte Löhne | 33 | ||
| 2.2.4.1.1 Flexible Wechselkurse | 35 | ||
| 2.2.4.1.2 Feste Wechselkurse | 37 | ||
| 2.2.4.2 Drei-Länder Modell | 38 | ||
| 2.2.4.3 Eine dynamische Erweiterung | 43 | ||
| 2.3 Empirische Messung des internationalen Konjunkturzusammenhanges und der internationalen Transmission | 51 | ||
| 2.3.1 Die Variablenspezifizierung | 52 | ||
| 2.3.2 Zur Konvergenz der nationalen Konjunkturzyklen | 55 | ||
| 2.3.3 Zur relativen Bedeutung ausländischer Störungen | 63 | ||
| 2.3.3.1 Vektorautoregressive Modelle und Varianzzerlegung | 64 | ||
| 2.3.3.2 Ergebnisse | 66 | ||
| 2.3.3.3 Sensitivitätsanalyse | 73 | ||
| 2.3.4 Die internationale Transmission fiskalischer und monetärer Schocks | 75 | ||
| 2.3.4.1 Internationale Transmission in empirischen Mehr-Länder-Modellen | 76 | ||
| 2.3.4.1.1 Internationale spill-over Effekte der Fiskalpolitik | 78 | ||
| 2.3.4.1.2 Internationale spill-over Effekte der Geldpolitik | 85 | ||
| 2.3.4.2 Internationale Transmission in Impulsantwortfunktionen | 90 | ||
| 2.4 Zwischenergebnis | 102 | ||
| 3 Theorie und Empirie der internationalen Kooperation in der Wirtschaftspolitik | 107 | ||
| 3.1 Internationale Koordinierung und Kooperation: Definition | 108 | ||
| 3.2 Historische Entwicklung der Koordinierung und Kooperation | 110 | ||
| 3.3 Theorie und Empirie der internationalen Koordinierung | 121 | ||
| 3.3.1 Strategische Gleichgewichte der internationalen Wirtschaftspolitik | 122 | ||
| 3.3.1.1 Spieltheoretische Grundlagen | 123 | ||
| 3.3.1.2 Das Nash-Gleichgewicht | 127 | ||
| 3.3.1.3 Das Stackelberg-Gleichgewicht | 134 | ||
| 3.3.1.4 Konsistente konjekturale Variationen | 137 | ||
| 3.3.1.5 Das Koordinierungs-Gleichgewicht | 139 | ||
| 3.3.1.6 Zusammenfassung: Formale Voraussetzungen für Wohlfahrtsgewinne der wirtschaftspolitischen Koordinierung | 145 | ||
| 3.3.2 Erweiterungen | 146 | ||
| 3.3.2.1 Der Aspekt der Unsicherheit | 147 | ||
| 3.3.2.1.1 Unsicherheit und Wohlfahrtsverluste | 149 | ||
| 3.3.2.1.2 Koordinierungsgewinne bei Unsicherheit trotz vieler Instrumente | 152 | ||
| 3.3.2.1.3 Koordinierungsgewinne bei Unsicherheit und Instrumentenmangel | 155 | ||
| 3.3.2.2 Dynamische strategische Ansätze | 159 | ||
| 3.3.2.2.1 Die Rolle des Informationszustandes | 161 | ||
| 3.3.2.2.2 Das Problem der Zeitinkonsistenz | 162 | ||
| 3.3.2.2.3 Lösungsvorschläge zur Zeitinkonsistenz | 164 | ||
| 3.3.2.2.4 Wohlfahrtsimplikationen für die Koordinierung | 166 | ||
| 3.3.3 Kritik der diskretionären Koordinierung | 169 | ||
| 3.3.3.1 Allgemeine Kritik an diskretionärer Wirtschaftspolitik | 169 | ||
| 3.3.3.1.1 Existenz von wirkungsvollen Störungen als Voraussetzung | 169 | ||
| 3.3.3.1.2 Exogenität der Wirtschaftspolitik? | 171 | ||
| 3.3.3.1.3 Zur Frage realer Effekte durch aktive Wirtschaftspolitik | 173 | ||
| 3.3.3.1.4 Automatische Anpassung | 177 | ||
| 3.3.3.1.5 Wahl falscher Zielfunktionen | 178 | ||
| 3.3.3.1.6 Zielanpassung als Alternative | 181 | ||
| 3.3.3.2 Spezielle Argumente gegen diskretionäre Wirtschaftspolitik im Rahmen einer internationalen Koordinierung | 184 | ||
| 3.3.3.2.1 Verlust an Autonomie | 184 | ||
| 3.3.3.2.2 Koordinierung als marktfeindliche Kartellbildung | 185 | ||
| 3.3.3.2.3 Vertragsbruch, Trittbrettfahren und schlecht teilbare Interessen | 191 | ||
| 3.3.3.2.4 Problematische Verteilung der Wohlfahrtsgewinne | 197 | ||
| 3.3.3.2.5 Weitere tatsächliche und vermeintliche Probleme einer internationalen Koordinierung | 199 | ||
| 3.3.4 Empirische Evaluierung der diskretionären Koordinierung | 201 | ||
| 3.3.4.1 Die Arbeit von Oudiz und Sachs (1984) | 202 | ||
| 3.3.4.2 Erweiterungen | 206 | ||
| 3.4 Regelbindung als Alternative? Der Fall der monetären Koordinierung | 217 | ||
| 3.4.1 Rules versus discretion | 218 | ||
| 3.4.2 Flexible versus feste Wechselkurse | 221 | ||
| 3.4.3 Alternativen der internationalen währungspolitischen Koordinierung | 226 | ||
| 3.4.3.1 Feste Wechselkurse: Ist das EWS weltweit übertragbar? | 229 | ||
| 3.4.3.2 Der McKinnon-Vorschlag | 231 | ||
| 3.4.3.3 Der Zielzonenvorschlag von Williamson | 232 | ||
| 3.4.3.4 Nominal income targeting | 234 | ||
| 3.4.3.5 Internationale Abstimmung von Devisenmarktinterventionen | 235 | ||
| 3.4.4 Kritik der Reformvorschläge | 237 | ||
| 3.4.4.1 Theoretische Überlegungen | 237 | ||
| 3.4.4.2 Empirische Evaluierung der monetären Koordinierung | 239 | ||
| 3.4.4.3 Zur politischen Umsetzbarkeit der Reformvorschläge | 243 | ||
| 3.5 Zwischenergebnis | 245 | ||
| 4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen | 249 | ||
| Anhang | 258 | ||
| zu Abschnitt 2.2.4.3 | 258 | ||
| zu Abschnitt 2.3.3.3 | 260 | ||
| zu Abschnitt 2.3.4.2 | 263 | ||
| zu Abschnitt 3.3.1.4 | 265 | ||
| Interview mit Staatssekretär Dr. Tietmeyer | 266 | ||
| Literaturverzeichnis | 274 |
