Der Rechtsbegriff »Stand der Wissenschaft« aus erkenntnistheoretischer Sicht
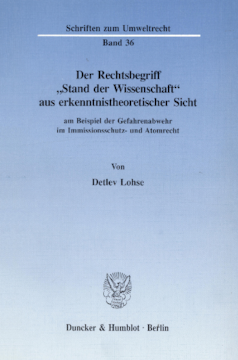
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der Rechtsbegriff »Stand der Wissenschaft« aus erkenntnistheoretischer Sicht
am Beispiel der Gefahrenabwehr im Immissionsschutz- und Atomrecht
Schriften zum Umweltrecht, Vol. 36
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Von den »Schriften zum Umweltrecht« (SUR) sind seit 1981 über 190 Bände erschienen. Die Schriften zum Umweltrecht begleiten die Entwicklung des modernen deutschen und europäischen Umweltrechts damit seit über 30 Jahren - also schon nahezu seit der Etablierung des Umweltrechts als eigenständiges Rechtsgebiet in Deutschland - umfassend und stets hochaktuell durch die Publikation von Monografien und Sammelbänden mit umweltrechtlicher Schwerpunktsetzung. Die Schriftenreihe erfasst alle Rechtsgebiete des Umweltrechts und geht über öffentlich-rechtliche Fragestellungen hinaus. Sie erfasst u.a. auch zivil- und strafrechtliche sowie völkerrechtliche und europarechtliche Themen. Herausgeber der Schriftenreihe ist Prof. Dr. Michael Kloepfer von der Humboldt-Universität zu Berlin. Einen großen Anteil am Erfolg der Schriften zum Umweltrecht hat auch die Arbeit des an der Humboldt-Universität zu Berlin ansässigen Forschungszentrums Umweltrecht e.V. (FZU), dessen Präsident Prof. Dr. Michael Kloepfer ist.((vorletzten Satz für die Homepage entfernen))
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 10 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| Erstes Kapitel: Die Gefahrenabwehr im Immissionsschutz- und Atomrecht | 15 | ||
| A. Tatbestandliche Anforderungen der Gefahrenabwehr | 15 | ||
| B. Konkretisierung der Anforderungen und Genehmigungspraxis | 17 | ||
| C. Die Immissionsgrenzwerte nach dem BImSchG | 19 | ||
| I. Die Festlegung der Immissionsgrenzwerte | 19 | ||
| II. Die Ableitung der MI-Werte | 20 | ||
| 1. Vorbemerkung | 20 | ||
| 2. Der Sicherheitsfaktor | 22 | ||
| 3. Schlußbemerkung | 24 | ||
| III. Die Luftqualitätskriterien | 24 | ||
| 1. Begriffsbestimmung und methodische Probleme | 24 | ||
| 2. Toxikologische Untersuchungen | 25 | ||
| 3. Epidemiologische Untersuchungen | 28 | ||
| 4. In-vitro-Versuche an biologischem Material | 30 | ||
| 5. Kasuistische Erfahrungen beim Menschen | 30 | ||
| 6. Zusammenfassung | 31 | ||
| IV. Immissionsgrenzwerte und karzinogene Stoffe | 31 | ||
| D. Die atomrechtlichen Strahlengrenzwerte | 32 | ||
| I. Vorbemerkung | 32 | ||
| II. Radiologische Grundlagen | 33 | ||
| III. Radiologische Wirkungen und Wirkungsschwellen | 35 | ||
| IV. Die Festsetzung radiologischer Immissionsgrenzwerte | 36 | ||
| 1. Die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutz-Kommission | 36 | ||
| 2. Das “0,3-mSv-Konzept” der Bundesregierung | 38 | ||
| V. Verfahren der Datenerhebung und Festlegung der atomrechtlichen Strahlengrenzwerte – Ergebnis | 39 | ||
| E. Der Maßstab der “praktischen Vernunft” | 40 | ||
| I. Die praktische Vernunft als materieller Standard | 40 | ||
| 1. Praktische Vernunft als das Urteil des erfahrenen Technikers und Naturwissenschaftlers | 41 | ||
| 2. Praktische Vernunft als “Sozialadäquanz” | 43 | ||
| 3. Zusammenfassung | 44 | ||
| II. Der “Maßstab der praktischen Vernunft” als sicherheitsrechtliche Anforderung für das Auslegen einer genehmigungsbedürftigen Anlage | 44 | ||
| 1. Die auslegungstechnisch relevanten “auslösenden Ereignisse” und “Auslegungsbeanspruchungen” | 44 | ||
| 2. Vermeidung “auslösender Ereignisse” und Beherrschung der “Auslegungsbeanspruchungen” durch Sicherstellen der Funktionserfüllung von Komponenten und Systemen | 47 | ||
| 3. Funktionserfüllung durch Erhaltung der “Integrität” | 48 | ||
| 4. Funktionserfüllung durch Gewährleistung der “Zuverlässigkeit” | 50 | ||
| 5. Zusammenfassung | 52 | ||
| III. Verfahren der Datenerhebung und methodische Probleme | 53 | ||
| 1. Problemstellung | 53 | ||
| 2. Experimentelle Untersuchungen | 54 | ||
| a) Verbot von Menschenversuchen | 56 | ||
| b) Komplexität und Unzugänglichkeit | 59 | ||
| 3. Simulation | 62 | ||
| 4. Auswertung von Betriebserfahrungen | 64 | ||
| 5. Zusammenfassung | 65 | ||
| F. Zusammenfassung | 66 | ||
| Zweites Kapitel: Der Stand der Wissenschaft aus erkenntnistheoretischer Sicht | 67 | ||
| A. Die Wissenschaft als empirische Wissenschaft | 68 | ||
| B. Die Abgrenzung empirischer Erkenntnisse von anderen | 70 | ||
| I. Induktion als Abgrenzungskriterium | 71 | ||
| 1. Die induktive Erkenntnismethode | 71 | ||
| 2. Zusammenfassung der und Einwände gegen die induktive Erkenntnismethode | 73 | ||
| 3. Das Induktionsproblem | 74 | ||
| 4. Der Versuch, den induktiven Übergang als logische Folgerung zu deuten | 74 | ||
| 5. Der Versuch, den induktiven Übergang aus der Erfahrung abzuleiten | 75 | ||
| 6. Induktive Schlüsse als Wahrscheinlichkeitsschlüsse | 76 | ||
| 7. Das Problem der Beziehung von Theorie und Erfahrung | 77 | ||
| 8. Zusammenfassung | 78 | ||
| II. Falsifikation als Abgrenzungskriterium | 79 | ||
| 1. Die hypothetisch-deduktive Erkenntnismethode | 79 | ||
| 2. Logische Aspekte der Falsifikation | 81 | ||
| 3. Methodische Aspekte der Falsifikation | 83 | ||
| 4. Pragmatische Aspekte der Falsifikation | 85 | ||
| 5. Einwände gegen die Existenz einer Asymmetrie zwischen Verifikation und Falsifikation | 86 | ||
| 6. Falsifikation mit falliblen Prüfsätzen | 87 | ||
| 7. Wissenschaftshistorischer Einwand gegen die hypothetisch-deduktive Erkenntnismethode | 89 | ||
| 8. Zusammenfassung | 91 | ||
| III. Anerkennung der “wissenschaftlichen Gemeinschaft” als Abgrenzungskriterium | 92 | ||
| 1. Der wissenschaftshistorische Ansatz des Paradigma-Modells von Thomas S. Kuhn | 92 | ||
| 2. Normalwissenschaftliche Forschung | 94 | ||
| 3. Krise und Übergang zur außerordentlichen wissenschaftlichen Forschung | 97 | ||
| 4. Logik oder Psychologie der Forschung? | 98 | ||
| 5. Einwände gegen Kuhn | 99 | ||
| 6. Zusammenfassung | 100 | ||
| IV. Schlußbemerkung | 101 | ||
| C. Der “Stand” einer Wissenschaft | 102 | ||
| I. Der Stand der Wissenschaft als Fortschrittsbasis | 102 | ||
| II. Fortschrittsbasis und Erkenntnistheorie | 102 | ||
| III. Autonomie der Wissenschaft und Fortschrittsbasis | 103 | ||
| IV. Zusammenfassung | 105 | ||
| D. Die Abgrenzung Wissenschaft/Technik | 106 | ||
| I. Die Einheitlichkeit des Technikbegriffs im Anlagenrecht | 106 | ||
| II. Abgrenzung Wissenschaft / Technik unter dem Gesichtspunkt der Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 106 | ||
| III. Zusammenfassung | 108 | ||
| E. Ergebnis | 108 | ||
| Drittes Kapitel: Die normativ gebotene Gefahrenabwehr und der Stand der Wissenschaft | 110 | ||
| A. Die Auslegung der Formel in Literatur und Rechtsprechung | 110 | ||
| B. Die Genehmigungsgrundlage und der Stand der Wissenschaft | 113 | ||
| I. Methodische Probleme der Verfahren der Datenerhebung unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten | 114 | ||
| II. Methodische Probleme und Induktivismus | 115 | ||
| 1. Vorbemerkung | 115 | ||
| 2. Toxikologische Untersuchungen | 116 | ||
| 3. Experimentelle Untersuchungen | 117 | ||
| 4. In-vitro-Versuche an biologischem Material und Simulation | 118 | ||
| 5. Zwischenergebnis | 119 | ||
| 6. Epidemiologische Untersuchungen | 120 | ||
| 7. Kasuistische Erfahrungen beim Menschen und Auswertung von Betriebserfahrungen | 120 | ||
| 8. Zwischenergebnis | 121 | ||
| III. Methodische Probleme und Falsifikationismus | 122 | ||
| 1. Vorbemerkung | 122 | ||
| 2. Toxikologische und experimentelle Untersuchungen | 122 | ||
| 3. In-vitro-Versuche an biologischem Material und Simulation | 124 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 125 | ||
| 5. Epidemiologische Untersuchungen, kasuistische Erfahrungen beim Menschen und Auswertung von Betriebserfahrungen – Zwischenergebnis | 125 | ||
| IV. Methodische Probleme und das Paradigma-Modell von Kuhn | 126 | ||
| 1. Vorbemerkung | 126 | ||
| 2. Präzisierung des Kuhnschen Modells | 127 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 127 | ||
| V. Ergebnis | 128 | ||
| C. Die erkenntnistheoretisch orientierte Auslegung der Formel | 130 | ||
| D. Die Grenzen der Gefahrenabwehr | 131 | ||
| E. Ergebnis | 133 | ||
| Zusammenfassung | 135 | ||
| Schrifttumsverzeichnis | 137 |
