Kodifikationsgeschichtliche Zusammenhänge des Abtretungsverbots
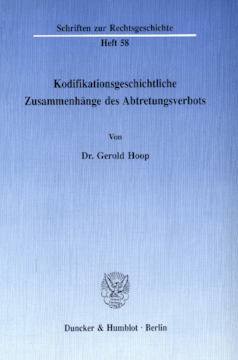
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Kodifikationsgeschichtliche Zusammenhänge des Abtretungsverbots
Die vermögensrechtliche Konzeption ausgewählter naturrechtlicher und pandektistischer Kodifikationen und deren Verflechtung (ABGB, ALR, CC, ZGB, BGB, Liechtenstein): Der weite Sachbegriff als Bindeglied zwischen Sachen- und Schuldrecht zum Oberbegriff Ver
Schriften zur Rechtsgeschichte, Vol. 58
(1992)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 11 | ||
| TEIL 1: Das Abtretungsverbot unter Berücksichtigung des Forderungsbegriffs und der Sachtradition | 15 | ||
| A. Das Abtretungsverbot: Hindernis der Refinanzierung durch Zessionskredite oder Factoring | 15 | ||
| I. Einleitung | 15 | ||
| II. Die rechtliche Wirkung des Abtretungsverbots | 16 | ||
| III. Abwägung von Interessenbewertungen | 20 | ||
| 1. Die gesetzliche Regelung | 21 | ||
| 2. Die Position des Gläubigers | 22 | ||
| B. Entstehungszusammenhänge und Verflechtung verschiedener Rechtsordnungen in vermögensrechtlichen Fragen | 23 | ||
| I. Einführung | 23 | ||
| II. Begriff der Sache im römisch-gemeinen Recht | 25 | ||
| III. Geschichte der Forderungsabtretung | 27 | ||
| 1. Römisches Recht | 27 | ||
| 2. Glossatoren und Kommentatoren | 28 | ||
| 3. Das deutsche Recht | 29 | ||
| 4. Usus modernus pandectarum | 31 | ||
| 5. Vernunftrecht | 32 | ||
| IV. Das ABGB | 33 | ||
| 1. Begründung einer eigenständigen österreichischen Rechtswissenschaft | 33 | ||
| 2. Der Sachbegriff des ABGB | 36 | ||
| 3. Der Eigentumsbegriff des ABGB | 38 | ||
| 4. Die Zession des ABGB | 40 | ||
| 5. Folgerungen für die Wirkung des Abtretungsverbots | 41 | ||
| V. Der Einfluß der rechtshistorischen Schule | 43 | ||
| 1. Bestrebungen der pandektistischen Interpretation des ABGB | 43 | ||
| a) Versuch der Proskription von Martinis und Zeillers naturrechtlichen Lehrbüchern | 46 | ||
| b) Wiedereingliederung der österreichischen Rechtswissenschaft in die gesamtdeutsche durch die Universitätsreform des Ministers Thun-Hohenstein | 48 | ||
| 2. Die Rückkehr zum ABGB | 55 | ||
| VI. Argument für die relative Wirkung des Abtretungsverbots aus dem Publizitätsprinzip | 59 | ||
| VII. Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR) von 1794 | 62 | ||
| 1. Der Sachbegriff des ALR | 64 | ||
| 2. Der Eigentumsbegriff des ALR | 65 | ||
| 3. Die Zession des ALR | 66 | ||
| a) Die Lehre des ALR und der Einfluß der Pandektistik | 68 | ||
| b) Die Zession unter Einwirkung der Pandektistik | 69 | ||
| 4. Das Verfügungsverbot bei körperlichen Sachen und das Abtretungsverbot | 70 | ||
| VIII. Einwirkung des ALR, des gemeinen Rechts und des BGB auf das Abtretungsverbot des ABGB | 72 | ||
| 1. Bezugnahme auf das ALR bei der Beratung des BGB | 72 | ||
| 2. Bezugnahme auf das gemeine Recht bei der Beratung des BGB | 74 | ||
| a) Angleichung der Entwicklungslinien des romanistischen mit dem germanistischen und vernunftrechtlichen Zessionsrecht | 74 | ||
| b) Die Entstehungsgeschichte des Abtretungsverbots im BGB | 77 | ||
| c) Die Forderung und Zession des BGB | 80 | ||
| 3. Verfügungsbefugnis im BGB | 81 | ||
| IX. Absolutes Zessionsverbot und Pfändbarkeit | 82 | ||
| X. Das schweizerische Zivilgesetzbuch und Obligationenrecht | 83 | ||
| 1. Rechtszustand vor den kantonalen Kodifikationen | 83 | ||
| 2. Die kantonalen Kodifikationen | 84 | ||
| a) Die Anlehnung von Kodifikationen an das österreichische ABGB | 84 | ||
| b) Österreichische Einwirkung auf die Rechtswissenschaft | 86 | ||
| 3. Der Weg zur Rechtseinheit | 87 | ||
| 4. Ausstrahlung der Historischen Schule und Pandektistik auf das schweizerische Recht und der Widerstand Bluntschlis | 89 | ||
| a) Bluntschli und das Privatrechtliche Gesetzbuch für den Kanton Zürich (PGB) von 1853–1856 | 89 | ||
| b) Der Sachbegriff des PGB | 92 | ||
| c) Die Zession des PGB | 94 | ||
| 5. Der Sach-, Forderungs- und Zessionsbegriff des ZGB und OR | 95 | ||
| a) Einfluß der Pandektistik auf Gesetz, Gerichtsgebrauch und Lehre | 95 | ||
| aa) Eugen Huber als Romanist | 95 | ||
| bb) Einfluß auf Gesetzgeber, Richter und Lehre | 96 | ||
| cc) Der Sachbegriff des ZGB | 97 | ||
| b) Die rechtliche Struktur der Obligation | 98 | ||
| aa) Forderungen als Rechtsobjekte von Nutznießung und Pfandrecht | 99 | ||
| bb) Die Globalzession und ihr Verfügungsobjekt Forderung | 101 | ||
| 6. Verfügungsbeschränkungen und Abtretungsverbot | 103 | ||
| XI. Das französische Recht | 104 | ||
| 1. Die Zeit der Coutumes | 106 | ||
| 2. Signifikation und Tradition | 109 | ||
| 3. Die Forderung als Vermögensgegenstand | 114 | ||
| 4. Die Veräußerungsbeschränkung körperlicher Sachen und das Abtretungsverbot | 117 | ||
| 5. Die Subrogation und das „Dailly-Gesetz“ | 118 | ||
| XII. Liechtenstein | 119 | ||
| 1. Die Rezeption von österreichischem und schweizerischem Privatrecht | 119 | ||
| 2. Das Zusammenspiel von Schuld- und Sachenrecht | 122 | ||
| 3. Das Begriffspaar „res corporales – res incorporales“ und das subjektive Recht | 124 | ||
| a) Von der Trichotomie des Gaiussystems zur Vierteilung der Glossatoren in personae, res, obligationes und actiones | 127 | ||
| b) Der Gang zur Zweiteilung in dominium und obligatio | 129 | ||
| c) Die strikte Trennung von Sachen- und Schuldrecht | 130 | ||
| 4. Die vernunftrechtliche Konzeption des Vermögensrechts und die Zession | 132 | ||
| 5. Relativierung der Trennung von Schuld- und Sachenrecht | 135 | ||
| 6. Der „weite Sachbegriff“, die Rechtszuständigkeit und das Abtretungsverbot | 140 | ||
| XIII. Ausblick | 143 | ||
| TEIL 2: Politische Absicht und rechtstheoretisches Programm der Historischen Schule und der Grund für die Ablehnung der Kodifikationen durch Savigny | 145 | ||
| I. Einwirkung der Pandektistik auf das Recht der Schweiz und Österreichs | 145 | ||
| 1. Gründe des Einflusses in Österreich | 147 | ||
| 2. Gründe des Einflusses in der Schweiz | 148 | ||
| 3. Die Erwerbsgesellschaft | 148 | ||
| 4. Die Begleitumstände | 149 | ||
| II. Savigny und die Gründung der Historischen Schule | 150 | ||
| 1. Savignys Lebensweg | 151 | ||
| 2. „Recht des Besitzes“ und seine Wirkung | 152 | ||
| a) Leitbild für Mühlenbruchs Zessionslehre | 153 | ||
| b) Gründe und Methode der Änderung dieser Lehre | 154 | ||
| c) Rechtsbesitz im ALR, ABGB, BGB und ZGB | 155 | ||
| d) Der Widerstand von Gans | 159 | ||
| 3. Ursachen und Vorgang der Nationalisierung des Rechts | 162 | ||
| 4. Wirtschaftliche Verhältnisse um 1814 | 162 | ||
| 5. Der Vorschlag Thibauts | 163 | ||
| 6. Die Antwort Savignys | 164 | ||
| 7. Die Entstehung des Rechts und Gründe der Rezeption nach der Historischen Schule | 166 | ||
| 8. Volksrecht und Juristenrecht: Einfluß auf die Schweiz | 169 | ||
| III. Der Grund für Savignys Ablehnung der Kodifikationen | 171 | ||
| 1. Ausbildung des römischen Vermögensrechtssystems | 171 | ||
| 2. Savignys Rechtsquellenlehre in seiner „Methodenlehre“ 1803 | 174 | ||
| 3. Die geänderte Rechtsquellenlehre 1814 | 174 | ||
| a) Die formale Rechtsauffassung | 176 | ||
| b) Anpassung der Volksgeistlehre | 178 | ||
| c) Völkerschlacht bei Leipzig | 179 | ||
| 4. Der Wunsch nach der Einheit Deutschlands | 180 | ||
| 5. Rechtseinheit durch die Rechtswissenschaft | 182 | ||
| 6. Recht, Gesetz und Staat | 183 | ||
| 7. Die Germanisten und das Naturrecht | 187 | ||
| 8. Anforderungen an das Recht im Wandel der Zeit | 190 | ||
| a) Aufgaben für die Germanistik und Pandektistik | 190 | ||
| b) Die Verkörperung der Obligation | 191 | ||
| 9. Aufklärung und Naturrecht | 192 | ||
| Literaturverzeichnis | 196 |
