Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach 1648
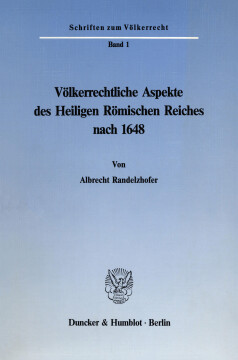
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Völkerrechtliche Aspekte des Heiligen Römischen Reiches nach 1648
Schriften zum Völkerrecht, Vol. 1
(1967)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort zum unveränderten Nachdruck 1988 | 6 | ||
| Vorwort | 8 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 18 | ||
| Einleitung | 19 | ||
| A. Ziel der Arbeit | 19 | ||
| B. Eingrenzung des Themas | 20 | ||
| C. Methode der Arbeit | 21 | ||
| 1. Allgemein | 21 | ||
| 2. Gefahren dieser Methode | 21 | ||
| 3. Rechtfertigung dieser Methode | 22 | ||
| Erster Teil: Kurzer geschichtlicher Überblick bis zum Jahre 1648 | 25 | ||
| A. Notwendigkeit einer solchen Darstellung | 25 | ||
| B. Die Begrenztheit dieser Darstellung | 25 | ||
| I. Kapitel: Das frühe fränkische Reich als zentraler und personaler Herrschaftsverband | 27 | ||
| 1. Das Frankenreich als Ausgangspunkt für das Heilige Römische Reich | 27 | ||
| a) Allgemein | 27 | ||
| b) Problem des Übergangs vom Frankenreich zum deutschen Reich | 27 | ||
| 2. Entstehung des fränkischen Reiches | 28 | ||
| 3. Das neue Königtum | 28 | ||
| 4. Das Heerwesen | 29 | ||
| 5. Verwaltung und Finanzen | 29 | ||
| 6. Gerichtsbarkeit | 30 | ||
| 7. Wertung | 31 | ||
| II. Kapitel: Entstehen des Lehnstaates. Die Funktion des Lehnswesens als Grundlage der Verfassung des Reiches | 32 | ||
| 1. Die Entstehung des Lehnswesens | 32 | ||
| a) Das persönliche Element des Lehnswesens | 32 | ||
| aa) Die Kommendation | 32 | ||
| bb) Die Gefolgschaft | 32 | ||
| b) Benefizium | 33 | ||
| c) Verbindung von Vasallität und Benefizium | 33 | ||
| 2. Einbau des Lehnswesens in die Reichsverfassung | 33 | ||
| a) Umgestaltung der Verfassungsinstitutionen | 33 | ||
| aa) Hofämter | 33 | ||
| bb) Heerwesen | 34 | ||
| cc) Verwaltung | 34 | ||
| dd) Gerichtsbarkeit | 35 | ||
| 3. Das Lehnswesen als äußerer Rahmen der Verfassung. Unterschiedliche Ausgestaltung dieses Rahmens | 35 | ||
| a) Das Reich unter einzelnen Kaisern | 36 | ||
| aa) Karl der Große | 36 | ||
| bb) Otto der Große | 37 | ||
| cc) Heinrich IV | 37 | ||
| dd) Friedrich I | 37 | ||
| 4. Wertung | 38 | ||
| III. Kapitel: Die Wandlung des Reiches zur reinen Wahlmonarchie | 39 | ||
| 1. Der Vorgang | 39 | ||
| a) Ursprünglich Geblütsrecht | 39 | ||
| b) Faktische Erbmonarchie unter den Karolingern und den Sachsenkaisern | 39 | ||
| c) Ursprünglich Wahl durch das Volk | 39 | ||
| d) Übergang des Wahlrechtes auf bestimmte Fürsten | 40 | ||
| aa) Die drei Stadien der Wahl | 40 | ||
| bb) Hervortreten einzelner hervorragender Persönlichkeiten | 40 | ||
| cc) Die „deliberatio super tribus electis“ | 41 | ||
| dd) Die Regelung des Sachsenspiegels | 41 | ||
| ee) Der Kurverein zu Rhense | 42 | ||
| ff) Die Goldene Bulle | 42 | ||
| 2. Bedeutung für die Verfassungsentwicklung des Reiches | 42 | ||
| IV. Kapitel: Der Zerfall des Lehnstaates und die Grundlagen der Entwicklung der Territorien des Reiches zu Staaten | 43 | ||
| 1. Die zentrifugalen Tendenzen des Lehnswesens | 43 | ||
| a) Verdinglichung des Lehnswesens | 43 | ||
| b) Aufkommen des Lehnzwanges | 43 | ||
| c) Mediatisierung der Untertanen | 44 | ||
| d) Erblichwerden der Lehen | 44 | ||
| 2. Auswirkung auf das Grafenamt | 45 | ||
| 3. Die Immunität | 45 | ||
| a) Allgemein | 45 | ||
| b) Entwicklung der Immunitätsgerichtsbarkeit | 46 | ||
| 4. Das Stammesherzogtum | 46 | ||
| 5. Die Reichsgesetze von 1220 und 1232 | 47 | ||
| 6. Die Goldene Bulle | 48 | ||
| 7. Wertung | 49 | ||
| V. Kapitel: Der Versuch, die Einheit des Reiches zu bewahren: Die Reichsreform | 50 | ||
| 1. Reformliteratur | 50 | ||
| 2. Die Reform | 50 | ||
| 3. Ergebnis | 51 | ||
| Zweiter Teil: Das Reich von 1648 bis zu seinem Ende 1806 | 53 | ||
| A. Grundsätzliches | 53 | ||
| I. Kapitel: Der Westfälische Frieden | 54 | ||
| 1. Grundsätzliche Bedeutung | 54 | ||
| 2. Wichtigste Einzelbestimmungen des Vertrages | 56 | ||
| a) Zentrale Bedeutung des Art. VIII §§ 1, 2 IPO | 56 | ||
| b) Weitere Bestimmungen | 58 | ||
| c) Einbeziehung alten Rechtes in den Vertrag | 60 | ||
| d) Zusammenfassung | 61 | ||
| II. Kapitel: Die Zeit vom Westfälischen Frieden bis zum Ende des Reiches | 63 | ||
| 1. Der Zeitraum von 1648 bis 1806 als Einheit hinsichtlich der rechtlichen Gestaltung des Reiches | 63 | ||
| a) Verfassungsänderung | 63 | ||
| b) Verfassungswandel | 65 | ||
| c) Ergebnis | 65 | ||
| Dritter Teil: Urteile der Rechts- und Geschichtswissenschaft über das Reich seit dem 17. Jahrhundert | 67 | ||
| A. Allgemeines | 67 | ||
| I. Kapitel: Beurteilungen im 17. Jahrhundert | 68 | ||
| 1. Berücksichtigung der vor 1648 erschienenen Literatur | 68 | ||
| 2. Bedeutung der Frage nach der Rechtslage des Heiligen Römischen Reiches im 17. Jahrhundert | 68 | ||
| 3. Beurteilungen | 70 | ||
| a) Das Reich als Monarchie | 70 | ||
| aa) Die Lehre von Reinkingk | 70 | ||
| bb) Die Lehre von Arumaeus | 72 | ||
| b) Das Reich als Aristokratie | 73 | ||
| aa) Die Lehre von Chemnitz | 73 | ||
| c) Die Lehre vom ‚Status mixtus‘ des Reiches | 76 | ||
| aa) Johann Limnaeus (1592–1663) | 76 | ||
| d) Die Lehre vom Reich als einer ‚Civitas composita‘ | 77 | ||
| aa) Die Lehre Besolds | 77 | ||
| bb) Die Lehre Hugos | 78 | ||
| e) Die Lehre von Leibniz | 80 | ||
| f) Die Lehre Pufendorfs | 81 | ||
| II. Kapitel: Beurteilungen im 18. Jahrhundert | 85 | ||
| 1. Wandel in der Bedeutung der Frage | 85 | ||
| 2. Beurteilungen | 86 | ||
| a) Die Lehre von Moser | 86 | ||
| b) Die Lehre Pütters vom zusammengesetzten Staat | 87 | ||
| c) Die Lehre Häberlins | 89 | ||
| d) Die Lehre Hegels | 90 | ||
| III. Kapitel: Beurteilungen seit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches bis zur Gegenwart | 92 | ||
| 1. Allgemeine Charakterisierung | 92 | ||
| 2. Beurteilungen | 92 | ||
| a) Das Reich als Bundesstaat | 92 | ||
| aa) H. B. Oppenheim | 92 | ||
| bb) Brie | 93 | ||
| b) G. Jellineks Lehre vom Reich als Staatenstaat | 93 | ||
| c) Unselbständige und juristisch unscharfe Beurteilungen | 94 | ||
| aa) G. Meyer | 94 | ||
| bb) Kormann | 95 | ||
| cc) Schulte | 95 | ||
| dd) Bornhak | 96 | ||
| ee) E. R. Huber | 96 | ||
| ff) v. Srbik | 97 | ||
| gg) Feine | 97 | ||
| hh) Molitor | 98 | ||
| ii) Hartung | 98 | ||
| kk) Forsthoff | 99 | ||
| d) Beurteilungen des Reiches auf völkerrechtlicher Grundlage | 99 | ||
| aa) K. S. Zachariä | 99 | ||
| bb) Aegidi | 100 | ||
| cc) Bryce | 101 | ||
| dd) Berber | 102 | ||
| IV. Kapitel: Kritische Würdigung der dargestellten Meinungen | 103 | ||
| 1. Zum Teil handelt es sich um politische Kampfschriften | 103 | ||
| 2. Zum Teil sind sie bedingt durch die staatstheoretischen Doktrinen und Theorien ihrer Zeit | 103 | ||
| 3. Die historische Einmaligkeit des Reiches wird überbetont | 104 | ||
| 4. Das Problem wird fast ausschließlich von einem staatsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet | 105 | ||
| 5. Ergebnis | 107 | ||
| Vierter Teil: Die Rechtslage des Heiligen Römischen Reiches nach 1648 aus völkerrechtlicher Sicht | 109 | ||
| A. Der Begriff des Völkerrechtes | 109 | ||
| I. Kapitel: Wesen und Begriff des Staates | 117 | ||
| 1. Die Erfordernisse des Staates nach der Allgemeinen Staatslehre und der Völkerrechtslehre | 117 | ||
| a) Die Drei-Elementen-Lehre | 117 | ||
| b) Angriffe gegen die Drei-Elementen-Lehre | 119 | ||
| c) Rechtfertigung der Drei-Elementen-Lehre | 119 | ||
| d) Staatsvolk | 120 | ||
| e) Staatsgebiet | 121 | ||
| f) Staatsgewalt | 121 | ||
| II. Kapitel: Die Staatlichkeit der Territorien des Heiligen Römischen Reiches | 127 | ||
| 1. Staatsgebiet und Staatsvolk | 127 | ||
| 2. Staatsgewalt | 128 | ||
| a) Entstehung und Entwicklung der Landeshoheit | 128 | ||
| b) Landeshoheit und Staatsgewalt | 130 | ||
| c) Prüfung der Landeshoheit an der Definition der Staatsgewalt | 131 | ||
| aa) Grundsätzliches | 131 | ||
| bb) Behörden | 132 | ||
| cc) Organisation der Behörden | 137 | ||
| dd) Umfang der Landeshoheit | 138 | ||
| ee) Landeshoheit als ursprüngliche Gewalt | 141 | ||
| ff) Landeshoheit als Gebiets- und Personalhoheit | 142 | ||
| d) Ergebnis | 143 | ||
| III. Kapitel: Der Staat als Völkerrechtssubjekt | 144 | ||
| 1. Die Souveränität | 144 | ||
| a) Ursprung des Begriffes | 145 | ||
| b) Wandel des Begriffes | 147 | ||
| 2. Theorien zur Beseitigung des traditionellen Souveränitätsbegriffes | 150 | ||
| a) Weltstaatstheorien | 150 | ||
| b) Universalrechtstheorien | 151 | ||
| aa) Pluralismus | 151 | ||
| bb) Rechtssouveränität | 151 | ||
| c) Das Fehlen der Souveränität als Merkmal des Staates im Sinne des Völkerrechtes bei einem Teil der nordamerikanischen Völkerrechtslehre | 152 | ||
| 3. Kritik an den Theorien zur Beseitigung des Souveränitätsbegriffes | 153 | ||
| 4. Unvereinbarkeit des traditionellen Souveränitätsbegriffes mit der heutigen Theorie des Völkerrechts und der internationalen Wirklichkeit | 153 | ||
| 5. Berbers Begriff der Unabhängigkeit an Stelle des traditionellen Souveränitätsbegriffes | 155 | ||
| IV. Kapitel: Die Territorien des Reiches als Völkerrechtssubjekte | 159 | ||
| 1. Das Vertragsschließungsrecht nach Art. VIII § 2 IPO | 159 | ||
| a) Bedeutung dieser Vertragsschließungskompetenz nach der Montevideo-Akte | 159 | ||
| b) Bedeutung der Vertragsschließungskompetenz nach der hier vertretenen Ansicht | 160 | ||
| aa) Das Vertragsschließungsrecht bewirkt die Völkerrechtssubjektivität der Territorien, soweit diese mit auswärtigen Staaten Verträge schließen | 160 | ||
| bb) Das Vertragsschließungsrecht bewirkt aber nicht notwendig die generelle Völkerrechtssubjektivität der Territorien | 161 | ||
| cc) Das Vertragsschließungsrecht ist ein starkes Indiz für die generelle Völkerrechtssubjektivität, da es ein ursprüngliches und grundsätzlich unbeschränktes Recht ist | 161 | ||
| 2. Die Unabhängigkeit der Gliedstaaten | 164 | ||
| a) Meinungen | 164 | ||
| b) Auslegung des Art. VIII §§ 1, 2 IPO aus Wortlaut und Entstehungsgeschichte | 165 | ||
| c) Prüfung der rechtlichen und tatsächlichen Einschränkung der Landeshoheit mit Hilfe von Berbers Unabhängigkeitsbegriff | 167 | ||
| aa) Grundsätzliches | 167 | ||
| bb) Einschränkungen und Unterordnung der Landeshoheit | 168 | ||
| (1) Einschränkungen der Landeshoheit durch den Kaiser | 168 | ||
| (a) Der Kaiser ist nominelles Oberhaupt des Reiches | 169 | ||
| (b) Der Kaiser ist Lehnsherr der Landesherrn | 169 | ||
| (c) Der Kaiser kann aber in den Gliedstaaten nur mehr seine Reservatrechte ausüben | 170 | ||
| (d) Eingriffe des Kaisers in die Staatsgewalt der Gliedstaaten verbieten die Reichsgesetze | 171 | ||
| (e) Der Kaiser kann allein nicht mehr die Acht erklären | 172 | ||
| (f) Tatsächliche Eingriffe des Kaisers in die Landeshoheit | 173 | ||
| (α) Der Fall Nassau-Siegen | 173 | ||
| (β) Der Fall Mecklenburg-Schwerin | 174 | ||
| (γ) Bewertung dieser Fälle | 175 | ||
| (δ) Eingriffe gegenüber den Reichsstädten | 177 | ||
| (ε) Bewertung | 179 | ||
| (g) Ergebnis | 179 | ||
| (2) Einschränkung der Landeshoheit durch Gemeinschaftsorgane der Gliedstaaten | 180 | ||
| (a) Einschränkung der Landeshoheit durch den Reichstag | 180 | ||
| (α) Gesetzgebung | 181 | ||
| (β) Achtserklärung | 185 | ||
| (γ) Ergebnis | 187 | ||
| (b) Einschränkung der Landeshoheit durch die Reichsgerichte | 187 | ||
| (α) Das Reichskammergericht | 187 | ||
| (β) Der Reichshofrat | 191 | ||
| (3) Sonstige Einschränkungen der Landeshoheit | 192 | ||
| (4) Ergebnis | 193 | ||
| V. Kapitel: Die Staatlichkeit des Reiches | 194 | ||
| 1. Als Bundesstaat | 194 | ||
| 2. Als Rumpfstaat | 194 | ||
| a) Das Problem der freien Reichsritterschaft | 195 | ||
| 3. Ergebnis | 196 | ||
| Fünfter Teil: Das Heilige Römische Reich als eine hoch entwickelte partikulare Völkerrechtsordnung, als ein Beispiel internationaler Integration | 199 | ||
| I. Kapitel: Die Völkerrechtsquellen im Heiligen Römischen Reich | 199 | ||
| 1. Das allgemeine Völkergewohnheitsrecht | 199 | ||
| 2. Das ehemals innerstaatliche Recht | 200 | ||
| 3. Das seit 1648 zwischen den Gliedstaaten entstehende Recht | 200 | ||
| 4. Die Funktion des Römischen Rechtes | 201 | ||
| 5. Bewertung | 202 | ||
| II. Kapitel: Die diplomatischen Beziehungen der deutschen Gliedstaaten untereinander und mit außerdeutschen Staaten | 203 | ||
| 1. Die Bedeutung des diplomatischen Verkehrs | 203 | ||
| a) Heute | 203 | ||
| b) Im 17. und 18. Jahrhundert | 204 | ||
| 2. Das Gesandtschaftsrecht der Gliedstaaten des Reiches | 206 | ||
| a) Grundsatz | 206 | ||
| b) Einzelregelung | 209 | ||
| aa) Auswahl und Ernennung des Gesandten | 209 | ||
| bb) Die Instruktion | 210 | ||
| cc) Das Creditiv | 210 | ||
| dd) Die Annahme von Gesandten | 211 | ||
| ee) Die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen | 211 | ||
| ff) Das Ende der diplomatischen Mission | 215 | ||
| c) Der Umfang der diplomatischen Beziehungen der Gliedstaaten des Reiches in der Praxis | 215 | ||
| III. Kapitel: Das Kriegsverhütungsrecht im Heiligen Römischen Reich | 219 | ||
| A. Allgemeines | 219 | ||
| 1. Die friedliche Erledigung von Streitfällen | 221 | ||
| a) Streitigkeiten zwischen den Gliedstaaten des Reiches | 221 | ||
| b) Diplomatische Streiterledigungsmittel | 223 | ||
| aa) Verhandlungen | 223 | ||
| bb) Vermittlung und Gute Dienste | 224 | ||
| c) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit | 225 | ||
| aa) Begriff und Wesen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit | 225 | ||
| bb) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit im Heiligen Römischen Reich | 227 | ||
| (1) Schiedsgerichtsbarkeit auf Grund von sog. „Compromissen“ | 227 | ||
| (2) Die Austräge | 231 | ||
| (a) Die Entwicklung der Austräge | 231 | ||
| (b) Die Regelung der Austräge in der RKGO | 232 | ||
| (c) Wandel in der Bedeutung der Austräge | 234 | ||
| (d) Bewertung | 238 | ||
| (e) Subsidiarität der Legalausträge gegenüber den Conventionalausträgen | 239 | ||
| (f) Beachtung der Austräge in der Praxis | 240 | ||
| d) Internationale Gerichtsbarkeit | 241 | ||
| aa) Begriff und Wesen | 241 | ||
| bb) Internationale Gerichtsbarkeit im Heiligen Römischen Reich | 242 | ||
| (1) Das Reichskammergericht | 242 | ||
| (a) Entstehung | 242 | ||
| (b) Verfassung | 243 | ||
| (c) Zuständigkeit | 248 | ||
| (d) Entscheidungsnormen | 249 | ||
| (e) Das Verfahren | 250 | ||
| (f) Rechtsmittel | 251 | ||
| (2) Der Reichshofrat | 252 | ||
| (3) Ergebnis | 253 | ||
| 2. Das Gewaltverbot im Heiligen Römischen Reich | 254 | ||
| a) Entwicklung | 254 | ||
| aa) Das Faustrecht | 254 | ||
| bb) Der Ewige Landfrieden | 254 | ||
| cc) Bestätigungen des Ewigen Landfriedens | 255 | ||
| dd) Erneuerung des Ewigen Landfriedens | 255 | ||
| ee) Die Exekutionsordnung | 256 | ||
| b) Das Gewaltverbot nach dem Westfälischen Frieden | 257 | ||
| aa) Das grundsätzliche Kriegsführungsrecht der Gliedstaaten des Reiches | 257 | ||
| bb) Fortgeltung des Gewaltverbotes des Ewigen Landfriedens | 257 | ||
| cc) Die Problematik des Gewaltverbotes zwischen den Gliedstaaten des Reiches im Hinblick auf das freie Bündnisrecht mit außerdeutschen Staaten | 258 | ||
| c) Die Wirkung des Gewaltverbotes in der Praxis | 259 | ||
| IV. Kapitel: Die Durchsetzung des Völkerrechtes im Heiligen Römischen Reich | 260 | ||
| A. Allgemeines | 260 | ||
| 1. Individuelle Durchsetzungsmittel | 261 | ||
| a) Die Retorsion | 261 | ||
| b) Die Repressalie | 262 | ||
| c) Der Krieg | 265 | ||
| 2. Kollektive, institutionelle Durchsetzungsmittel | 265 | ||
| a) Durchsetzung der Urteile der Reichsgerichte und Durchsetzung des Landfriedens | 265 | ||
| b) Die Regelung in Art. XVII § 6 IPO | 270 | ||
| V. Kapitel: Der Reichstag als Beispiel eines Organs einer internationalen Gemeinschaft. Vergleich mit den Vereinten Nationen | 271 | ||
| A. Sinn und Aufgabe dieses Vergleiches | 271 | ||
| 1. Enstehung | 272 | ||
| a) Die Vereinten Nationen | 272 | ||
| b) Der Reichstag | 272 | ||
| 2. Zusammensetzung | 274 | ||
| a) Die Mitgliedschaft | 274 | ||
| aa) Rechtsgrund und Subjekt | 274 | ||
| (1) Die Vereinten Nationen | 274 | ||
| (2) Der Reichstag | 275 | ||
| bb) Inhalt der Mitgliedschaftsrechte | 280 | ||
| (1) Die Vereinten Nationen | 280 | ||
| (2) Der Reichstag | 281 | ||
| cc) Mitgliedschaftspflichten aus der Reichsstandschaft | 283 | ||
| b) Die Bevollmächtigten | 283 | ||
| Schlußwort | 301 | ||
| Literaturverzeichnis | 305 | ||
| Personenregister | 316 | ||
| Sachregister | 320 |
