Die Erforschung des Sachverhalts im Prozeß
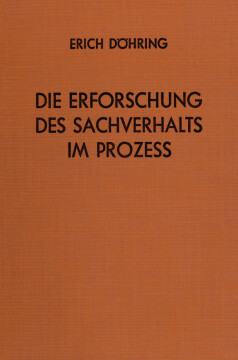
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Erforschung des Sachverhalts im Prozeß
Beweiserhebung und Beweiswürdigung. Ein Lehrbuch
(1964)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | VII | ||
| Inhalt | IX | ||
| Abkürzungen | XXV | ||
| Erster Teil | 1 | ||
| Erstes Kapitel: Grundlegung | 1 | ||
| Die Stellung der Wahrheitsforschung innerhalb der Rechtspflege | 1 | ||
| Allgemeine Bedeutung der Tatsachenforschung | 1 | ||
| Mittel zur Ausbildung auf diesem Gebiet | 2 | ||
| Hindernisse für die wissenschaftliche Bearbeitung | 4 | ||
| Sinn der aufzustellenden Grundsätze und Richtlinien | 4 | ||
| Die Bedeutung der materiellen Wahrheit für das Prozeßverfahren | 6 | ||
| Ausklammerung der erkenntnistheoretischen Bedenken | 6 | ||
| Verstärktes Streben nach Erfassung der ganzen Wahrheit | 6 | ||
| Gründe für diese Tendenz | 7 | ||
| Abbau prozessualer Schranken für die Wahrheitsfindung | 8 | ||
| Wahrheitsforschung im Zivilprozeß | 9 | ||
| Neigung zu kritischer Betrachtung | 10 | ||
| Ständige Vervollkommnung der Arbeitsmethoden | 10 | ||
| Die Tatsachenfeststellung als Teil der Rechtsfindung | 12 | ||
| Zweck der Beweisbemühungen | 12 | ||
| Der Gegenstand der Beweisarbeit | 13 | ||
| Zusammenhang zwischen Beweistätigkeit und juristischer Erwägung | 13 | ||
| Zeitliches Verhältnis zwischen Tatsachenermittlung und rechtlicher Durchdenkung | 14 | ||
| Phasen des Beweisvorgangs | 15 | ||
| Aufgabe der Beweissammlung | 15 | ||
| Zeitliche Aufeinanderfolge von Beweissammlung und Beweiswürdigung | 16 | ||
| Beweis im Anfangsstadium | 17 | ||
| Eigenart der vorläufigen Beweiswürdigung | 18 | ||
| Notwendigkeit wiederholter Prüfung der Beweislage | 18 | ||
| Beweismittel | 19 | ||
| Allgemeine Übersicht | 19 | ||
| Personal- und Sachbeweis | 20 | ||
| Direkter und indirekter Beweis | 20 | ||
| Merkmale des Personalbeweises | 20 | ||
| Praktische Bedeutung des Personalbeweises | 21 | ||
| Zweites Kapitel: Allgemeine Grundsätze für den Personalbeweis | 23 | ||
| Vorfragen | 23 | ||
| Wer vernimmt die Aussageperson? | 23 | ||
| Haupteigenschaften eines guten Vernehmungsleiters | 23 | ||
| Selbsterkenntnis des Vernehmenden | 24 | ||
| Erschwerungen für die Erkenntnis eigner Schwächen | 25 | ||
| Vorausschau auf den Hergang der Vernehmung | 26 | ||
| Die Vernehmung als Gemeinschaftsleistung | 27 | ||
| Kontaktnahme | 28 | ||
| Ihre Bedeutung für das Zustandekommen einer guten Aussageleistung | 28 | ||
| Hindernisse für einen befriedigenden Kontakt | 29 | ||
| Erhaltung einer guten Arbeitsatmosphäre im weiteren Verlauf der Vernehmung | 30 | ||
| Vorbereitung der Beweisperson auf ihre Aufgabe | 30 | ||
| Beseitigung von gedanklichen Hindernissen | 30 | ||
| Einweisung des Aussagenden in seine Aufgabe | 31 | ||
| Darstellung im Zusammenhang | 32 | ||
| Tatsachenannahmen als Mittel der Wahrheitsforschung | 34 | ||
| Ordnung des Materials | 34 | ||
| Erarbeiten des Gesamtbildes | 34 | ||
| Hypothesenbildung im Zivilprozeß | 35 | ||
| Die Tatsachenannahme als Wegweiser | 35 | ||
| Erschwerte Hypothesenbildung im Anfangsstadium | 35 | ||
| Schnelles Herausfinden der zutreffenden Deutung | 36 | ||
| Das Risiko beim Umgang mit Tatsachenannahmen | 36 | ||
| Zusammenfassung | 37 | ||
| Kritische Haltung gegenüber der Arbeitshypothese | 37 | ||
| Richtige Auffassung des Inhalts der Bekundungen | 39 | ||
| Mißverständliche Ausdrucksweise der Beweisperson | 39 | ||
| Stillschweigende Voraussetzungen, mit denen einer der Gesprächspartner nicht rechnet | 39 | ||
| Aufforderung zu ergänzenden Darlegungen | 40 | ||
| Aufspüren von Unstimmigkeiten im allgemeinen | 40 | ||
| Schwer erkennbare Diskrepanzen | 40 | ||
| Widerspruch zum Erfahrungswissen | 41 | ||
| Prüfung der Unstimmigkeit | 41 | ||
| Maßnahmen zur Lösung des Widerspruchs | 42 | ||
| Mitteilungen an den Aussagenden über die besondere Prozeßsituation | 43 | ||
| Das Problem | 43 | ||
| Einzelgesichtspunkte | 43 | ||
| Günstige Wirkung sparsamer Angaben über die Prozeßlage | 44 | ||
| Hinweise auf die rechtliche Bewertung bestimmter Angaben | 45 | ||
| Nachträgliche Informierung des Aussagenden | 45 | ||
| Besonderheiten in gewissen Verfahrensarten | 46 | ||
| Sofortige Mitteilung von Gegenargumenten | 46 | ||
| Verschiedene Möglichkeiten des Vorgehens | 46 | ||
| Auswahl der richtigen Verhaltensweise | 47 | ||
| Korrektes Verfahren bei Vorenthaltung von Belastungsmomenten | 47 | ||
| Methodenverbindung | 48 | ||
| Fragetaktik | 48 | ||
| Reihenfolge der Erörterung | 48 | ||
| Der Zeitpunkt der Fragestellung | 50 | ||
| Sachgemäße Vorbereitung der Erkundigung | 50 | ||
| Eindeutigkeit der Frage | 50 | ||
| Geradezu gerichtete Fragen | 51 | ||
| Sachaufklärung durch Situationsfragen | 52 | ||
| Allgemeines | 52 | ||
| Die Wirkungsweise von Situationsfragen | 52 | ||
| Rücksichtnahme auf die psychische Eigenart des Aussagenden | 53 | ||
| Die Suggestivfrage | 54 | ||
| Die mit ihr verbundene Gefahr | 54 | ||
| Inwieweit sind Suggestivfragen zulässig? | 55 | ||
| Wahl der richtigen Formulierung | 56 | ||
| Suggestion durch die Umstände | 57 | ||
| Unschädlichkeit von Suggestivfragen in bestimmten Fällen | 57 | ||
| Protokollierung suggestiver Vorhalte | 58 | ||
| Die Notwendigkeit, das Gespräch in Gang zu halten | 58 | ||
| Überwindung des toten Punkts | 59 | ||
| Mehrfache Wiederholung der gleichen Frage? | 59 | ||
| Gründliche Erörterung des Sachverhalts | 59 | ||
| Hinwirken auf eine spontane Darstellung | 60 | ||
| Pflicht zu schonendem Vorgehen | 61 | ||
| Überlegenheit, die sich unauffällig durchsetzt | 61 | ||
| Fälle, in denen milde Mittel allein nicht verfangen | 62 | ||
| Beachtung der persönlichen Eigenheiten des Vernommenen | 62 | ||
| Begrenzte Bedeutung der hier gegebenen Richtlinien | 62 | ||
| Angemessenes Verhalten gegenüber den verschiedenen Charaktertypen | 62 | ||
| Sichabfinden mit den Unzulänglichkeiten des Aussagenden | 63 | ||
| Änderung der bisherigen Art des Vorgehens | 63 | ||
| Überprüfung der Aussage mit Hilfe der Erfahrung | 64 | ||
| Intensive Befragung ohne Gewaltsamkeit | 65 | ||
| Allgemeine Gesichtspunkte | 65 | ||
| Beispiel aus der Praxis | 65 | ||
| Verläßlichkeitsanzeichen aus der äußeren Erscheinung des Aussagenden | 67 | ||
| Ihre allgemeine Bedeutung | 67 | ||
| Schlußfolgerungen aus der Physiognomie | 69 | ||
| Mienen und Gesten | 69 | ||
| Kontrast zur bisherigen Aufführung | 70 | ||
| Doppeldeutigkeit vieler Zeichen im äußeren Gebaren | 70 | ||
| Analyse der zum persönlichen Eindruck gehörenden Elemente | 71 | ||
| Zeichen der Resignation beim Beschuldigten | 71 | ||
| Freimütiges Auftreten | 72 | ||
| Das Lächeln | 73 | ||
| Fälschung der Verläßlichkeitsindizien durch den Aussagenden | 73 | ||
| Intensives Forschen nach weiteren Anhaltspunkten | 74 | ||
| Systematische Erprobung der Auskunftsperson | 74 | ||
| Begrenzter Wert der im persönlichen Eindruck enthaltenen Beweiselemente | 75 | ||
| Persönlichkeitsforschung | 76 | ||
| Ihre zunehmende Wichtigkeit | 76 | ||
| Notwendigkeit der Persönlichkeitsanalyse beim Beschuldigten | 76 | ||
| Persönlichkeitsforschung | 77 | ||
| a) beim Beweis der Täterschaft | 77 | ||
| b) beim Nachweis psychischer Tatsachen | 77 | ||
| c) bei Klarstellung des Beweggrundes zur Tat | 78 | ||
| d) in sonstigen Fällen | 78 | ||
| Erforschung der Zeugenpersönlichkeit | 79 | ||
| Grundsätze für die außerstrafrechtlichen Verfahrensarten | 80 | ||
| Zeitlicher Umfang der Ermittlungen | 80 | ||
| Hergang der Persönlichkeitsforschung im einzelnen | 81 | ||
| Ermittlung der geistigen Gesamtstruktur | 81 | ||
| Typische Wesensmerkmale eines Volksteils als Hilfsmittel der Persönlichkeitsforschung | 82 | ||
| Gesichtspunkte für die Vernehmung jugendlicher Zeugen | 83 | ||
| Allgemeines | 83 | ||
| Befragung ohne schroffes Auftreten | 83 | ||
| Kindgemäße Sprache? | 84 | ||
| Aufspüren der kindlichen Denkweise | 84 | ||
| Eingehende Befragung | 84 | ||
| Überwindung von Hindernissen für eine wahrheitsgemäße Darstellung | 85 | ||
| Berücksichtigung der Entwicklungsphase, in der sich das Kind befindet | 85 | ||
| Welcher Beweiswert darf den Bekundungen eines Kindes beigemessen werden? | 85 | ||
| Bekundungen kindlicher Gruppenzeugen und ihre Bewertung | 87 | ||
| Schriftliche Niederlegung der Aussage | 87 | ||
| Große Verantwortung des Wahrheitsforschers in dieser Hinsicht | 87 | ||
| Vorsicht bei der Harmonisierung von Unstimmigkeiten | 88 | ||
| Die Wiedergabe der Bekundungen im einzelnen | 88 | ||
| Kraftausdrücke des Aussagenden | 89 | ||
| Kenntlichmachung der Glaubwürdigkeitsindizien | 89 | ||
| Kasuistik | 89 | ||
| Niederschrift von Frage und Antwort | 90 | ||
| Der persönliche Eindruck der Aussageperson als Bestandteil des Protokolls | 90 | ||
| Protokollierung als Schutz gegen taktische Manöver des Aussagenden | 91 | ||
| Drittes Kapitel: Die Zeugenvernehmung | 92 | ||
| Allgemeines | 92 | ||
| Gesunde Skepsis gegenüber der Darstellung des Zeugen | 92 | ||
| Der moderne Zeuge als Eideshelfer | 93 | ||
| Gewissenhafte Prüfung auch bei redlichen Zeugen | 93 | ||
| Kritische Haltung gegenüber Vielwissern | 94 | ||
| Wachsamkeit auch bei scheinbar geringfügigen Anlässen | 95 | ||
| Wahrnehmung | 95 | ||
| Plan der Darstellung | 95 | ||
| Beobachtungsfähigkeit | 96 | ||
| Wahrnehmungsbedingungen | 96 | ||
| Schnelligkeit des Ablaufs, abgelenkte Aufmerksamkeit | 97 | ||
| Hochgradige Aufregung | 98 | ||
| Übermüdung, seelische Belastungen | 99 | ||
| Schmerzeinwirkung | 99 | ||
| Alkoholeinfluß | 99 | ||
| Erinnerung | 100 | ||
| Umstände, die die Reproduktionsfähigkeit fördern bzw. erschweren | 100 | ||
| Erinnerungsmöglichkeit bei häufig wiederholten Vernehmungen | 101 | ||
| Weit zurückliegende Vorgänge | 101 | ||
| Gedächtnisbrücken | 102 | ||
| Eidetische Veranlagung | 102 | ||
| Nachträgliche Erinnerung | 103 | ||
| Kopfverletzungen | 103 | ||
| Teilvertauschungen | 104 | ||
| Irrtum hinsichtlich der Aufeinanderfolge | 105 | ||
| Verarbeitung der Wahrnehmungen durch den Zeugen | 105 | ||
| Ihre funktionelle Bedeutung | 105 | ||
| Etappen der Verarbeitung | 105 | ||
| Kritische Betrachtung der vom Zeugen dabei erbrachten Leistung | 107 | ||
| Ermittlung des Fundaments der Zeugenaussage | 109 | ||
| Besonderheiten der Vernehmung in bestimmten Einzelfällen | 109 | ||
| Angaben über fremdpsychische Tatsachen | 109 | ||
| Erhöhte Feststellungsschwierigkeiten | 109 | ||
| Fehlen greifbarer Anhaltspunkte | 109 | ||
| Richtlinien für die Würdigung | 110 | ||
| Kasuistik | 110 | ||
| Bekundungen über eigenpsychische Tatsachen | 111 | ||
| Einzelfälle dieser Art | 111 | ||
| Tendenz des Zeugen zur Verschönerung | 111 | ||
| Äußerungen über eigene Beweggründe | 112 | ||
| Werturteile des Zeugen | 112 | ||
| In welchem Umfang sind Beurteilungen des Zeugen zulässig? | 113 | ||
| Analyse von Zeugenbeurteilungen | 114 | ||
| Prüfung von Zeugenurteilen, wenn die Ausgangstatsachen fehlen | 116 | ||
| Aussagen über Charakter und Wesensart eines Dritten | 118 | ||
| Beurteilungsfehler | 118 | ||
| Urteile des Zeugen vom Hörensagen | 119 | ||
| Einzelfälle | 120 | ||
| Zeugnisse über Mitteilungen eines ungenannten Dritten | 121 | ||
| Der Prozeß Bullerjahn | 122 | ||
| Volle Ausnutzung der Prüfungsmöglichkeiten | 123 | ||
| Schlußfolgerungen im engeren Sinn | 124 | ||
| Gedankliche Rekonstruktion des Sachverhalts durch den Zeugen | 124 | ||
| Der Wert von Schlußfolgerungen des Zeugen | 125 | ||
| Sonderung von Tatsachenangaben und Schlußfolgerungen | 125 | ||
| Schlüsse, die als Tatsachenangaben frisiert sind | 126 | ||
| Klarstellung versteckter Schlußfolgerungen | 126 | ||
| Angaben des Zeugen über den Sinn einer Äußerung | 127 | ||
| Kann die Meinung der Beweisperson über die Bedeutung bestimmter Redensarten zur Klärung beitragen? | 127 | ||
| Wiedergabe bestimmter Stellen aus einer Rede | 127 | ||
| Zusammenfassender Bericht des Zeugen über längere Besprechungen | 128 | ||
| Widerspruchsvoller Inhalt von Parteiverhandlungen | 128 | ||
| Einzelgesichtspunkte für die Beweiswürdigung | 129 | ||
| Hypothetische Stellungnahmen des Zeugen | 130 | ||
| Ihre Eigenart und mannigfache Gestalt | 130 | ||
| Absehenmüssen des Zeugen von gegenwärtigen Kenntnissen und Einsichten | 131 | ||
| Angaben des Zeugen über seine eigenen Ziele | 132 | ||
| Beurteilung früherer Vorgänge auf Grund von nachträglich erworbenem Wissen | 132 | ||
| Ordnungsgemäße Lenkung des Aussagenden in solchen Fällen | 133 | ||
| Suggestive Beeinflussung der Beweisperson als Fehlerquelle | 134 | ||
| Entstehung von Suggestionen vor der Vernehmung | 134 | ||
| Klarstellung stattgehabter Beeinflussungen | 134 | ||
| Möglichkeiten zur Verhinderung außergerichtlicher Suggestionen | 135 | ||
| Der Wahrheitswille als Glaubwürdigkeitsindiz | 135 | ||
| Seine Bewertung in früherer Zeit | 135 | ||
| Heutige Bedeutung der Bereitschaft zur wahrheitsgemäßen Aussage | 136 | ||
| Der Wahrheitswille als richtungweisendes Moment in besonderen Fällen | 137 | ||
| Typische Formen einer fehlerhaften allgemeinen Einstellung des Zeugen | 137 | ||
| a) Ideelle Befangenheit | 137 | ||
| Bedeutung weltanschaulicher und politischer Ansichten der Beweisperson | 138 | ||
| Große Durchschlagskraft einer einseitigen Grundhaltung | 139 | ||
| Aufdeckung versteckter Befangenheit | 139 | ||
| Voreilige Ansichten des Zeugen über den vermutlichen Hergang | 140 | ||
| Allgemeiner Verfolgungseifer der Bevölkerung | 140 | ||
| Die Ansicht der Auskunftsperson über den Stand des Beweisverfahrens | 141 | ||
| Anpassungsbedürfnis des Zeugen | 141 | ||
| b) Gruppengeist | 142 | ||
| Personengruppen ohne organisatorische Grundlage | 142 | ||
| Die Dorfgemeinschaft als Gruppe | 143 | ||
| c) Allgemeine Nützlichkeitserwägungen des Zeugen | 143 | ||
| Vernehmung von Zeugen mit einseitiger Grundhaltung | 144 | ||
| Kampf gegen eine verkehrte Einstellung der Beweisperson | 145 | ||
| Nachdrückliche Hinweise | 145 | ||
| Bewußtmachen der Voreingenommenheit | 146 | ||
| Notwendigkeit von Geduld und Ausdauer | 146 | ||
| Verhalten bei sehr starken Vorurteilen des Zeugen | 146 | ||
| Rücksicht auf die Besonderheiten des Falles | 147 | ||
| Bewertung von Bekundungen befangener Zeugen | 147 | ||
| Wert oder Unwert solcher Aussagen | 147 | ||
| Momente, die für die Glaubwürdigkeit sprechen | 148 | ||
| Geringe Handhaben zur Nachprüfung | 148 | ||
| Neigung des Zeugen zur Wahrnehmung seiner eigenen Belange | 149 | ||
| Umfang des wahrheitswidrigen Einflusses | 150 | ||
| Beweiswürdigung bei einzelnen Kategorien von Auskunftspersonen | 150 | ||
| 1. Polizeibeamte als Zeugen | 150 | ||
| 2. Der Verletzte als Beweisperson | 151 | ||
| Gründe für seine etwaige Befangenheit | 151 | ||
| Haltung des Geschädigten bei schweren Schicksalsschlägen | 151 | ||
| Vortäuschen einer Straftat durch den „Verletzten“ | 151 | ||
| 3. Angaben eines Mitbeschuldigten | 152 | ||
| Der zu Strafe Verurteilte als Auskunftsperson | 152 | ||
| Der rechtskräftig Freigesprochene als Zeuge | 153 | ||
| Belastende Angaben eines Beschuldigten über den in das gleiche Verfahren verwickelten Mitbeschuldigten | 153 | ||
| Belastung eines Verdächtigen durch den zwar noch nicht abgeurteilten, aber voll geständigen Tatbeteiligten | 154 | ||
| Große Bedeutung von Angaben Mitbeschuldigter in bestimmten Fällen | 154 | ||
| Zusammenfassung | 155 | ||
| Bewertung von Aussagen, die in einem Punkt erweislich unrichtig sind | 155 | ||
| Fragwürdigkeit der älteren Auffassung darüber | 175 | ||
| Nachwirkungen des früheren Standpunkts in der Gegenwart | 156 | ||
| Feststellung, wie die Unrichtigkeit zustande gekommen ist | 156 | ||
| Eingrenzen der Fehlerursache | 157 | ||
| Unrichtigkeiten bezüglich eines Nebenumstands | 157 | ||
| Verständliche Ursachen für kleinere Fehlleistungen | 158 | ||
| Strenge Bewertung in besonderen Fällen | 159 | ||
| Mehrfache Unrichtigkeiten | 160 | ||
| Bewußt falsche Angaben | 160 | ||
| Zusammenfassung | 161 | ||
| Beweiswürdigung bei wechselnden Angaben des Zeugen | 162 | ||
| Mögliche Ursachen für eine Aussageänderung | 162 | ||
| Welche der verschiedenen Darstellungen ist die zutreffende? | 163 | ||
| Der Zeuge gibt zu, gelogen zu haben und verspricht, nunmehr die Wahrheit zu sagen | 164 | ||
| Übereinstimmung und Gegensätzlichkeit in den Aussagen verschiedener Zeugen | 165 | ||
| Das Problem | 165 | ||
| Notwendigkeit einer theoretischen Durchdenkung | 166 | ||
| Vorteile, die das Vorhandensein mehrerer Zeugen bietet | 166 | ||
| Übereinstimmung mehrerer Aussagen als Indiz für deren Richtigkeit? | 167 | ||
| Milieubedingte Gleichförmigkeit der Bekundungen | 167 | ||
| Wachsamkeit, die den Umständen angemessen ist | 168 | ||
| Würdigung widersprechender Angaben im allgemeinen | 168 | ||
| Leicht auflösbare Disharmonien | 168 | ||
| Harmonisierung der Abweichungen nur in gewissen Grenzen | 169 | ||
| Vorgehen, wenn die Differenzen nicht sogleich zu beheben sind | 170 | ||
| Wertung sich widersprechender Aussagen, wenn der Einfluß von Gruppengeist in Betracht kommt | 170 | ||
| Isolierte Zeugen | 171 | ||
| Zusammentreffen von Aussagefehlern verschiedener Art | 172 | ||
| Zusammensetzen von Teilergebnissen | 172 | ||
| Vergleich der Zeugenaussage mit Augenscheinsergebnissen, Urkunden usw. | 173 | ||
| Viertes Kapitel: Die Befragung des Beschuldigten | 174 | ||
| Haltung des Vernehmenden | 174 | ||
| Unechtes Überlegenheitsgefühl | 174 | ||
| Innerer Widerwille gegenüber der Verhörsperson? | 174 | ||
| Menschliches Interesse | 175 | ||
| Distanzierung vom Beschuldigten | 175 | ||
| Joviales Gebaren | 176 | ||
| Zielbewußtes Verhalten | 176 | ||
| Verbot unwürdiger Behandlung | 176 | ||
| Autoritäres Auftreten | 177 | ||
| Innere Sicherheit | 177 | ||
| Benehmen gegenüber aufsässigen Beschuldigten | 178 | ||
| Das Recht des Beschuldigten zu schweigen | 178 | ||
| Keine Pflicht zur Mitwirkung bei der Aufklärung | 178 | ||
| Die angloamerikanische Auffassung im Vergleich zur kontinentalen | 179 | ||
| Verweigerte Mitarbeit als Schuldindiz im Strafverfahren | 180 | ||
| Schweigen der Partei im Zivilprozeß und vor den Verwaltungsgerichten | 180 | ||
| Auswertung dieses Beweisanzeichens im einzelnen | 181 | ||
| Freiwillige Mitarbeit des Beschuldigten bei der Sachaufklärung | 181 | ||
| Allgemeines | 181 | ||
| Anregung des Verdächtigen zur Mitarbeit | 182 | ||
| Das Ziel der Vernehmung | 183 | ||
| Doppelte Zweckbestimmung | 183 | ||
| Herbeischaffung von Verteidigungsmaterial | 183 | ||
| Besondere Obacht auf entlastende Tatsachen | 184 | ||
| Spezielle Haltung des Verhörsleiters | 185 | ||
| Gute Arbeitsatmosphäre | 185 | ||
| Kritische Einstellung | 185 | ||
| Individuelle Behandlung | 185 | ||
| Geistige Auseinandersetzung zwischen den Gesprächspartnern | 185 | ||
| Selbstbeherrschung des Vernehmenden | 186 | ||
| Ständige Beobachtung des Beschuldigten | 186 | ||
| Allzu starkes Erfolgsstreben des Verhörsleiters als Hindernis | 187 | ||
| Sofortige Auswertung des Materials | 188 | ||
| Haushalten des Vernehmenden mit seiner Kraft | 188 | ||
| Formen der Gegenwehr des Beschuldigten | 189 | ||
| Hochfahrendes Benehmen | 189 | ||
| Gespielte Entrüstung | 189 | ||
| Ausweichtaktik des Vernommenen | 190 | ||
| Offene Widersetzlichkeit | 190 | ||
| Unvoreingenommenheit auch gegenüber schwierigen Verhörspersonen | 191 | ||
| Starrsinn, Verstocktheit, Trotz | 191 | ||
| Wert der gesammelten taktischen Erfahrungen für spätere Fälle | 192 | ||
| Förderung der Geständnisbereitschaft | 193 | ||
| Darf der Vernehmende auf ein Geständnis hinwirken? | 193 | ||
| Fragwürdiges Hinarbeiten auf Geständniserklärungen | 193 | ||
| Nutzen des Geständnisses für die Wahrheitsforschung | 194 | ||
| Indirekte Methode der Geständnisförderung | 194 | ||
| Mitteilungsbedürfnis des Täters | 195 | ||
| Benutzung affektiver Regungen | 195 | ||
| Wirkung bestimmter Ehrauffassungen | 196 | ||
| Streben des Beschuldigten nach Anerkennung | 196 | ||
| Direkte Methode | 196 | ||
| Bedeutung der psychischen Zwangslage | 197 | ||
| Unzulässige Vernehmungsmethoden | 199 | ||
| Allgemeine Gesichtspunkte | 199 | ||
| Gesetzliche Verbote | 199 | ||
| Starke Versuchung zu Pflichtwidrigkeiten dieser Art | 200 | ||
| Abgrenzung zwischen erlaubten und unerlaubten Mitteln | 202 | ||
| Die verbotenen Maßnahmen und Behelfe im einzelnen | 202 | ||
| 1. Körperliche Mißhandlung | 203 | ||
| 2. Täuschung | 203 | ||
| Rechtschaffene Grundhaltung des Vernehmenden | 203 | ||
| Argumente gegen die Zulässigkeit von Täuschungshandlungen | 204 | ||
| Ausnutzung eines bereits vorhandenen Irrtums | 205 | ||
| Täuschungshandlungen außerhalb der Vernehmung | 205 | ||
| Nicht zu beanstandende Überlistung | 205 | ||
| 3. Drohung (Warnung, Belehrung) | 206 | ||
| Begriffliche Grundlagen | 206 | ||
| Korrektes Vorgehen beim Hinweis auf zu erwartende Nachteile | 207 | ||
| Hinweis auf die bevorstehende Verhaftung | 208 | ||
| Beurteilung, ob der Beschuldigte korrekt vernommen worden ist | 208 | ||
| Abstellen auf die individuelle Eigenart des Beschuldigten | 209 | ||
| 4. Ermüdung | 209 | ||
| Einführung in die Problematik | 209 | ||
| Maßgebende Gesichtspunkte | 210 | ||
| Beweisschwierigkeiten | 211 | ||
| Erschöpfung bereits zu Beginn der Vernehmung | 212 | ||
| Nächtliche Verhöre | 213 | ||
| 5. Versprechen und Gewähren von Vergünstigungen | 213 | ||
| Gesetzliche Regelung | 213 | ||
| Ursächlicher Zusammenhang zwischen Versprechen und Aussage | 214 | ||
| Versprechungen, deren Erfüllung der Vernehmende nicht völlig in der Hand hat | 214 | ||
| Erfüllung von Zusagen | 215 | ||
| 6. Quälerei | 216 | ||
| 7. Chemische Mittel | 217 | ||
| Haltung der Gesetzgebung und der Rechtsprechung | 217 | ||
| Unsichere Würdigung der unter dem Einfluß von Medikamenten gemachten Aussagen | 218 | ||
| Anhaltspunkte für die Bewertung | 218 | ||
| 8. Lügendetektor | 219 | ||
| Hergang des Geständnisses | 220 | ||
| Erste Anzeichen der Geständnisbereitschaft | 220 | ||
| Verhalten des Vernehmenden | 221 | ||
| Feststellung des Geständnisinhalts | 221 | ||
| Notwendigkeit einer Prüfung des Geständnisses | 222 | ||
| Erfragen der konkreten Tatumstände | 223 | ||
| Sicherung des Geständnisses gegen Widerruf | 224 | ||
| Vorgehen beim Widerruf des Geständnisses | 225 | ||
| Haltung des Vernehmenden | 225 | ||
| Ermittlung, auf welcher Grundlage der Widerruf beruht | 225 | ||
| Mehrfacher Wechsel zwischen Geständnis und Widerruf | 226 | ||
| Aufklärungswert der von der Prozeßpartei gemachten Angaben | 227 | ||
| Verschiedene Arten von Stellungnahmen | 227 | ||
| Bedeutung der Regel „in dubio pro reo“ | 227 | ||
| Vergleich des Werts von Beschuldigtenangaben und von Zeugenaussagen | 228 | ||
| Einfluß der Parteilichkeit des Beschuldigten auf die Bewertung seiner Angaben | 229 | ||
| Umstände, die den Angaben des Beschuldigten Glaubhaftigkeit verschaffen können | 230 | ||
| Zivil-, Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtssachen | 231 | ||
| Würdigung von Schutzbehauptungen des Beschuldigten | 232 | ||
| Notwendigkeit ihrer vorurteilslosen Bewertung | 232 | ||
| Kasuistik | 233 | ||
| Bewertung von Widersprüchen | 235 | ||
| Mögliche Ursachen für widersprüchliches Vorbringen | 235 | ||
| Widersprüchliche Sachdarstellung auf Grund prozeßtaktischer Erwägungen | 236 | ||
| Andere Prozeßarten | 237 | ||
| Unrichtige Angaben des Beschuldigten als Schuldindiz | 237 | ||
| Schwäche und Stärke dieses Beweisanzeichens | 237 | ||
| Spezielle Lagen | 238 | ||
| Allgemeine Richtlinie | 239 | ||
| Zivilprozeß | 239 | ||
| Unzulängliche Verteidigung des Beschuldigten als Belastungsmoment | 240 | ||
| Eigenart dieses Beweisanzeichens | 240 | ||
| Voraussetzungen für die Brauchbarkeit des Arguments | 240 | ||
| Besonderheiten bei Darlegung des Alibi | 240 | ||
| Hinreichende Gelegenheit zu wohlüberlegten Verteidigungserklärungen | 241 | ||
| Ergebnis | 241 | ||
| Ungenügende Rechtfertigung außerhalb des Strafverfahrens | 242 | ||
| Würdigung von einräumenden Erklärungen | 242 | ||
| Mögliche Ursachen für ein falsches Geständnis | 242 | ||
| Geständnis infolge von Ruhmsucht | 243 | ||
| Taktische Erwägungen des Beschuldigten | 243 | ||
| Kombination von uneigennützigen und selbstsüchtigen Beweggründen | 244 | ||
| Falsches Geständnis auf Grund von Irrtum | 245 | ||
| Zu kurze Beobachtungszeit | 245 | ||
| Hochgradige Erregung | 246 | ||
| Sonstige Gründe | 246 | ||
| Irrtum des Beschuldigten über den belastenden Charakter einer zugestandenen Tatsache | 247 | ||
| Anzeichen für die Richtigkeit des Geständnisses | 248 | ||
| Konkretes Wissen des Beschuldigten, das auf seine Täterschaft hindeutet | 248 | ||
| Das Geständnismotiv als Glaubwürdigkeitsindiz | 248 | ||
| Beweggründe, die für die Richtigkeit des Geständnisses sprechen | 249 | ||
| Ermittlung des Geständnismotivs in besonderen Fällen | 249 | ||
| Verwertung von Geständnissen, die unter Druck zustande gekommen sind? | 250 | ||
| Inwieweit in solchen Fällen eine Beweiswürdigung notwendig werden kann | 250 | ||
| Gesichtspunkte für die Beurteilung | 251 | ||
| Bewertung des Geständniswiderrufs | 251 | ||
| Grundsätzliche Einstellung der Gerichte | 251 | ||
| Die Bewertungsprinzipien im einzelnen | 252 | ||
| Würdigung des Widerrufs im Gesamtzusammenhang | 253 | ||
| Klärung des Motivs für den Widerruf | 254 | ||
| Fünftes Kapitel: Die Vernehmung des Sachverständigen | 256 | ||
| Grundfragen | 256 | ||
| Aufgabe des Sachverständigen | 256 | ||
| Geltungsbereich der auf den Experten bezüglichen Grundsätze | 256 | ||
| Die Eigenart der Sachverständigentätigkeit | 257 | ||
| Herstellung günstiger Arbeitsbedingungen | 258 | ||
| Art der Befragung | 259 | ||
| Suggestivfragen | 260 | ||
| Bewertung des Sachverständigengutachtens im allgemeinen | 260 | ||
| Pflicht des Vernehmenden zur kritischen Würdigung | 260 | ||
| Eigene Meinungsbildung auch unter ungünstigen Umständen | 262 | ||
| Herzhaftes, aber gleichwohl maßvolles Vorgehen | 263 | ||
| Würdigung der Stellungnahme des Sachverständigen aus sich heraus | 263 | ||
| Ansatzpunkte für eine Kritik des Gutachtens | 264 | ||
| Anregung zu eingehenderen Darlegungen | 264 | ||
| Die Arbeitsweise des Gutachters | 264 | ||
| Einfluß der fachlichen Grundeinstellung des Sachverständigen | 264 | ||
| Bestimmtheitsgrad der gutachtlichen Äußerungen | 265 | ||
| Genauere Erprobung des Bestimmtheitsgrades | 265 | ||
| Kompliziertheit der dem Gutachter gestellten Aufgabe | 266 | ||
| Welche Beweiskraft hat die Stellungnahme des Gutachters im Einzelfall? | 268 | ||
| Hauptgesichtspunkte für die Bewertung | 268 | ||
| Der Bildungsgang des Sachverständigen und sein Einfluß auf die Beweiswürdigung | 268 | ||
| Prozessuales Verhalten des Sachverständigen als Indiz | 269 | ||
| Hohes berufliches Ansehen des Sachverständigen als Beweisanzeichen | 270 | ||
| Mögliche Voreingenommenheit des Gutachters | 270 | ||
| Übertriebenes Wohlwollen des Experten gegenüber einem Berufsgenossen | 270 | ||
| Private Sachverständige | 270 | ||
| Störender Einfluß der Aktenlage und der augenblicklichen Beweissituation | 271 | ||
| Voreingenommenheit des Sachverständigen auf Grund seiner früheren Stellungnahmen | 271 | ||
| Fachkundliche Einseitigkeit | 272 | ||
| Irrationale Grundlagen des Gutachtens | 272 | ||
| Beschränkung des Sachverständigen auf die zu seinem Fachgebiet gehörigen Fragen | 273 | ||
| Aufdeckung von Fragwürdigkeiten in der gutachtlichen Stellungnahme | 273 | ||
| Klärung der Beweislage, wenn zwei Experten sich widersprechen | 274 | ||
| Ernennung eines dritten Sachverständigen? | 274 | ||
| Gewissenhafte Erprobung der Differenzen | 274 | ||
| Einzelhinweise für die Würdigung von Unstimmigkeiten | 274 | ||
| Besonderheiten der Bewertung bei einzelnen Gutachtentypen | 275 | ||
| Buchführungsgutachten | 276 | ||
| Allgemeines | 276 | ||
| Lückenhafte Unterlagen | 276 | ||
| Kritik der Bilanz | 276 | ||
| Prüfung der Belege | 276 | ||
| Betrachtung des Unternehmens im ganzen | 277 | ||
| Feststellung der Schriftidentität | 277 | ||
| Auswahl des Sachverständigen | 277 | ||
| Grundvoraussetzungen | 278 | ||
| Einzelgesichtspunkte | 278 | ||
| Wertung der Schriftzüge im ganzen | 278 | ||
| Prüfung von Fingerabdrücken | 279 | ||
| Blutgruppenuntersuchung | 280 | ||
| Feststellung von Alkohol im Blut | 281 | ||
| Anthropologisch-erbbiologischer Vaterschaftsnachweis | 283 | ||
| Testpsychologische Gutachten | 285 | ||
| Begrenzter Nutzen des psychologischen Tests | 285 | ||
| Reichweite der testpsychologischen Arbeit | 286 | ||
| Notwendigkeit einer Bewertung der Ergebnisse | 286 | ||
| Nachprüfung der Sachverständigentätigkeit | 286 | ||
| Vervollständigung des durch Testversuche beschafften Beweismaterials | 287 | ||
| Zweiter Teil | 289 | ||
| Erstes Kapitel: Der Urkundenbeweis | 289 | ||
| Seine charakteristischen Besonderheiten | 289 | ||
| Stellung im System der Beweismittel | 289 | ||
| Eigenart des Urkundenbeweises im Vergleich zum Personalbeweis | 289 | ||
| Übersicht über den Gang der Erörterung | 290 | ||
| Echtheit und Unversehrtheit der Urkunde | 290 | ||
| Feststellung, wie eine echte Urkunde zustande gekommen ist | 291 | ||
| Nachträgliche Änderungen | 291 | ||
| Maßnahmen zur Klärung von Bedenken dieser Art | 292 | ||
| Das Ausstellungsdatum | 293 | ||
| Interpretation von Urkunden | 293 | ||
| Klarstellung, ob die in der Urkunde gemachten Angaben zutreffen | 294 | ||
| Einführende Hinweise | 294 | ||
| Zufalls- oder Absichtsurkunden | 295 | ||
| Briefe als Aufklärungsmaterial | 296 | ||
| Beweiswert der Korrespondenz im allgemeinen | 296 | ||
| Klärung interner Vorgänge durch den Briefwechsel | 296 | ||
| Einzelgesichtspunkte für die Bewertung von persönlicher Korrespondenz | 297 | ||
| Würdigung von Geschäftsbriefen | 298 | ||
| Vorprozeßakten | 298 | ||
| Häusliche Notizen als Beweismittel | 298 | ||
| Ihr Beweiswert im allgemeinen | 299 | ||
| Kasuistik | 299 | ||
| Behördliche Auskünfte | 301 | ||
| Ihre Stellung im Beweisrecht | 301 | ||
| Amtliche Stellungnahmen mit Beurteilungscharakter | 302 | ||
| Das der Auskunft zugrunde liegende Tatsachenmaterial | 302 | ||
| Begrenztes Blickfeld der sich äußernden Behörde | 303 | ||
| Mögliche Voreingenommenheiten | 303 | ||
| Sonstige Fehlerquellen | 304 | ||
| Buchführungsunterlagen | 304 | ||
| Verläßlichkeitsindizien | 305 | ||
| Wirkung einzelner Fehler auf die Würdigung der Buchführung im ganzen | 305 | ||
| Verdacht absichtlicher Falschbuchungen | 306 | ||
| Würdigung von Urkunden, denen Mängel anhaften | 306 | ||
| Zeugnisurkunden mit Formfehlern | 206 | ||
| Unbeglaubigte Abschriften | 307 | ||
| Nachlässigkeiten bei Herstellung der Abschrift | 307 | ||
| Nichtige Verträge als Beweishilfen | 308 | ||
| Würdigung von kommissarischen Zeugenvernehmungen | 308 | ||
| Arbeiten mit unzulänglichen Vernehmungsniederschriften | 309 | ||
| Schriftliche Aussagen, die nicht auf mündlicher Erörterung mit dem Vernehmenden beruhen | 310 | ||
| Zweites Kapitel: Die Augenscheinseinnahme | 312 | ||
| Prinzipielle Bemerkungen | 312 | ||
| Ihre Wesensmerkmale | 312 | ||
| Unterschiedliche Formen des Augenscheins | 313 | ||
| Wichtigkeit der unmittelbaren Besichtigung | 313 | ||
| Auftreten der Augenscheinseinnahme im Zusammenhang mit Beweisführungen der verschiedensten Art | 314 | ||
| Verläßlichkeit der Augenscheinsergebnisse? | 314 | ||
| Vorzüge und Nachteile des Augenscheinsbeweises | 315 | ||
| Einzelne Gefahrenpunkte | 316 | ||
| Zu enge Blickrichtung als Hindernis | 317 | ||
| Unzulängliche Verarbeitung | 317 | ||
| Unkontrollierte Schlußfolgerungen | 318 | ||
| Übermächtige Gewalt dessen, was man sieht | 318 | ||
| Allgemeine Richtlinie | 319 | ||
| Unzulänglichkeiten des besichtigten Gegenstands | 320 | ||
| Inaugenscheinnahme eines falschen Objekts | 320 | ||
| Das Augenscheinsobjekt ist nach der Tat umgestaltet worden | 320 | ||
| Mehrfache Veränderungen | 322 | ||
| Wiederholung des Vorgangs als Erforschungsmittel | 322 | ||
| Wesensmerkmale der Rekonstruktion | 322 | ||
| Nachprüfung von Verteidigungsbehauptungen | 323 | ||
| Vorteile der Rekonstruktion für die Sachaufklärung | 323 | ||
| Herstellung der Bedingungen, wie sie zur Tatzeit vorhanden waren | 324 | ||
| Sonstige Augenscheinssurrogate | 325 | ||
| Karten, Risse, graphische Darstellungen | 325 | ||
| Photos als Beweismittel | 326 | ||
| Irreführende Lichtbilder | 326 | ||
| Die Person des Photographen | 327 | ||
| Klarstellung des einem Lichtbild zukommenden Wahrheitswerts | 327 | ||
| Drittes Kapitel: Der Indizienbeweis | 329 | ||
| Allgemeine Grundlagen | 329 | ||
| Der Indizienschluß als selbständiges Beweisverfahren | 329 | ||
| Zivilprozeß | 330 | ||
| Notwendigkeit gediegener allgemeiner Grundsätze für diesen Bereich | 330 | ||
| Plan der Darstellung | 331 | ||
| Heranschaffung des Indizienmaterials | 331 | ||
| Form der Indiziensuche | 331 | ||
| Sicherung der Indizien | 332 | ||
| Mehrfache Sicherheit | 333 | ||
| Die Struktur des Indizienbeweises | 333 | ||
| Die Tatsachengrundlage als Ausgangspunkt | 333 | ||
| Der auf der Indizientatsache aufbauende Denkvorgang | 334 | ||
| Zusammenwirken der Einzelteile beim Indizienbeweis | 334 | ||
| Bemühung um ein Zustandekommen des Indizienschlusses | 334 | ||
| Herausarbeiten und Zusammenpassen der Einzelteile | 335 | ||
| Mehrfache Irrtumsmöglichkeiten | 335 | ||
| Die typische Gefahr des Indizienbeweises | 336 | ||
| Zuversichtliche Grundhaltung | 336 | ||
| Reihenfolge der Tätigkeiten | 336 | ||
| Beweisführung mit Hilfe von fragwürdigem Material | 336 | ||
| Richtlinien für das Arbeiten mit unzulänglichen Unterlagen | 337 | ||
| Die Klarstellung der Indizientatsache | 338 | ||
| Notwendigkeit ihrer Verifizierung | 338 | ||
| Der Beweis im einzelnen | 338 | ||
| Vielgliedrige Tatsachengrundlage | 339 | ||
| Die Erfahrungsregel | 339 | ||
| Allgemeine Grundlagen | 339 | ||
| Pflicht zum korrekten Arbeiten mit dem Erfahrungsstoff | 340 | ||
| Das Tatsachenfundament, auf dem der Erfahrungssatz beruht | 341 | ||
| Wichtigkeit der Ausgangserlebnisse | 341 | ||
| Zwei Kategorien von tatsächlichen Grundlagen | 341 | ||
| Ermittlung des erlebnismäßigen Unterbaus für den Erfahrungssatz | 342 | ||
| Vergleich des Tatsachenmaterials, auf dem die Erfahrungsregel beruht, mit dem zu klärenden Sachverhalt | 343 | ||
| Analoge Anwendung von Erfahrungswissen | 344 | ||
| Analogie zur Aufklärung seelischer Sachverhalte | 344 | ||
| Gesichtspunkte für die entsprechende Anwendung psychologischer Erfahrungen | 345 | ||
| Herausarbeiten eines brauchbaren Erfahrungssatzes | 346 | ||
| Inbetrachtkommen zweier gegensätzlicher Erfahrungsregeln | 346 | ||
| Zusammentreffen von Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen | 347 | ||
| Die Abstimmung des Erfahrungswissens auf die jeweilige Sachgestaltung | 348 | ||
| Notwendigkeit einer solchen Anpassung | 348 | ||
| Hergang der Angleichung an die konkrete Sachlage | 349 | ||
| Prüfung der Erfahrungsregel auf ihre Verläßlichkeit | 350 | ||
| Allgemeines | 350 | ||
| Die Zahl der Beobachtungsfälle | 351 | ||
| Künstliche Erweiterung der Erfahrungsgrundlage | 351 | ||
| Unausgeglichene Erfahrungsergebnisse | 351 | ||
| Fragwürdige Auslese des Erfahrungsstoffs | 352 | ||
| Berichtigung überholter Erfahrungen | 353 | ||
| Auseinandersetzung mit Gegenerwägungen, die das Erfahrungsergebnis in Frage stellen | 354 | ||
| Notwendigkeit eingehender Prüfung | 354 | ||
| Gegenerwägungen allgemeiner Art | 354 | ||
| Einwendungen aus der speziellen Sachlage heraus | 355 | ||
| Planmäßiges Forschen nach aktuellen Einwänden | 356 | ||
| Einseitige Einstellung des Beurteilers als Hindernis | 356 | ||
| Trügerische Sicherheit | 357 | ||
| Berücksichtigung des Atypischen | 357 | ||
| Das Problem | 357 | ||
| Atypische Gestaltung seelischer Vorgänge | 358 | ||
| Begrenzter Wert von statistisch unterbauten Erfahrungen | 361 | ||
| Die Schlußfolgerung | 362 | ||
| Feststellung, welche Sicherheit ihr innewohnt | 362 | ||
| Häufige Schwäche des Indizienschlusses | 363 | ||
| Doppelsinnige Beweisanzeichen | 364 | ||
| Beobachtung einer Vielzahl von Indizien in ihrem Zusammenwirken | 365 | ||
| Notwendigkeit einer isolierten Prüfung | 365 | ||
| Zurechtlegen der Beweisanzeichen nach sachlichen Gesichtspunkten | 365 | ||
| Die Zahl der Indizien und ihre Bedeutung für die Beweiswürdigung | 365 | ||
| Indizien, die sich gegenseitig verstärken | 366 | ||
| Beachtlicher Einfluß, den auch schwächere Indizien mitunter haben können | 367 | ||
| Harmonie zwischen den einzelnen Beweisanzeichen | 367 | ||
| Geringe Reichweite einer Mehrheit von Indizien | 368 | ||
| Beweisanzeichen aus verschiedenen Richtungen | 369 | ||
| Ineinandergreifen mehrerer Indizienschlüsse | 370 | ||
| Einzelne Indiziengruppen | 373 | ||
| Beweisanzeichen für das Vorliegen einer Straftat | 374 | ||
| Indizien für und gegen die Täterschaft | 376 | ||
| Wichtigkeit dieser Gruppe von Beweiselementen | 376 | ||
| Gegenwart am Tatort | 376 | ||
| Anwesenheit aus harmlosem Anlaß | 377 | ||
| Sichere Feststellung der Tatzeit als Voraussetzung für ein brauchbares Ergebnis | 377 | ||
| Niemand war sonst zugegen | 377 | ||
| Spezielle Hinweise auf die Anwesenheit am Ort des Geschehens | 378 | ||
| Würdigung von Anhaltspunkten dieser Art | 379 | ||
| Schlußfolgerungen auf Grund des Fingerabdrucks | 379 | ||
| Der Alibibeweis | 380 | ||
| Seine systematische Stellung | 380 | ||
| Die beim Alibibeweis notwendigen Denkoperationen | 381 | ||
| Unpräzise tatsächliche Unterlagen | 382 | ||
| Die Bekundungen von Alibizeugen und ihre Bewertung | 382 | ||
| Unvoreingenommene Beurteilung der Entlastungsmomente | 383 | ||
| Einzelgesichtspunkte für die Beweiswürdigung | 383 | ||
| Der mißglückte Alibibeweis als Schuldindiz | 384 | ||
| Besitz der Mittel zur Deliktsbegehung | 385 | ||
| Besitz von Gegenständen, die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind | 386 | ||
| Besitz der gestohlenen Sachen als Täterschaftsindiz | 387 | ||
| Kann das Stehlgut käuflich erworben worden sein? | 387 | ||
| Besitz bestimmter Geldsorten oder Geldstücke als Indiz für Diebstahlsbeteiligung | 388 | ||
| Fingierte Beweisanzeichen | 388 | ||
| Der Besitz größerer Geldbeträge als Belastungsmoment | 389 | ||
| Frühere Äußerungen des Beschuldigten als Indiz | 390 | ||
| Sonstiges Verhalten vor oder nach der Tat | 392 | ||
| Der Umstand, daß dem Beschuldigten die Tat zuzutrauen ist | 395 | ||
| Übersicht | 395 | ||
| Umwelteinflüsse | 395 | ||
| Vorleben | 396 | ||
| Frühere Strafverfahren | 397 | ||
| Strenge Erprobung des Materials | 398 | ||
| Bloßer Verdacht | 399 | ||
| Nachweis des Vorlebens durch Polizeizeugen | 400 | ||
| Begrenzter Wert des Arguments, daß dem Beschuldigten die Tat zuzutrauen oder nicht zuzutrauen ist | 400 | ||
| Feststellung, daß der Beschuldigte die zur Tatbegehung nötigen Fähigkeiten besitzt | 403 | ||
| Indizien für das Vorliegen des Kausalzusammenhangs | 404 | ||
| Beweisschwierigkeiten | 404 | ||
| Das Problem der ursächlichen Verknüpfung | 404 | ||
| Die Erfahrung als Hilfsmittel | 405 | ||
| Unmittelbare zeitliche Aufeinanderfolge | 406 | ||
| Zeitliches Auseinanderfallen der als Ursache und Wirkung in Betracht kommenden Ereignisse | 407 | ||
| Erwiesene Inkorrektheiten des Beschuldigten als Indiz für den Kausalzusammenhang | 408 | ||
| Anhaltspunkte für das Vorliegen von Fahrlässigkeit | 410 | ||
| Einführung in die Problematik | 410 | ||
| Mannigfaltigkeit der Formen, in denen fahrlässiges Verhalten auftritt | 411 | ||
| Gestaltungen der Fahrlässigkeit bei falscher Aussage | 412 | ||
| Allgemeine Kennzeichnung der Tatsachengrundlage | 413 | ||
| Beweisanzeichen für die Berechenbarkeit der eingetretenen Wirkung | 415 | ||
| Beweisanzeichen für psychische Tatsachen | 419 | ||
| Einführende Bemerkungen | 419 | ||
| Kenntnis von Tatumständen | 420 | ||
| Kannte der Täter das Alter des Mädchens? | 420 | ||
| Wußte der Beschuldigte, daß die Zustimmung seiner (volljährigen) Partnerin zur geschlechtlichen Beiwohnung fehlte? | 420 | ||
| Wußte der Beschuldigte, daß die Waren durch strafbare Handlung erlangt wurden? | 422 | ||
| Wissen um die Mängel der verkauften Sachen | 423 | ||
| Das Maß der Unterrichtung | 423 | ||
| Ermittlung der Willensrichtung des Beschuldigten | 423 | ||
| Bestechungsvorsatz | 424 | ||
| Feststellung, ob Täter- oder Gehilfenvorsatz gegeben war | 425 | ||
| Klarstellung des Tätervorsatzes im einzelnen | 427 | ||
| Verschiedene Reichweite des Vorsatzes bei einzelnen Mittätern | 427 | ||
| Aufhellung sonstiger psychischer Sachverhalte | 428 | ||
| Viertes Kapitel: Endgültige Beweiswürdigung | 429 | ||
| Allgemeines | 429 | ||
| Eigenart der abschließenden Bewertung des Beweisstoffs | 429 | ||
| Wesen der Betrachtung im Zusammenhang | 430 | ||
| Zustandekommen des Gesamtbildes | 430 | ||
| Funktion der Ganzheitsschau im Rahmen der Wahrheitsfindung | 430 | ||
| Hemmnisse bei Bildung der Gesamtansicht | 431 | ||
| Zwanglosigkeit des Sicheinfügens der Teile | 431 | ||
| Berichtigung der bisherigen Ergebnisse | 432 | ||
| Beseitigung etwaiger Bedenklichkeiten | 432 | ||
| Schrittweises Vorgehen | 433 | ||
| Beachtung aller ernst zu nehmenden Möglichkeiten | 433 | ||
| Unbeachtlichkeit allzu fernliegender Eventualitäten | 437 | ||
| Abgrenzung zwischen aktuellen und bloß theoretischen Möglichkeiten | 438 | ||
| Ausschließung zu entfernter Möglichkeiten | 439 | ||
| Das dabei zu beobachtende Verfahren | 440 | ||
| Muß mit der Täterschaft eines unbekannten Dritten gerechnet werden? | 441 | ||
| Argumente aus der Erfahrung | 443 | ||
| Ausgleich zwischen Feststellungsoptimismus und Feststellungsvorsicht | 443 | ||
| Das Beweismaß | 445 | ||
| Problemstellung | 445 | ||
| Frühere Lösungsversuche | 447 | ||
| Wahrscheinlichkeitserwägungen in den Anfangsstadien der Beweiserhebung | 448 | ||
| Abstellen auf volle Sicherheit | 448 | ||
| Mindestanforderungen | 449 | ||
| Konkretisierung der abstrakten Richtlinie | 449 | ||
| Definition der vollen Sicherheit durch die Judikatur | 450 | ||
| Beweisquantum in Strafsachen und in Zivilsachen | 450 | ||
| Einzelausführungen | 451 | ||
| Einfluß der allgemeinen Lebensanschauungen auf das Beweismaß | 452 | ||
| Modifikationen der erforderlichen Beweismenge in Krisenzeiten | 453 | ||
| Fragwürdigkeit solcher Veränderungen des Beweismaßes | 453 | ||
| Beweismaßstab bei schwierigen Sachklärungen | 455 | ||
| Notwendigkeit der vollen Sicherheit auch in solchen Fällen | 455 | ||
| Modifikation des Beweisquantums durch Gesetz oder Rechtsprechung | 456 | ||
| Typische Beweisschwierigkeiten, auf die das Gesetz keine Rücksicht nimmt | 457 | ||
| Beweiserleichterung in bestimmten Sonderfällen? | 459 | ||
| Allgemeines | 459 | ||
| Ursächlicher Zusammenhang | 459 | ||
| Negative Tatsachen | 460 | ||
| Vorausschauende Feststellungen | 462 | ||
| Überzeugung des Beurteilers | 462 | ||
| Die bei ihrer Entstehung mitwirkenden Faktoren | 462 | ||
| Hoher Wert der persönlichen Gewißheit | 463 | ||
| Allgemeine Anerkennung der inneren Stellungnahme als Kontrollmittel | 463 | ||
| Die Überzeugung als Teil des gesamten Beweisvorgangs | 464 | ||
| Form und Inhalt der Überzeugung | 465 | ||
| Die Überwindung von Zweifeln | 466 | ||
| Fälle, in denen für Zweifel kein Raum ist | 467 | ||
| Beachtlichkeit „leiser“ Zweifel | 467 | ||
| Mitwirkung des Willens bei der Überwindung von Bedenken | 467 | ||
| Begriff der vollen Überzeugung | 468 | ||
| Ungewißheit, ob volle Überzeugung vorliegt | 469 | ||
| Bindung des Beurteilers an seine endgültige Überzeugung | 469 | ||
| Das Problem | 469 | ||
| Einzelfälle | 470 | ||
| Zweckerwägungen als Grund für ein Verleugnen der Überzeugung | 471 | ||
| Kritik der subjektiven Überzeugung | 472 | ||
| Zwei Gruppen von Fehlern | 472 | ||
| Prüfungspflicht des Beurteilers | 473 | ||
| Welche Möglichkeiten zur Erprobung der inneren Gewißheit sind vorhanden? | 474 | ||
| Einzelausführungen dazu | 475 | ||
| Die Urteilsgründe als Ausweis für die stattgehabte Selbstprüfung | 475 | ||
| Widerstand gegen illegitime Einflüsse auf die Überzeugungsbildung | 476 | ||
| Bibliographie | 481 | ||
| Sachverzeichnis | 485 |
