Die Lehre vom Verkehrsgeschäft
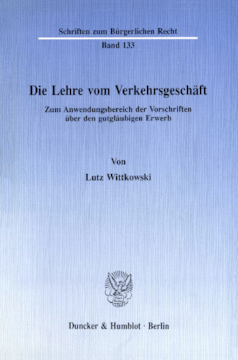
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Lehre vom Verkehrsgeschäft
Zum Anwendungsbereich der Vorschriften über den gutgläubigen Erwerb
Schriften zum Bürgerlichen Recht, Vol. 133
(1990)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| A. Einleitung und Gang der Untersuchung | 15 | ||
| B. Die Fallgruppen und der Meinungsstand | 21 | ||
| I. Die Bestellung einer Eigentümergrundschuld gemäß § 1196 Abs. 2 und ähnliche Geschäfte | 21 | ||
| II. Die Verbandsgeschäfte | 23 | ||
| 1. Terminologie | 23 | ||
| 2. Die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 23 | ||
| a) Die traditionelle Lehre vom Verkehrsgeschäft | 23 | ||
| b) Einschränkende Ansätze | 31 | ||
| c) Die Gegenansicht | 32 | ||
| III. Geschäfte zwischen Teilhabern einer Bruchteilsgemeinschaft | 32 | ||
| 1. Der Hinzuerwerb weiterer Bruchteile durch einen Teilhaber | 33 | ||
| a) Die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 34 | ||
| b) Die Gegenansicht | 34 | ||
| 2. Die Belastung des gemeinschaftlichen Gegenstandes zugunsten eines Teilhabers | 35 | ||
| a) Die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 35 | ||
| b) Die Gegenansicht | 36 | ||
| 3. Die Realteilung | 36 | ||
| a) Die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 36 | ||
| b) Die Gegenansicht | 37 | ||
| 4. Die Einräumung von Sondereigentum gemäß § 3 WEG | 37 | ||
| IV. Die Bestellung eines dinglichen Rechts für den nichtberechtigten Grundstücksveräußerer anläßlich der Veräußerung | 38 | ||
| C. Die Geschichte der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 40 | ||
| D. Die Methode der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 45 | ||
| I. Auslegung oder Rechtsfortbildung? | 45 | ||
| 1. Terminologie | 46 | ||
| 2. Die Einordnung in der Lehre | 46 | ||
| 3. Eigene Einordnung | 47 | ||
| II. Anforderungen an die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 51 | ||
| 1. Zulässigkeit der Lehre vom Verkehrsgeschäft als Rechtsfortbildung contra legem? | 51 | ||
| 2. Anforderungen an die Zulässigkeit der Lehre vom Verkehrsgeschäft als Rechtsfortbildung praeter legem | 52 | ||
| III. Ergebnis | 56 | ||
| E. Standardbegründungen der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 57 | ||
| I. Der Begriff des guten Glaubens | 59 | ||
| II. Das Fehlen der Möglichkeit einer verschiedenen Willensbildung von Veräußerer und Erwerber | 60 | ||
| III. Das Argument der “personellen Nähe” | 61 | ||
| IV. Das Selbstbeschaffungsargument | 67 | ||
| 1. Der Ausgangspunkt: Die Selbstbeschaffung fällt nicht unter § 892 | 67 | ||
| 2. Die Begründung für den Ausgangspunkt des Selbstbeschaffungsarguments | 69 | ||
| a) Der Verkehrsschutzzweck des § 892 | 69 | ||
| b) Die Entstehungsgeschichte des § 892 | 72 | ||
| c) Die Folgerung aus § 893 Alt. 2 | 75 | ||
| d) Ergebnis | 76 | ||
| F. Die Bestellung einer Eigentümergrundschuld gemäß § 1196 Abs. 2 und ähnliche Geschäfte | 78 | ||
| I. Gutgläubiger Erwerb bei der Bestellung einer Eigentümergrundschuld gemäß § 1196 Abs. 2? | 78 | ||
| 1. Die Argumente der Lehre vom Verkehrsgeschäft für die Einschränkung des § 892 | 78 | ||
| a) Die Argumentation mit dem Wortlaut | 78 | ||
| b) Das Fehlen eines Vertrages | 79 | ||
| c) Das Selbstbeschaffungsargument | 80 | ||
| 2. Die Argumente der Gegenansicht | 80 | ||
| a) Die Schutzwürdigkeit des Eigentümers | 80 | ||
| b) Der Zweck der Eigentümergrundschuld | 81 | ||
| c) Die Vereinfachung der Gesetzesanwendung | 82 | ||
| d) Die Bestellung einer Eigentümergrundschuld als unentgeltlicher Erwerb | 82 | ||
| 3. Ergebnis | 83 | ||
| II. Gutgläubiger Erwerb bei ähnlichen Geschäften? | 84 | ||
| 1. Die Bestellung anderer Eigentümerrechte als der Eigentümergrundschuld | 84 | ||
| 2. Die Teilung durch den Eigentümer gemäß § 8 WEG | 84 | ||
| 3. Die Aneignung gemäß § 928 Abs. 2 S. 2 und § 927 Abs. 2 | 84 | ||
| 4. Vereinigung, Zuschreibung und Grundstücksteilung | 86 | ||
| 5. Die Bestellung einer Inhaberhypothek gemäß § 1188 und einer Inhabergrundschuld gemäß § 1195 | 87 | ||
| 6. Die Bestellung einer Höchstbetragshypothek gemäß § 1190 | 88 | ||
| III. Ergebnis | 88 | ||
| G. Die Verbandageschäfte | 90 | ||
| I. Die Argumente der Lehre vom Verkehrsgeschäft für die Einschränkung des § 892 | 90 | ||
| 1. Die Argumentation mit dem Wortlaut | 90 | ||
| 2. Das Mißbrauchsargument | 93 | ||
| 3. Das Selbstbeschaffungsargument | 95 | ||
| a) Die Sonderbehandlung der Gesamthandsgemeinschaften durch die Lehre vom Verkehrsgeschäft | 95 | ||
| b) Die Notwendigkeit der Gleichbehandlung von Gesamthandsgemeinschaften und juristischen Personen | 97 | ||
| c) Die Annahme der Identität des Verbandes und seiner Mitglieder bei der Anwendung des § 892 | 100 | ||
| d) Die Argumente der Lehre vom Verkehrsgeschäft für die Annahme der Identität von Verband und Mitgliedern bei der Anwendung des § 892 | 101 | ||
| aa) Der Formalismus der Trennung und die Billigkeit der Gleichsetzung | 101 | ||
| bb) Die wirtschaftliche (faktische) Betrachtungsweise | 102 | ||
| cc) Das Verkehrsschutzargument | 105 | ||
| dd) Das Rechtsformargument | 105 | ||
| ee) Das Herrschaftsargument | 106 | ||
| e) Läßt sich die Annahme der Identität des Verbandes und seiner Mitglieder durch die Durchgriffstheorien rechtfertigen? | 109 | ||
| f) Fazit | 113 | ||
| II. Die Argumente der Gegenansicht für die Anwendbarkeit des § 892 | 113 | ||
| 1. Der Schluß aus § 816 Abs. 1 S. 2 | 113 | ||
| 2. Das Schutzwürdigkeitsargument | 114 | ||
| 3. Das Rechtssicherheitsargument | 116 | ||
| 4. Das Haftungskapitalargument | 119 | ||
| III. Zwischenergebnis: Abschied von der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 121 | ||
| IV. Die Ersetzung der Lehre vom Verkehrsgeschäft durch die sachgerechte Anwendung des § 816 Abs. 1 | 123 | ||
| 1. Fallgruppe 1: Der Bereicherungsausgleich bei Einbringung eines Rechts in einen Verband aufgrund einer Sacheinlageverpflichtung | 125 | ||
| a) Der Meinungsstand | 126 | ||
| b) Stellungnahme | 126 | ||
| aa) Entgeltlichkeit wegen Erfüllung der Einlageschuld? | 127 | ||
| bb) Entgeltlichkeit wegen des zugrundeliegenden Gesellschaftsvertrages? | 128 | ||
| (1) Entgeltlichkeit des Gesellschaftsvertrages wegen konditionaler Verknüpfung der gegenseitigen Leistungen? | 129 | ||
| (2) Entgeltlichkeit des Gesellschaftsvertrages wegen kausaler Verknüpfung der gegenseitigen Leistungen? | 129 | ||
| (3) Entgeltlichkeit des Gesellschaftsvertrages wegen synallagmatischer Verknüpfung der gegenseitigen Leistungen? | 130 | ||
| cc) Die Bestätigung des Ergebnisses durch den Sinn des § 816 Abs. 1, den Bereicherungsausgleich zu vereinfachen | 131 | ||
| dd) Das gefundene Ergebnis und der Grundsatz der Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung | 132 | ||
| ee) Der Anspruch des Verbandes gegen den Inferenten | 133 | ||
| c) Ergebnis | 134 | ||
| 2. Fallgruppe 2: Der Bereicherungsausgleich bei einer Veräußerung im Zuge der Liquidation eines Verbandes | 135 | ||
| a) Der Meinungsstand | 135 | ||
| b) Stellungnahme | 136 | ||
| aa) Der Anspruch des ehemals wahren Berechtigten | 136 | ||
| bb) Der Anspruch des erwerbenden Verbandsmitglieds | 138 | ||
| 3. Fallgruppe 3: Der Bereicherungsausgleich beim Erwerb des Verbandes vom Mitglied aufgrund eines Kaufvertrages | 138 | ||
| a) Der Meinungsstand | 139 | ||
| b) Stellungnahme | 139 | ||
| 4. Fallgruppe 4: Der Bereicherungsausgleich beim Erwerb eines Mitgliedes von “seinem” Verband aufgrund eines Kaufvertrages | 141 | ||
| a) Der Meinungsstand | 142 | ||
| b) Stellungnahme | 143 | ||
| 5. Fallgruppe 5: Der Bereicherungsausgleich bei einer Verfügung im Zuge der “Umwandlung” eines Verbandes in einen anderen im Wege der Sachgründung | 146 | ||
| 6. Fallgruppe 6: Der Bereicherungsausgleich beim Erwerb eines Verbandes von einem anderen Verband aufgrund eines Kaufvertrages | 147 | ||
| V. Ergebnis | 147 | ||
| H. Geschäfte zwischen Teilhabern einer Bruchteilsgemeinschaft | 149 | ||
| I. Der Hinzuerwerb weiterer Bruchteile durch einen Teilhaber | 149 | ||
| 1. Die Argumente der Lehre vom Verkehrsgeschäft für die Einschränkung des § 892 | 149 | ||
| a) Das Geschäftsgrundlagenargument | 149 | ||
| b) Das Selbstbeschaffungsargument | 150 | ||
| 2. Die Argumente der Gegenansicht für die Anwendbarkeit des § 892 | 153 | ||
| 3. Ergebnis | 153 | ||
| II. Die Belastung des gemeinschaftlichen Gegenstandes zugunsten eines Teilhabers | 154 | ||
| 1. Die Argumentation der widerstreitenden Ansichten | 154 | ||
| 2. Stellungnahme | 155 | ||
| a) Die Rechtsnatur der Verfügung über den gemeinsamen Gegenstand gemäß § 747 S. 2 | 155 | ||
| aa) Der Stand der Meinungen | 156 | ||
| bb) Stellungnahme | 156 | ||
| b) Folgerungen | 159 | ||
| 3. Ergebnis | 160 | ||
| III. Die Realteilung | 161 | ||
| 1. Die Argumentation der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 161 | ||
| 2. Zwischenergebnis | 163 | ||
| 3. Die Ergänzung der Lehre vom Verkehrsgeschäft durch die sachgerechte Anwendung des § 816 Abs. 1 | 164 | ||
| 4. Ergebnis | 166 | ||
| IV. Die Einräumung von Sondereigentum gemäß § 3 WEG | 167 | ||
| 1. Die Argumentation der widerstreitenden Ansichten | 167 | ||
| 2. Ergebnis | 169 | ||
| I. Die Bestellung eines dinglichen Rechts für den nichtberechtigten Grundstücksveräußerer anläßlich der Veräußerung | 170 | ||
| I. Das Problem | 170 | ||
| II. Die Argumente der Lehre vom Verkehrsgeschäft für die Einschränkung des § 892 | 173 | ||
| 1. Das Erwerbsargument | 173 | ||
| 2. Der Vergleich mit anderen Konstellationen | 175 | ||
| 3. Das Selbstbeschaffungsargument | 177 | ||
| III. Die Argumente der Gegenansicht für die Anwendbarkeit des § 892 | 178 | ||
| IV. Zwischenergebnis: Abschied von der Lehre vom Verkehrsgeschäft | 179 | ||
| V. Die Ersetzung der Lehre vom Verkehrsgeschäft durch die sachgerechte Anwendung des § 816 Abs. 1 | 180 | ||
| J. Vollstreckungs- und Sukzessionsschutz? | 182 | ||
| I. Johannes Hagers Vorschlag | 182 | ||
| II. Stellungnahme | 184 | ||
| 1. Die Ablehnung eines Aussonderungsrechts für die Gläubiger von Bereicherungsansprüchen durch die zweite Kommission | 185 | ||
| 2. Die Unvereinbarkeit der Verdinglichung des § 816 Abs. 1 S. 2 mit dem Abstraktionsprinzip | 185 | ||
| 3. Die Unvereinbarkeit des Hagerschen Sukzessionsschutzes mit § 822 | 187 | ||
| 4. Die Unvereinbarkeit von Hagers Lösung mit der Nichtanwendbarkeit des § 1007 auf unbewegliche Sachen | 188 | ||
| 5. Einwände gegen Hagers Prämisse | 189 | ||
| III. Ergebnis | 191 | ||
| K. Die Vorteile der eigenen Lösung, insbesondere im Lichte der Wertungen des BGB | 192 | ||
| L. Resümee | 198 | ||
| Literaturverzeichnis | 202 | ||
| Anhang 1: Preußische Gesetze | 221 | ||
| Anhang 2: Aufwertungsgesetz vom 16.07.1925 | 223 |
