Der demokratische Bundesstaat des Grundgesetzes
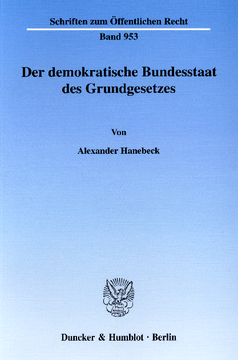
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der demokratische Bundesstaat des Grundgesetzes
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 953
(2004)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| Einleitung: Zum Zusammenhang von Bundesstaat und Demokratie | 21 | ||
| Erstes Kapitel: Bundesstaat und Demokratie | 26 | ||
| A. Bundesstaat | 27 | ||
| I. Die existierenden Konzeptionen | 28 | ||
| 1. Die Entwicklung bis zur Wiedervereinigung | 28 | ||
| a) Die Debatte in den Anfangsjahren der Bundesrepublik | 28 | ||
| b) Der unitarische Bundesstaat | 31 | ||
| c) Der kooperative Bundesstaat | 33 | ||
| 2. Die Entwicklung seit der Wiedervereinigung | 35 | ||
| a) Gemischte Bundesstaatstheorie und Wettbewerbsföderalismus | 37 | ||
| b) Ansätze einer Neuorientierung | 39 | ||
| 3. Begrifflicher Konsens - Doppelstaatlichkeit als Zentralbegriff des Bundesstaatsrechts | 43 | ||
| II. Defizite der Konzeptionen | 48 | ||
| 1. Kritik des Begriffsinstrumentariums | 48 | ||
| a) Methodische Grundlagen | 48 | ||
| b) Herkunft der verwendeten Begriffe | 51 | ||
| aa) Doppelstaatlichkeit und Wortlaut des Grundgesetzes | 51 | ||
| bb) Begründung der Doppelstaatlichkeit im Rückgriff auf Staatslehre und allgemeines Bundesstaatsverständnis | 55 | ||
| c) Inadäquanz der verwendeten Begriffe | 60 | ||
| aa) Souveränität | 60 | ||
| bb) Staat(lichkeit) | 61 | ||
| 2. Unitaristisch-Zentralistische Prägungen | 64 | ||
| a) Besonderer Legitimationsdruck | 65 | ||
| b) Entstehungsgeschichte | 67 | ||
| c) Vorwurf der Ineffektivität | 71 | ||
| III. Fazit/Problemstellung | 74 | ||
| B. Demokratie | 76 | ||
| I. Monistisches Demokratieverständnis | 78 | ||
| II. Offenes / Pluralistisches Demokratieverständnis | 84 | ||
| III. Fazit | 86 | ||
| C. Bundesstaat und Demokratie. Der Ursprung demokratischer Legitimation und die bundesstaatliche Ordnung | 87 | ||
| I. Amerikanisches Volk versus Gliedstaatsvölker - Der Ursprung demokratischer Legitimation und die bundesstaatliche Ordnung der USA | 87 | ||
| 1. Sprachlicher Exkurs | 89 | ||
| 2. Das amerikanische Volk als Grundlage des Bundesstaates - Die Mehrheit des Gerichts | 91 | ||
| 3. Die Völker der Gliedstaaten als Grundlage - Das Minderheitsvotum | 93 | ||
| 4. Das amerikanische Volk und die Landesvölker - Dualer Charakter des Bundesstaates im Sondervotum von Justice Kennedy | 93 | ||
| 5. Statt einer Zusammenfassung: Der Ursprung demokratischer Legitimation und die Auseinandersetzung um die bundesstaatliche Ordnung | 95 | ||
| II. Der Ursprung demokratischer Legitimation und die bundesstaatliche Ordnung des Grundgesetzes | 97 | ||
| Zweites Kapitel: Der Ursprung demokratischer Legitimation im Bundesstaat | 102 | ||
| A. Der Ursprung demokratischer Legitimation in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und in der Staatsrechtslehre | 102 | ||
| I. Das Bundesverfassungsgericht | 103 | ||
| 1. Kollektivierungstendenzen - Individuum und „Volk" | 104 | ||
| 2. Zentralisierungstendenzen - Landes Völker und „Volk" | 106 | ||
| a) Offener Volksbegriff | 106 | ||
| b) Enger werdender Völksbegriff | 107 | ||
| 3. Neuere Ansätze - Öffnung des Demokratieverständnisses | 112 | ||
| 4. Der Bundesrat und das Verhältnis von Landesvolk und Gesamtvolk - Unabhängige Bundeswillensbildung | 113 | ||
| 5. Fazit | 115 | ||
| II. Die Staatsrechtslehre | 116 | ||
| 1. Formale Anerkennung der Existenz von Landes Völkern | 116 | ||
| 2. Unitaristisch-zentralistisches Demokratieverständnis in konkreten Zusammenhängen | 118 | ||
| a) Die Lehre vom unitarischen Bundesstaat | 118 | ||
| b) Die Legitimation des Bundesrates | 119 | ||
| c) Zentralistischer Volksbegriff bezüglich der verfassunggebenden Gewalt | 125 | ||
| aa) Das demokratische Defizit | 126 | ||
| bb) Die Rolle der Länder | 129 | ||
| d) Fazit | 132 | ||
| 3. Umfassend zentralistisches Demokratieverständnis | 132 | ||
| 4. Pluralistisches Demokratieverständnis | 135 | ||
| III. Fazit: Dominanz der Einheitlichkeit im Bundesstaat | 135 | ||
| B. Entstehung des Bundesstaates - Gründung der Länder und der Bundesrepublik | 136 | ||
| I. Landesexistenz und Landesverfassungen vor Inkrafttreten des Grundgesetzes | 136 | ||
| 1. Länderentstehung | 138 | ||
| 2. Landesverfassungen | 139 | ||
| 3. Antizipierte deutsche Verfassung | 141 | ||
| 4. Tatsächliche Eigenständigkeit und vorausgesetzte Gemeinsamkeit | 143 | ||
| II. Entstehung des Grundgesetzes | 144 | ||
| 1. Demokratische Legitimation von Verfassunggebung und Grundgesetz - einige Besonderheiten | 145 | ||
| a) Legitimationsbegründung I - Das fortexistierende deutsche Volk | 148 | ||
| b) Legitimationsbegründung II - Das deutsche Volk unter Einschluss der Ostzone | 151 | ||
| c) Fazit | 154 | ||
| 2. Die Ministerpräsidenten | 155 | ||
| a) Die Ministerpräsidenten und Festlegungen über das Verfahren der Grundgesetzentstehung | 155 | ||
| b) Die Ministerpräsidenten und die Grundlagen des Parlamentarischen Rates | 157 | ||
| c) Fazit: Die Ministerpräsidenten und die Verfassung der verfassunggebenden Gewalt | 160 | ||
| 3. Der Parlamentarische Rat | 161 | ||
| a) Wahl der Abgeordneten | 161 | ||
| aa) Verteilung der Mandate auf die Länder | 161 | ||
| bb) Verteilung der Mandate auf die Parteien | 163 | ||
| cc) Mandatstausch über Ländergrenzen hinweg | 165 | ||
| dd) Fazit: Bedeutung der Länder und einer übergreifenden Gemeinschaft für die Wahl der Abgeordneten | 167 | ||
| b) Die Erwägungen im Parlamentarischen Rat - Selbstverständnis der Abgeordneten und Ursprung demokratischer Legitimation | 168 | ||
| aa) Kein Ausschluss der Länder | 168 | ||
| bb) Ablehnung der Länder als alleiniger Grundlage | 169 | ||
| cc) Bestätigung der Bedeutung der Länder | 171 | ||
| c) Fazit: Die demokratische Legitimation des Parlamentarischen Rates durch Landesvölker und Gesamtvolk | 174 | ||
| 4. Inkrafttreten des Grundgesetzes - Annahme in den Landesparlamenten | 175 | ||
| a) Die Repräsentanten der Landesvölker als Handelnde | 176 | ||
| b) Annahmeverfahren und Bezug zum Gesamtvolk | 177 | ||
| 5. Formulierung im Grundgesetz | 179 | ||
| III. Fazit: Gemeinsame Verfassunggebung | 182 | ||
| C. Entscheidungen im Bundesstaat - Die Bundesebene | 183 | ||
| I. Bundestag und Bundesrat - Gesamtvolk und Landesvölker | 184 | ||
| 1. Bundestag und die Legitimation durch das Gesamtvolk | 184 | ||
| 2. Bundesrat und die Legitimation durch die Landesvölker | 184 | ||
| a) Mitwirkung und Mitgliedschaft | 185 | ||
| b) Stimmenverteilung auf die Länder | 189 | ||
| c) Mehrheits- und Abstimmungsregeln | 193 | ||
| aa) Die Bedeutung des Status „Land" trotz Stimmenspreizung | 193 | ||
| bb) Einheitliche Abstimmung | 196 | ||
| d) Fazit: Das Element Land auf Bundesebene - Die Landesvölker als Legitimationssubjekte | 196 | ||
| II. Bundestag und Bundesrat - Der Ursprung demokratischer Legitimation in den verschiedenen Verfahren | 197 | ||
| 1. Der gleichberechtigte Bundesrat I - Verfassungsänderung | 198 | ||
| 2. Der gleichberechtigte Bundesrat II - Zustimmungsbedürftigkeit jenseits der Verfassungsänderung | 199 | ||
| 3. Zwangsmaßnahmen des Bundes gegenüber den Ländern | 200 | ||
| 4. Weitere Formen der Mitwirkung an der Bundeswillensbildung | 202 | ||
| a) Einspruchsgesetze | 202 | ||
| b) Mitwirkung in Angelegenheiten der EU | 202 | ||
| c) Berufung der Bundes(verfassungs)richter | 204 | ||
| III. Fazit: Bereichsspezifische Ausprägung von selbständiger Legitimation durch Gesamtvolk und gemeinsamer Legitimation mit den Landesvölkern | 204 | ||
| D. Beitritte zum Bundesstaat | 205 | ||
| I. Beitritt des Saarlandes | 205 | ||
| II. Beitritt der DDR | 207 | ||
| 1. Beitritt als Verfassunggebung? | 208 | ||
| 2. Vorgeschichte/Währungsunion | 209 | ||
| 3. Der Beitritt nach Art. 23 GG a.F. | 210 | ||
| 4. Formulierung im Grundgesetz | 212 | ||
| III. Fazit | 214 | ||
| E. Entscheidungen im Bundesstaat - Die Landesebene | 215 | ||
| I. Landesexistenz | 215 | ||
| 1. Grundgesetz und Existenz der Länder I - Die Situation bei Entstehung des Grundgesetzes | 216 | ||
| a) Neugliederung der Länder allgemein - Ursprungsfassung von Art. 29 GG | 216 | ||
| b) Neugliederung im Südwesten - Art. 118 GG | 218 | ||
| 2. Grundgesetz und Existenz der Länder II - Stabilisierung der bestehenden Länder | 220 | ||
| a) Stabilisierung I - Scheitern der Neugliederungsanliegen | 220 | ||
| b) Stabilisierung II - Sicherung der Länderexistenz | 223 | ||
| c) Stabilisierung III - Vereinigung und neue Länder | 224 | ||
| aa) Länderentstehung auf dem Gebiet der DDR | 224 | ||
| bb) Änderungen des Grundgesetzes | 227 | ||
| 3. Fazit | 228 | ||
| II. Landesverfassungen | 229 | ||
| 1. Entscheidung für das Grundgesetz in den Ländern | 229 | ||
| 2. Kompetenz zur Landesverfassunggebung | 231 | ||
| 3. Grundgesetzlicher Rahmen für die Landesverfassungen | 232 | ||
| a) Exkurs: Homogenität im Bundesstaat | 233 | ||
| b) Vorrang des Bundes Verfassungsrechts | 238 | ||
| c) Kompetenzordnung als Beschränkung? | 241 | ||
| d) Beschränkungen durch das Homogenitätsgebot | 243 | ||
| aa) Weitgefasste Homogenität der Strukturprinzipien | 243 | ||
| bb) Geringe Bedeutung des grundgesetzlichen Homogenitätsgebotes | 246 | ||
| cc) Spezielle Ausprägungen | 247 | ||
| e) Beschränkungen durch Grundrechtshomogenität | 248 | ||
| 4. Landesverfassunggebung in den Anfangsjahren der Bundesrepublik | 249 | ||
| 5. Landesverfassunggebung und Landesverfassungsänderung im Zuge der Vereinigung | 251 | ||
| 6. Fazit: Eigenständigkeit und Gemeinsamkeit | 256 | ||
| III. Verfassungsgebundene Gewalt in den Ländern | 256 | ||
| 1. Gesetzgebungskompetenzen | 257 | ||
| a) Verteilung | 257 | ||
| b) Kooperative Ausübung | 260 | ||
| 2. Verwaltungskompetenzen | 262 | ||
| a) Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder I - Verfassungsrechtliche Konstruktion | 263 | ||
| b) Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder II - Einheitlicher Gesetzesvollzug? | 266 | ||
| c) Ausführung der Bundesgesetze durch die Länder III - Unitarische Überformung? | 268 | ||
| 3. Sonstige Landeskompetenzen | 270 | ||
| 4. Fazit: Bereichsspezifische Ausprägungen von Selbständigkeit und Kooperation | 271 | ||
| F. Fazit: Ursprung demokratischer Legitimation - Eigenständigkeit und Einordnung im pluralen Bundesstaat | 271 | ||
| Drittes Kapitel: Der demokratische Bundesstaat des Grundgesetzes | 274 | ||
| A. Grundlagen | 274 | ||
| I. Der Ursprung demokratischer Legitimation - Eine Strukturierung | 274 | ||
| II. Dreiteiligkeit des demokratischen Bundesstaates - Die Unterscheidung von nationaler und föderaler Bundesebene | 277 | ||
| III. Bundesstaat versus Demokratie - Antinomie des Bundesstaates? | 278 | ||
| IV. Erneut: Keine Souveränität/Staatlichkeit | 282 | ||
| B. Der „ewige" Bundesstaat | 284 | ||
| I. Ausgangspunkt: Bundesstaat allgemein als Schutzgut? | 284 | ||
| II. Annäherungen | 290 | ||
| 1. Existenzgarantie und Verfahrensposition | 290 | ||
| 2. Existenzgarantie und „Eigenständigkeit" als grundlegendes Strukturmerkmal | 292 | ||
| 3. Prozeduraler Schwerpunkt des „ewigen" Bundesstaates | 295 | ||
| III. Konkretisierungen | 296 | ||
| 1. Mitwirkung der Länder auf Bundesebene | 297 | ||
| 2. Gesetzgebungskompetenzen der Länder | 299 | ||
| 3. Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU | 302 | ||
| C. Der „gegenwärtige" Bundesstaat | 305 | ||
| I. Grundlinien | 305 | ||
| 1. Wandlungsfähigkeit und prozedurales Bundesstaatsverständnis | 305 | ||
| 2. Kooperation und Selbständigkeit | 306 | ||
| 3. Einheitlichkeit versus Unterschiedlichkeit | 308 | ||
| 4. Unterschiedlichkeit und Wettbewerbsföderalismus? | 311 | ||
| II. Der Bundesrat als zentrale Schnittstelle von Bund und Ländern | 312 | ||
| 1. Die demokratische Legitimation des Bundesrates | 312 | ||
| 2. Der Bundesrat als politisches Organ | 314 | ||
| 3. Zustimmungsbedürftigkeit von Gesetzen | 316 | ||
| a) Anstieg durch Tausch von Gesetzgebungskompetenzen gegen Mitbestimmungsrechte? | 316 | ||
| b) Art. 84 Abs. 1 GG - Die Verantwortung von Bundesregierung und Bundestag | 318 | ||
| c) Entscheidungsspielraum der nationalen Bundesorgane | 321 | ||
| 4. Bundesrat und Willensbildung auf Landesebene | 323 | ||
| III. Der Finanzausgleich | 327 | ||
| 1. Prozeduraler Ausgangspunkt | 327 | ||
| 2. Annäherung an die Definition eines angemessenen Finanzkraftausgleichs | 330 | ||
| 3. Das „Maßstäbegesetz" als Versuch einer prozeduralen Lösung | 334 | ||
| a) Das Urteil - Föderatives Gleichbehandlungsgebot als zentraler Grund | 335 | ||
| b) Maßstäbegesetz und Spielraum des Finanzausgleichsgesetzgebers | 336 | ||
| c) Vagheit statt Konkretisierung - Das Maßstäbegesetz des Jahres 2001 | 339 | ||
| 4. Finanzverfassung als Fehlkonstruktion | 341 | ||
| IV. Die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen | 343 | ||
| 1. Schutz der Landeskompetenzen | 344 | ||
| 2. Die Justiziabilität von Art. 72 Abs. 2 GG | 347 | ||
| a) Das Erfordernis hoher Kontrolldichte | 348 | ||
| b) Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Altenpflegegesetz - Rechtsprechungsänderung mit unitarischen Öffnungsklauseln | 351 | ||
| 3. Die Bedeutung der Kompetenzkataloge | 353 | ||
| Schlussbetrachtung: Der demokratische Bundesstaat jenseits von Staatlichkeitsvorstellungen und Einheitlichkeitsfixierung | 356 | ||
| Literaturverzeichnis | 359 | ||
| Sachregister | 425 |
