Recht und Freiheit im Staatskirchenrecht
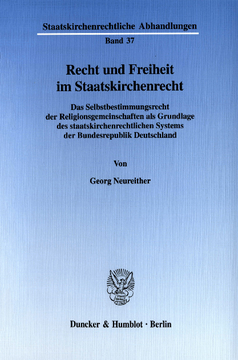
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Recht und Freiheit im Staatskirchenrecht
Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Grundlage des staatskirchenrechtlichen Systems der Bundesrepublik Deutschland
Staatskirchenrechtliche Abhandlungen, Vol. 37
(2002)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die vorliegende Arbeit untersucht zum ersten Mal das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften unter dem Blickwinkel der Gemeinsamkeiten jedweder rechtlichen Selbstbestimmung, sei es des Menschen, der Völker oder der Religionsgemeinschaften. Anhand der erarbeiteten Gemeinsamkeiten ordnet der Autor unter Zugriff auf Rechts- und Verfassungsgeschichte, Philosophie und Rechtsphilosophie sowie die juristische Methodenlehre »Recht und Freiheit« nicht nur im Staatskirchenrecht einander zu. Überdies wird das staatskirchenrechtliche »System« des Grundgesetzes - neu - grundgelegt. Dabei werden gleichsam nebenbei zentrale Ausschnitte aus der Wissenschaftsgeschichte des Staatskirchenrechts des 20. Jahrhunderts dargestellt.Der Verfasser zeigt, dass das Grundgesetz kein »System« begründet und umfasst, weil es keines beinhaltet. Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften nimmt innerhalb der »Trias« der drei Selbstbestimmungsrechte eine Mittelstellung ein: In individueller Hinsicht ist es auf das Selbstbestimmungsrecht des Menschen bezogen, in kollektiver Hinsicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Georg Neureither misst die jeweiligen Ergebnisse in eigenen Abschnitten an der Rechtspraxis und ihren Fragestellungen, indem er konkrete dogmatische Fallprobleme und Rechtslagen (u. a. Schächten, Zeugen Jehovas, Kruzifix, kirchliches und staatliches Ehe- und Arbeitsrecht, Schwangerschaftskonfliktberatung, Kirchenaustritt, Scientology) einbezieht.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 11 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 18 | ||
| Einleitung | 27 | ||
| I. Grundlegende staatskirchenrechtliche Diskussionen | 28 | ||
| 1. Entstehen und Bestehen der Weimarer Kirchenartikel | 28 | ||
| 2. Das staatskirchenrechtliche System | 31 | ||
| 3. Der Körperschaftsstatus | 34 | ||
| 4. Das Selbstbestimmungsrecht | 35 | ||
| II. Gegenstand und Ziel der Arbeit | 36 | ||
| III. Gang der Darstellung | 37 | ||
| IV. Definitionen | 39 | ||
| 1. Kapitel: Die bisher entwickelten staatskirchenrechtlichen Systeme | 41 | ||
| I. Das System der Subordination | 41 | ||
| 1. Das System der Subordination im allgemeinen | 42 | ||
| 2. Die Korrelatentheorie im besonderen | 48 | ||
| II. Das System der Koordination | 52 | ||
| III. Das ständestaatliche Modell | 60 | ||
| IV. Das verbandspluralistische Modell | 62 | ||
| V. Das leistungsstaatliche Modell | 66 | ||
| VI. Zwischenergebnis | 68 | ||
| 2. Kapitel: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Selbstbestimmungsrecht des Menschen | 70 | ||
| I. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker | 70 | ||
| 1. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Grundgesetz | 70 | ||
| a) Das Selbstbestimmungsrecht der Völker in der Diskussion um das Verständnis der Präambel | 71 | ||
| aa) S. 3 der Präambel GG a. F. | 71 | ||
| bb) S. 2 der Präambel GG | 74 | ||
| b) Zwischenergebnis | 77 | ||
| 2. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Völkerrecht | 77 | ||
| a) Die wichtigsten völkerrechtlichen Ausgestaltungen | 77 | ||
| b) Die Rechtsnatur des Selbstbestimmungsrechts der Völker | 80 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 85 | ||
| II. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen | 86 | ||
| 1. Die Rechtsnatur des Selbstbestimmungsrechts des Menschen | 86 | ||
| a) Art. 2 I GG | 87 | ||
| b) Art. 1 I GG | 88 | ||
| c) Zwischenergebnis | 89 | ||
| 2. Der Inhalt des Selbstbestimmungsrechts des Menschen | 89 | ||
| a) Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 I GG | 89 | ||
| aa) Die Persönlichkeitskerntheorie von Hans Peters | 89 | ||
| bb) Die vermittelnde Ansicht von Konrad Hesse und Dieter Grimm | 92 | ||
| cc) Die Unergiebigkeit der Entstehungsgeschichte | 93 | ||
| dd) Gründe für die allgemeine Handlungsfreiheit | 95 | ||
| ee) Zwischenergebnis | 95 | ||
| b) Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Art. 2 I, 1 I GG | 96 | ||
| 3. Art. 2 I, 1 I GG als Ausfluß weiterer „Selbstbestimmungsrechte“ des Menschen | 97 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 98 | ||
| III. Der gemeinsame Grund des Selbstbestimmungsrechts der Völker und des Selbstbestimmungsrechts des Menschen | 98 | ||
| 1. Der vorrechtliche Status – staatsrechtlich betrachtet | 99 | ||
| a) Begründung des vorrechtlichen Status aus Art. 1 I 1 GG | 99 | ||
| b) Begründung des vorrechtlichen Status aus Art. 19 III GG | 103 | ||
| c) Abgrenzung von Selbstbestimmung und Autonomie anhand des Art. 28 II 1 GG | 104 | ||
| 2. Der vorrechtliche Status – völkerrechtlich betrachtet | 105 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 110 | ||
| IV. Der geistesgeschichtliche Hintergrund | 110 | ||
| 1. Der geschichtliche Hintergrund | 110 | ||
| a) Entwicklung und Verwendung des Wortes „Selbstbestimmung“ | 111 | ||
| b) Gründe für die frühere Verrechtlichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker | 113 | ||
| 2. Der geistige Hintergrund | 114 | ||
| a) Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen | 114 | ||
| aa) Art. 2 I GG als verrechtlichter kategorischer Imperativ | 115 | ||
| bb) Rechtliche Folgerungen und rechtliche Strukturen | 117 | ||
| b) Das Selbstbestimmungsrecht der Völker | 119 | ||
| V. Zwischenergebnis | 123 | ||
| 3. Kapitel: Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften | 125 | ||
| I. Methodisches | 126 | ||
| 1. Die Inkorporation | 126 | ||
| 2. Interpretatorische Grundlagen | 128 | ||
| a) Allgemeines | 128 | ||
| b) Die These vom Bedeutungswandel | 129 | ||
| II. Sedes materiae | 130 | ||
| 1. Abgrenzung zu Art. 4 I, II GG | 131 | ||
| a) Unterschiedliche Tatbestände von Art. 4 I, II GG und Art. 137 III 1 WRV | 134 | ||
| b) Unterschiedliche Schranken von Art. 4 I, II GG und Art. 137 III 1 WRV | 135 | ||
| c) Zwischenergebnis | 140 | ||
| aa) Rechtsdogmatischer Teil | 140 | ||
| bb) Rechtspraktischer Teil | 143 | ||
| 2. Abgrenzung zu Art. 9 I GG | 144 | ||
| 3. Abgrenzung zu Art. 137 II 1, 2 WRV | 145 | ||
| 4. Abgrenzung zum Landesverfassungsrecht | 146 | ||
| 5. Abgrenzung zum Vertragsstaatskirchenrecht | 146 | ||
| 6. Zwischenergebnis | 148 | ||
| III. „Selbständig“ | 149 | ||
| 1. Die Herkunft des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ | 150 | ||
| 2. Die Bedeutung des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ | 151 | ||
| a) Zwei ältere Deutungen des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ | 151 | ||
| aa) Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Autonomienorm | 151 | ||
| bb) Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Grundsatz | 152 | ||
| b) Die jetzige Bedeutung des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ | 153 | ||
| aa) Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Selbstbestimmungsnorm | 154 | ||
| bb) Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Recht | 156 | ||
| c) Die jetzige Bedeutung des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ und der Körperschaftsstatus | 157 | ||
| aa) Rechtsdogmatischer Teil | 157 | ||
| bb) Rechtspraktischer Teil | 160 | ||
| d) Die jetzige Bedeutung des Begriffs „Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften“ und sonstige Rechtsformen | 163 | ||
| 3. Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Gesetzesbegriff | 164 | ||
| 4. Zwischenergebnis | 164 | ||
| IV. „Ordnet und verwaltet“ | 166 | ||
| 1. Die Bestimmung der Begriffe „ordnen“ und „verwalten“ | 166 | ||
| a) „Ordnen“ | 166 | ||
| b) „Verwalten“ | 167 | ||
| 2. Die Bedeutung der Begriffe „ordnen“ und „verwalten“ | 167 | ||
| a) Beispiel: Ämterverleihung | 168 | ||
| b) Beispiel: Innere Ordnung | 168 | ||
| c) Beispiel: Staatliche Mitwirkung | 169 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 169 | ||
| V. „Ihre Angelegenheiten“ | 169 | ||
| 1. Die eigenen Angelegenheiten | 171 | ||
| 2. Die Bestimmung der eigenen Angelegenheiten | 172 | ||
| a) Subjektive Bestimmung | 172 | ||
| aa) Subjektive Bestimmung durch den Staat | 172 | ||
| bb) Subjektive Bestimmung durch die Religionsgemeinschaften | 175 | ||
| (1) Rechtsdogmatischer Teil | 177 | ||
| (2) Rechtspraktischer Teil | 185 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 193 | ||
| b) Objektive Bestimmung | 193 | ||
| c) „Gemischte“ Bestimmungen | 195 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 196 | ||
| VI. „Religionsgemeinschaft“ | 198 | ||
| 1. Die Bezeichnung „Religionsgemeinschaft“ | 199 | ||
| 2. Der Begriff „Religionsgemeinschaft“ | 200 | ||
| a) Die Schwierigkeiten von subjektiver und objektiver Betrachtungsweise | 201 | ||
| aa) Subjektive Betrachtungsweise | 201 | ||
| bb) Objektive Betrachtungsweise | 209 | ||
| cc) Zwischenergebnis | 212 | ||
| b) Definitionen | 213 | ||
| aa) Rechtsdogmatischer Teil | 213 | ||
| (1) Meinung und Glaube | 213 | ||
| (2) Religion und Weltanschauung | 218 | ||
| (3) Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | 221 | ||
| bb) Rechtspraktischer Teil | 225 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 234 | ||
| VII. Die „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ | 237 | ||
| 1. Der Ausgangspunkt | 238 | ||
| 2. Die Heckelsche Formel | 242 | ||
| 3. Die Nichtanwendbarkeit der Schrankenformel | 246 | ||
| 4. Die Bereichsscheidungslehre | 248 | ||
| 5. Die Güterabwägung | 252 | ||
| a) Rechtsdogmatischer Teil | 253 | ||
| aa) Die Richtigkeit der Güterabwägung I | 254 | ||
| (1) Die Sicht des Staates | 255 | ||
| (2) Die Sicht der Religionsgemeinschaften | 258 | ||
| bb) Die Richtigkeit der Güterabwägung II | 262 | ||
| cc) Exkurs: Die Grenzen der Logik | 264 | ||
| (1) Die Grenzen der Logik | 265 | ||
| (2) Die tautologische Struktur der Logik | 268 | ||
| (3) Anwendung auf die Schranken des Art. 137 III 1 WRV | 270 | ||
| dd) Die Richtigkeit der Güterabwägung III | 271 | ||
| ee) Schrankenformel und Selbstverständnis | 271 | ||
| b) Rechtspraktischer Teil | 273 | ||
| 6. Eine Gemeinsamkeit | 280 | ||
| 7. Zwischenergebnis | 280 | ||
| VIII. Zusammenfassung | 282 | ||
| 4. Kapitel: Folgerungen | 286 | ||
| I. Verfassungsprozessuale Verteidigung gegen eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften | 287 | ||
| 1. Gegengründe | 287 | ||
| 2. Gründe | 289 | ||
| a) Lücke | 290 | ||
| b) Ähnlichkeit | 292 | ||
| 3. Zwischenergebnis | 300 | ||
| II. Das staatskirchenrechtliche System | 300 | ||
| 1. Die bisher entwickelten staatskirchenrechtlichen Systeme im Lichte des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften | 301 | ||
| 2. Das staatskirchenrechtliche System im Lichte des Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften | 310 | ||
| a) Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften als Grundlage des staatskirchenrechtlichen Systems | 310 | ||
| b) Recht und Freiheit im Staatskirchenrecht | 319 | ||
| Schluß | 324 | ||
| Literaturverzeichnis | 330 | ||
| Sachwortverzeichnis | 377 |
