Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Opposition nach dem Grundgesetz
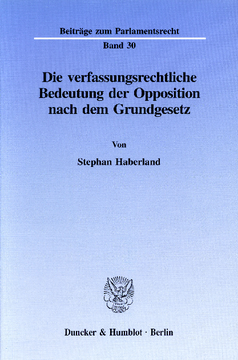
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Opposition nach dem Grundgesetz
Beiträge zum Parlamentsrecht, Vol. 30
(1995)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung | 13 | ||
| Erstes Kapitel: Verfassungstheoretische und verfassungsrechtsdogmatische Grundlagen | 17 | ||
| A. Herleitung aus dem Demokratieprinzip | 17 | ||
| I. Opposition als Korrelat zur Geltung des Mehrheitsprinzips | 19 | ||
| 1. Mehrheitsprinzip und Vernunfts-(Richtigkeits-)Argument | 21 | ||
| 2. Mehrheitsprinzip und Gleichheitsargument | 23 | ||
| 3. Mehrheitsprinzip und Freiheitsargument | 25 | ||
| 4. Mehrheitsprinzip als formelle Regel der Entscheidungsfindung | 26 | ||
| II. Opposition als Folge des Prinzips der Herrschaft auf Zeit | 29 | ||
| III. Opposition als Folge von Pluralität und Offenheit der grundgesetzlichen Ordnung | 31 | ||
| IV. Ergebnis | 33 | ||
| B. Herleitung aus Art. 67 Abs. 1 GG | 34 | ||
| C. Ergebnis | 36 | ||
| Zweites Kapitel: Die verfassungspolitischen Funktionen der Opposition und der verfassungsrechtliche Rahmen zur Wahrnehmung dieser Funktionen | 38 | ||
| A. Die verfassungspolitischen Funktionen der Opposition | 39 | ||
| I. Kontrollfiinktion | 40 | ||
| II. Kritikfunktion | 42 | ||
| III. Alternativ- und Initiativfunktion | 43 | ||
| IV. Integrationsfunktion | 45 | ||
| V. Gemeinsame Aspekte der Oppositionsfunktionen | 46 | ||
| B. Der rechtliche Rahmen des Grundgesetzes zur Wahrnehmung der Oppositionsfunktionen | 47 | ||
| I. Die Funktionswahrnehmung begünstigende Vorschriften | 48 | ||
| 1. Die Regelungen des Wahlrechts | 48 | ||
| a) Gleichheit der Wahl | 48 | ||
| b) Allgemeinheit der Wahl | 57 | ||
| c) Freiheit, Geheimheit und Unmittelbarkeit der Wahl | 59 | ||
| d) Ergebnis | 60 | ||
| 2. Verfassungsrechtliche Grundlagen für die Bildung einer parlamentarisch organisierten Opposition | 60 | ||
| a) Die Rechtsstellung der Fraktionen und Gruppen | 61 | ||
| aa) Die Bedeutung des Art. 21 Abs. 1 GG | 62 | ||
| bb) Die Bedeutung des Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG | 66 | ||
| b) Die Chancengleichheit der Fraktionen | 69 | ||
| c) Der gleichberechtigte Zugang zu Ausschüssen und Gremien des Bundestages | 71 | ||
| d) Ergebnis | 77 | ||
| 3. Mittel der Opposition zur Wahrnehmung ihrer Funktionen | 78 | ||
| a) Mißtrauensvotum und Mißbilligungsbeschlüsse | 78 | ||
| aa) Mißtrauensvotum, Art. 67 Abs. 1 GG | 78 | ||
| bb) Mißbilligungsbeschlüsse | 80 | ||
| b) Zitier- und Interpellationsrechte | 83 | ||
| aa) Zitierrecht, Art. 43 Abs. 1 GG | 83 | ||
| bb) Interpellationsrechte | 85 | ||
| (1) Große Anfrage, §§ 100-103 GeschOBT | 86 | ||
| (2) Kleine Anfrage, § 104 GeschOBT | 87 | ||
| (3) Einzelfragen und Fragestunde, § 105 GeschOBT | 87 | ||
| (4) Aktuelle Stunde, § 106 GeschOBT | 88 | ||
| (5) Die Antwortpflicht der Bundesregierung | 89 | ||
| c) Die Beteiligung an den Bundestagsausschüssen | 91 | ||
| aa) Fachausschüsse | 91 | ||
| bb) Untersuchungsausschüsse, Art. 44 GG | 93 | ||
| (1) Erforderlichkeit eines Einsetzungsbeschlusses | 94 | ||
| (2) Änderung des Untersuchungsgegenstandes durch die Parlamentsmehrheit | 97 | ||
| (3) Minderheitsschutz im Untersuchungsverfahren | 100 | ||
| (4) Feststellung des Untersuchungsergebnisses | 103 | ||
| (5) Beendigung des Untersuchungsverfahrens | 104 | ||
| (6) Hervorhebung der Opposition im Untersuchungsverfahren? | 104 | ||
| cc) Enquete-Kommissionen, § 56 GeschOBT | 105 | ||
| d) Einfluß- und Mitwirkungsmöglichkeiten im parlamentarischen Verfahren | 108 | ||
| aa) Einberufung des Bundestages auf Verlangen eines Drittels seiner Mitglieder, Art. 39 Abs. 3 Satz 3 GG | 109 | ||
| bb) Die Mitwirkung im Ältestenrat | 110 | ||
| cc) Das Rederecht | 111 | ||
| dd) Antrags- und Initiativrechte | 113 | ||
| e) Verfahrensmöglichkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht | 115 | ||
| aa) Organstreitverfahren, Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, §§ 13 Nr. 5, 63 ff BVerfGG | 115 | ||
| bb) Abstrakte Normenkontrolle, Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG, §§ 13 Nr. 6, 76 ff BVerfGG | 118 | ||
| f) Ergebnis | 119 | ||
| II. Die Funktionswahrnehmung begrenzende Vorschriften | 120 | ||
| 1. Die freiheitliche demokratische Grundordnung als allgemeine Grenze | 120 | ||
| 2. Parteienverbot und Mandatsverlust | 122 | ||
| 3. Grundrechtsverwirkung und Mandatsverlust | 127 | ||
| C. Ergebnis | 131 | ||
| Drittes Kapitel: Eigenständiger Rechtsstatus der Opposition im grundgesetzlich organisierten Verfassungsprozeß ? | 133 | ||
| A. Eigenständiger Rechtsstatus der Opposition durch das im Grundgesetz konkretisierte Gewaltenteilungsprinzip? | 136 | ||
| B. Eigenständiger Rechtsstatus der Opposition aufgrund der grundgesetzlichen Ausgestaltung des parlamentarischen Regierungssystems? | 140 | ||
| C. Eigenständiger Rechtsstatus der Opposition auf Grundlage der parlamentarischen "Minderheitsrechte"? | 144 | ||
| D. Ergebnis | 149 | ||
| Viertes Kapitel: Die landesverfassungsrechtlichen Oppositionsnormen und die sich daraus ergebenden Folgerungen für eine Reform des Grundgesetzes | 150 | ||
| A. Der Oppositionsbegriff in den Landesverfassungen | 151 | ||
| B. Opposition als "wesentlicher Bestandteil der Demokratie" | 156 | ||
| C. Landesverfassungsrechtliche Aufgabenzuweisungen an die Opposition | 159 | ||
| I. Art. 23 a Abs. 2 HmbVerf | 160 | ||
| II. Art. 12 Abs. 1 SchlHVerf und Art. 26 Abs. 2 VerfMV | 163 | ||
| D. Das Recht der Opposition auf Chancengleichheit | 167 | ||
| E. Die landesverfassungsrechtliche Verankerung des Oppositionsführers | 169 | ||
| F. Ergebnis | 172 | ||
| Fünftes Kapitel: Verfassungstheoretische Schlußfolgerungen | 174 | ||
| Anhang: Synopse der landesverfassungsrechtlichen Oppositionsnormen | 183 | ||
| Literaturverzeichnis | 187 |
