Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale
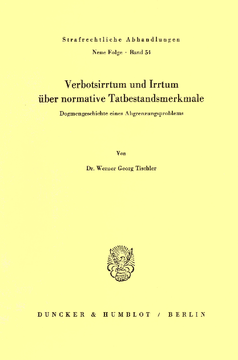
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Verbotsirrtum und Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale
Dogmengeschichte eines Abgrenzungsproblems
Strafrechtliche Abhandlungen. Neue Folge, Vol. 54
(1984)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
Die »Strafrechtlichen Abhandlungen - Neue Folge« wurden 1957 von Eberhard Schmidhäuser in Zusammenarbeit mit den deutschen Strafrechtslehrern in der Nachfolge der von Hans Bennecke begründeten »Strafrechtlichen Abhandlungen« (1896 bis 1942) eröffnet. Ihr Ziel ist es, wie das ihrer Vorgängerin, hervorragenden Arbeiten des strafrechtswissenschaftlichen Nachwuchses eine angemessene Veröffentlichung zu sichern. Aufgenommen werden ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen zum Strafrecht und Strafprozessrecht sowie zur Straftheorie. 1986 wurde Friedrich-Christian Schroeder (Regensburg) zum Herausgeber bestellt, 2007 trat Andreas Hoyer (Kiel) als weiterer Herausgeber an die Stelle des verstorbenen Eberhard Schmidhäuser. Die Aufnahme in die Reihe erfolgt auf Vorschlag eines Strafrechtslehrers.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Erster Abschnitt: Einleitung | 13 | ||
| A. Problemstellung | 13 | ||
| B. Begriffsklärungen | 17 | ||
| C. Praktische Relevanz der Irrtumsabgrenzung | 22 | ||
| I. Vorsatztheorien | 22 | ||
| II. Schuldtheorien | 24 | ||
| III. Standorte des Abgrenzungsproblems und Beispielsfälle | 24 | ||
| 1. Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale – Verbotsirrtum: Fernseh-Fall | 24 | ||
| 2. Erlaubnistatbestandsirrtum – Erlaubnisirrtum: „Moos raus“-Fall | 27 | ||
| 3. Der umgekehrte Irrtum | 29 | ||
| a) Das Umkehrprinzip | 29 | ||
| b) Untauglicher Versuch – Wahndelikt: Straftat-Fall | 32 | ||
| D. Besonderheiten bei normativen Tatbestandsmerkmalen | 34 | ||
| I. Normative und deskriptive Merkmale | 34 | ||
| II. Der Vorsatz bei den normativen Tatbestandsmerkmalen | 36 | ||
| III. Vorsatz und Unrechtsbewußtsein | 38 | ||
| Zweiter Abschnitt: Dogmengeschichte | 40 | ||
| A. Die Irrtumsrechtsprechung des Reichsgerichts | 40 | ||
| B. Die Zeit von der Gründung des Reichsgerichts bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges | 45 | ||
| I. Die Jahre 1874 bis 1914 | 45 | ||
| 1. Anhänger des Reichsgerichts | 45 | ||
| a) Schütze (1874), Berner (1891), Stenglein (1892), Delius (1901) | 45 | ||
| b) Kohler (1912) | 46 | ||
| c) Wachenfeld (1914) | 47 | ||
| 2. Vorreichsgerichtliche Positionen | 48 | ||
| a) Hälschner (1881) | 48 | ||
| b) Kriegsmann (1904) | 49 | ||
| 3. Kohlrauschs Kritik am Reichsgericht (1903) | 50 | ||
| 4. Vorläufer der Vorsatztheorie | 52 | ||
| a) Liepmann (1900) | 52 | ||
| b) Finger (1904) | 52 | ||
| c) Binding (1907/1913) | 52 | ||
| 5. Vorläufer der Schuldtheorie | 54 | ||
| a) v. Wächter (1881) | 54 | ||
| b) A. Merkel (1889) | 55 | ||
| c) Dohna (1905) | 55 | ||
| d) R. v. Hippel (1908) | 56 | ||
| 6. v. Bars Lehre (1907) | 58 | ||
| II. Die Jahre 1915 bis 1930 | 60 | ||
| 1. Die „Entdeckung“ der normativen Tatbestandsmerkmale durch M. E. Mayer (1915) | 60 | ||
| 2. Ansätze zu einer materiellen Unterscheidung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum | 65 | ||
| a) A. Köhler (1917) | 65 | ||
| b) Grünhut (1930) | 67 | ||
| 3. Die Gegenposition | 67 | ||
| a) Die Vermutungslehre: Sauer (1921) | 68 | ||
| b) Die Vorsatztheorie: Beling (1930) | 71 | ||
| 4. Dohnas Zweifel an der willkürfreien Unterscheidbarkeit der Irrtumsarten (1925) | 72 | ||
| 5. Die „Einzelwertung – Gesamtwertung“-Lehre | 73 | ||
| a) E. Wolf (1928) | 73 | ||
| b) Eichmann (1928) | 74 | ||
| c) Engisch (1930) | 75 | ||
| d) F. Hofmann (1930) | 78 | ||
| 6. L. Wolter: Sinnkenntnis – Wertungskenntnis (1930) | 79 | ||
| III. Die Jahre 1931 bis 1944 | 84 | ||
| 1. Die Gegenposition | 84 | ||
| a) Die Vermutungslehre | 84 | ||
| aa) Frank (1931) | 84 | ||
| bb) Sauer (1931) | 87 | ||
| cc) Eb. Schmidt (1932) | 87 | ||
| b) Die Vorsatztheorie: Mezger (1943/1944) | 91 | ||
| 2. Die „Objekt – Wertung“-Lehre: Welzel (1933) | 95 | ||
| 3. Tendenz zur Aufspaltung der normativen Tatbestandsmerkmale | 98 | ||
| a) Schwinge / Zimmerl (1937) | 98 | ||
| b) Welzel (1939) | 98 | ||
| 4. Die Auslegung des einzelnen Tatbestandes | 99 | ||
| a) H. Mayer: Verbot – vom Verbot vorausgesetzte Rechtseinrichtung (1936) | 99 | ||
| b) v. Weber: Die Lehre von den Komplexbegriffen (1936) | 101 | ||
| C. Vom Ende des Reichsgerichts bis zur Verbotsirrtumsentscheidung des Bundesgerichtshofs (BGHSt 2, 194) | 103 | ||
| I. Die Abkehr der Oberlandesgerichte von der reichsgerichtlichen Irrtumsrechtsprechung | 103 | ||
| 1. Die Vorsatztheorien | 104 | ||
| a) Die strenge Vorsatztheorie | 104 | ||
| aa) Oberlandesgericht Kiel (1946) | 104 | ||
| bb) H. Schröder (1949) | 104 | ||
| b) Die eingeschränkte Vorsatztheorie | 107 | ||
| 2. Die Schuldtheorie | 108 | ||
| a) Radbruch (1947) | 110 | ||
| b) Welzel (1947/1948) | 110 | ||
| c) Oberlandesgericht Oldenburg (1950) | 112 | ||
| d) Eb. Schmidt (1950) | 113 | ||
| e) v. Weber (1950) | 113 | ||
| 3. Die Spielarten der Schuldtheorie | 113 | ||
| II. Stellung der Literatur zur Irrtumsabgrenzung | 119 | ||
| 1. Die Gegenposition | 119 | ||
| a) Arthur Kaufmanns Lehre vom Vorsatz als Bewußtsein der Sozialschädlichkeit (1949) | 119 | ||
| b) Die Vorsatztheorie | 135 | ||
| aa) Mezgers Stufenlehre (1949/1950) | 135 | ||
| bb) H. Schröders strenge Vorsatztheorie (1950/1951) | 139 | ||
| cc) Lang-Hinrichsen (1951) | 145 | ||
| 2. Wachsendes Problembewußtsein bei den Vertretern der Schuldtheorie | 147 | ||
| a) Dohna (1947) | 147 | ||
| b) Welzel (1948) | 148 | ||
| c) Lange (1948) | 149 | ||
| d) Hartung (1950) | 152 | ||
| e) Warda (1950) | 155 | ||
| 3. Die Vermutungslehre | 157 | ||
| a) Die praktische Irrelevanz des Verbotsirrtums | 157 | ||
| aa) Bockelmann (1951) | 157 | ||
| bb) Niese (1951) | 158 | ||
| b) Die Wertgefühlslehre als Variante der Vermutungslehre | 159 | ||
| aa) Nowakowski (1951) | 159 | ||
| bb) Oehler (1951) | 160 | ||
| 4. Welzels Lehre von den Rechtspflichtmerkmalen (1952) | 161 | ||
| III. Die Verbotsirrtumsentscheidung BGHSt 2, 194 | 165 | ||
| D. Von BGHSt 2, 194 bis zur Gegenwart: Die Bemühungen um eine theoretische Fundierung der von der Praxis geforderten Unterscheidung zwischen dem Verbotsirrtum und dem Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale | 167 | ||
| I. Die Jahre 1952 bis 1955: Von BGHSt 2, 194 bis zu den Beratungen der Großen Strafrechtskommission | 171 | ||
| 1. Die Gegenposition | 171 | ||
| a) Die Vorsatztheorie | 171 | ||
| aa) Lang-Hinrichsen (1952/1953) | 171 | ||
| bb) H. Schröder (1953) | 176 | ||
| b) Die Vermutungslehre: Der weitere Ausbau von Nowakowskis Wertgefühlstheorie (1953) | 179 | ||
| 2. Zweifel im Lager der Schuldtheorie an der Abgrenzbarkeit | 182 | ||
| a) Engisch (1954) | 183 | ||
| b) Mangakis (1954) | 189 | ||
| 3. Der Verweis auf die Auslegung des einzelnen Tatbestandes als gemeinsamer letzter Ausweg für die unterschiedlichen Differenzierungslehren | 189 | ||
| a) H. Mayer: Die Verteidigung des Reichsgerichts (1952) | 190 | ||
| b) v. Weber: Die Lehre von den Komplexbegriffen (1953) | 191 | ||
| c) v. Weber: Die „Objekt – Wertung“-Lehre (1954) | 195 | ||
| d) Busch: Die „Einzelwertung–Gesamtwertung“-Lehre (1954) | 195 | ||
| II. Die Beratungen der Großen Strafrechtskommission (1955) | 199 | ||
| III. Die Abgrenzungsdiskussion von den Beratungen der Großen Strafrechtskommission bis Mitte der sechziger Jahre | 203 | ||
| 1. Die Gegenposition: Mattil (1962) | 204 | ||
| 2. Zweifel im Lager der Schuldtheorie an der Abgrenzbarkeit: Sax (1955) | 206 | ||
| 3. Der Beginn der Rückbesinnung auf die Rechtsprechung des Reichsgerichts | 208 | ||
| a) Kreutzer (1955) | 209 | ||
| b) G. Köhler (1955) | 211 | ||
| 4. Vorläufer der Lehre vom vorsatzrelevanten Rechtsirrtum im Vorfeld des Tatbestandes | 213 | ||
| a) Die Wohnraumbewirtschaftungs-Entscheidung, BGHSt 9, 358 (1956) | 213 | ||
| b) Welzel (1957) | 216 | ||
| 5. Kriminalpolitische Abgrenzungstheorien | 216 | ||
| a) Salms Tatbildlehre (1957) | 216 | ||
| b) Küchenhoffs Lehre vom generellen Normenirrtum (1957) | 219 | ||
| 6. Die Scheinlösung des Abgrenzungsproblems durch Vermengung mit der Lehre vom Subsumtionsirrtum: Hans Müller (1958) | 221 | ||
| 7. Die weitere Entwicklung der „Einzelwertung – Gesamtwertung“-Lehre | 225 | ||
| a) Kunert (1958) | 225 | ||
| b) Engisch (1960) | 234 | ||
| c) Schaffstein (1960) | 235 | ||
| 8. Roxins Lehre von den gesamttatbewertenden Merkmalen (1959) | 236 | ||
| 9. Die Impulslehre | 245 | ||
| a) Engisch (1958) | 246 | ||
| b) Schaffstein (1961) | 247 | ||
| c) Roxin (1962) | 252 | ||
| 10. Kriterienkombinationen | 255 | ||
| a) Schweikert (1957) | 255 | ||
| b) Lange (1961) | 256 | ||
| c) Hobe (1962) | 258 | ||
| d) Seume (1968) | 261 | ||
| 11. Der Stand der Abgrenzungsdiskussion zu Beginn der sechziger Jahre | 263 | ||
| IV. Exkurs: Die Diskussion um die Abgrenzung im Bereich des umgekehrten Irrtums (untauglicher Versuch – Wahndelikt) | 264 | ||
| 1. Rückblick: Die frühen fünfziger Jahre | 264 | ||
| a) Die Privatbahn-Entscheidung, BGHSt 1, 13 (1951) | 264 | ||
| b) Mezger (1951) | 266 | ||
| c) Pusinelli (1951) | 269 | ||
| d) Die Wiedergutmachungs-Entscheidung, BGHSt 3, 248 (1952) | 270 | ||
| e) Welzel (1953) | 273 | ||
| 2. Die sechziger und die ersten siebziger Jahre | 275 | ||
| a) Die ration cards-Entscheidung, BGHSt 13, 235 (1959) | 275 | ||
| b) Traub (1960) | 277 | ||
| c) Die Sicherungsübereignungs-Entscheidung, Oberlandesgericht Stuttgart (1961) | 278 | ||
| d) Baumann (1962) | 280 | ||
| e) U. Weber (1961) | 281 | ||
| f) Maurach (1962) | 281 | ||
| g) König (1962) | 282 | ||
| h) Bindokat (1963) | 282 | ||
| i) Sax (1964) | 284 | ||
| j) Foth (1965) | 284 | ||
| k) Traub (1967) | 285 | ||
| l) Kuhrt (1968) | 286 | ||
| m) Probst (1969) | 287 | ||
| n) Engisch (1972) | 289 | ||
| o) Blei (1973) | 291 | ||
| 3. Ergebnis | 292 | ||
| V. Die Aufgabe des Postulats einer klaren Unterscheidung zwischen dem Verbotsirrtum und dem Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale | 292 | ||
| 1. Erste Auflösungstendenzen | 293 | ||
| a) Schweikert (1957) | 293 | ||
| b) Dahm (1959) | 293 | ||
| c) Noll (1965) | 293 | ||
| 2. Die Annäherung der Vorsatztheorie an die Schuldtheorie durch die Lehre vom sachgedanklichen Unrechtsbewußtsein | 294 | ||
| a) Platzgummer (1964) | 295 | ||
| b) Roxin (1966) | 297 | ||
| c) Schmidhäuser (1966) | 297 | ||
| d) Schewe (1967) | 300 | ||
| e) Ergebnis | 302 | ||
| VI. Die aktuelle Diskussion | 303 | ||
| 1. Verschiedene Ansätze | 303 | ||
| a) Platzgummer: Die Verzeihlichkeit des Irrtums (1973) | 303 | ||
| b) Zielinski: Die Mitteilbarkeit des Norminhalts (1973) | 306 | ||
| c) Baumann: Die Lehre von den Rechtspflichtmerkmalen (1974) | 313 | ||
| 2. Studien aus dem Lager der analytischen Sprachphilosophie | 315 | ||
| a) Herberger (1976) | 316 | ||
| b) Darnstädt (1978) | 318 | ||
| 3. Die Renaissance der reichsgerichtlichen Unterscheidung zwischen strafrechtlichem und außerstrafrechtlichem Rechtsirrtum | 321 | ||
| a) Tiedemann: abstrakter Rechtssatz – konkrete Sollensnorm (1969) | 321 | ||
| b) Die Unterscheidung: Rechtsirrtum im Vorfeld des Tatbestandes – Rechtsirrtum über die Reichweite des Tatbestandes | 329 | ||
| aa) Herzberg (1980) | 329 | ||
| bb) Die Steuerhinterziehungs-Entscheidung des Kammergerichts (1981) | 335 | ||
| c) Haft: gegenstandsbezogener Irrtum – begriffsbezogener Irrtum (1980/1981) | 336 | ||
| d) Die Ordnungswidrigkeiten-Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts (1980) | 340 | ||
| e) Stree (1981) | 341 | ||
| f) Burkhardts vorreichsgerichtliche Unterscheidung von Tatsachenirrtum und Rechtsirrtum (1981) | 342 | ||
| Dritter Abschnitt: Schlußbetrachtung | 349 | ||
| Anhang: Schlüchter: Das Erfassen der rechtsgutsbezogenen Komponente (1983) | 367 | ||
| Literaturverzeichnis | 370 |
