Vom Subjekt zur Selbstreferenz
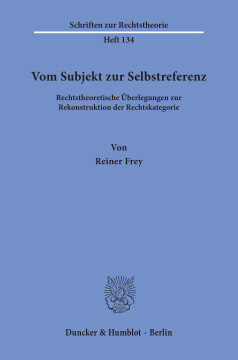
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Vom Subjekt zur Selbstreferenz
Rechtstheoretische Überlegungen zur Rekonstruktion der Rechtskategorie
Schriften zur Rechtstheorie, Vol. 134
(1989)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 12 | ||
| Vorbemerkung: Zur Zielsetzung der Arbeit | 13 | ||
| 1. Kapitel: Rechtssubjektivität im Modell des „bürgerlichen Rechts" | 14 | ||
| I. „Bürgerliche Revolution", positives Recht und Selbstreferenz | 14 | ||
| II. Anspruch und Kritik des bürgerlichen Rechts: Hegels „Grundlinien einer Philosophie des Rechts" | 17 | ||
| 1. Vom „abstrakten Recht" zum „Recht der Sittlichkeit" | 19 | ||
| 2. Darstellung und Kritik | 20 | ||
| a) Autonomie des freien Willens: die Abstraktion von materialen Substraten | 22 | ||
| b) Die Reduktion auf rechtsformige Willensbeziehungen | 25 | ||
| c) Reziprozität von Rechten und Pflichten | 26 | ||
| d) Jenseits von „Not- und Verstandesstaat" und „abstraktem Recht": Hegels Behauptung einer Synthese im „Staat" | 27 | ||
| 2. Kapitel: Zur Transformation der Rechtskategorie seit dem 19. Jahrhundert | 33 | ||
| I. Die „Internalisierang" des Subjekts | 33 | ||
| II. Eine neue Selbstbeschreibung: das Recht als selbstreferentielles („autopoietisches") System | 36 | ||
| 1. Identität und Differenz | 38 | ||
| 2. „Autopoiesis" | 40 | ||
| a) Operative (kontruktivistische) Erkenntnistheorie | 40 | ||
| b) Einheit von Selbstbeschreibung und Selbstreproduktion | 42 | ||
| c) Binäre Codierung | 44 | ||
| d) Geschlossenheit und Offenheit | 45 | ||
| 3. System, Selbstreferenz und Sinn | 47 | ||
| 4. Zwischenbilanz und Ausblick | 51 | ||
| 3. Kapitel: Ansatzpunkte für eine Rekonstruktion der Rechtskategorie | 53 | ||
| I. Öffnung des Codes? | 53 | ||
| II Von struktureller zu temporaler Entparadoxierung: die „Prozeduralisierung" des Rechts auf der Ebene der Programme | 55 | ||
| 1. Strukturelle Entparadoxierung | 57 | ||
| 2. Das Modell in seiner historischen Entwicklung | 59 | ||
| 3. Die „Verzeitlichung" des Modells | 62 | ||
| 4. Funktionswandel der Normativität | 65 | ||
| a) Normativität in der „Gesellschaft der Individuen" | 65 | ||
| b) Normativität in der „Gesellschaft der Organisationen" | 66 | ||
| 4. Kapitel: Geschlossenheit und Offenheit | 72 | ||
| I. „Reine Rechtslehre" | 72 | ||
| II. Offenheit im System und zwischen Systemen | 75 | ||
| 1. Programme | 75 | ||
| 2. Interpenetration, Kommunikation und Interaktion | 77 | ||
| 3. Zwei andere Beschreibungsversuche: „Geist" und „Spiel" | 78 | ||
| 4. „Theorie der Offenheit" | 79 | ||
| IIΙ. Selbstreferenz, Kommunikation und Rationalität | 82 | ||
| 1. Paradigmenwechsel | 82 | ||
| 2. Die „Theorie des kommunikativen Handelns" | 83 | ||
| 3. Kritische Einwände | 87 | ||
| a) Konstruktion und Kritik ohne „vernünftige Identität" | 87 | ||
| b) „Normativität und Faktizität" | 90 | ||
| 5. Kapitel: Programmierung von Programmierungen: „second order cybernetics" | 94 | ||
| I. Operative Autonomie und Steuerung | 94 | ||
| II. „Resonanz" | 97 | ||
| III. Maßstäbe „zweiter Ordnung": Rechtsdogmatik, Foren und Verfahren | 100 | ||
| 1. Recht als „Produktionsbegriff" | 100 | ||
| 2. „Wirkungs-Perspektive" | 103 | ||
| 3. Beteiligung und Betroffenheit | 106 | ||
| 4. Einzelne Vorschläge | 108 | ||
| Literaturveizeichnis | 111 |
