Selbstorganisation
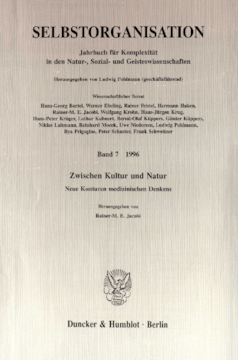
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Selbstorganisation
Jahrbuch für Komplexität in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Bd. 7 (1996). Zwischen Kultur und Natur. Neue Konturen medizinischen Denkens
Editors: Jacobi, Rainer-M. E.
Selbstorganisation, Vol. 7
(1997)
Additional Information
Book Details
Pricing
Abstract
»Selbstorganisation« bezeichnet ein neues Paradigma in den Wissenschaften. Es umfaßt so unterschiedliche Konzepte wie Synergetik, Autopoiese und Chaostheorie. Entstehung und Dynamik von Komplexität bilden den gemeinsamen Problemhorizont. Als offene, innovative Wirklichkeitsbereiche werden Natur, Mensch und Geschichte gleichsam zu Themen der Selbstorganisationsforschung. Insofern leistet dieses neue Paradigma mit seiner Kritik am mechanistischen Weltverständnis und dessen natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichem Reduktionismus einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung der kulturwissenschaftlichen Perspektive. Mit der Thematisierung der Geschichtlichkeit und Kontingenz von Denk- und Wissensformen, kommt jene Selbstreflexifität zum Ausdruck, die es zum eigentlichen Paradigma der Moderne werden läßt.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einführung | 7 | ||
| Aufsätze | 21 | ||
| Klaus Michael Meyer-Abich, Essen: Komplementäre Erfahrung von Ganzheit im Gestaltkreis. Anfänge eines Naturbildes, in dem wir selber vorkommen | 21 | ||
| I. Die relative Bedeutung eines jeden Begriffs | 24 | ||
| 1. These: Die Physik handelt von Tat-Sachen, nicht nur von den Sachen. | 26 | ||
| II. Komplementäre Wahrnehmungen desselben Objekts | 28 | ||
| 2. These: Komplementär ist jeweils die unmittelbare Erfahrung eines Gegenstands zur Miterfahrung der Weise seiner Vergegenständlichung. | 30 | ||
| 3. These: Komplementarität besteht zwischen Tat-Sachen der Wahrnehmung, die sich zur Ganzheit des Bewußtseins von einem Gegenstand ergänzen. Grundform der Komplementarität ist die unmittelbare Erfahrung eines Gegenstands im Verhältnis zur Miterfahrung der Weise seiner Vergegenständlichung. | 32 | ||
| III. Komplementarität im Gestaltkreis | 33 | ||
| IV. Von der Einheit zur Ganzheit | 36 | ||
| 4. These: Ganzheiten ist nur durch eine komplementäre Wissenschaft gerecht zu werden. | 38 | ||
| Dietmar Kamper, Berlin: Teile und Gegenteile – Doppelte Bruchstücke | 41 | ||
| I. | 41 | ||
| II. | 42 | ||
| III. | 43 | ||
| IV. | 44 | ||
| Ernst Peter Fischer, Konstanz: Die Nachtseite der Physik. Wolfgang Paulis Briefwechsel mit Carl Gustav Jung | 47 | ||
| Die Klavierstunde | 49 | ||
| Der Physiker Wolfgang Pauli | 51 | ||
| Eine ungewöhnliche Person ... | 53 | ||
| ... und ihre Spaltungen | 54 | ||
| Zweiteilung | 57 | ||
| Der Pauli-Effekt | 58 | ||
| Träume | 59 | ||
| Archetypus | 60 | ||
| Träume, noch einmal | 61 | ||
| Vollständigkeit | 63 | ||
| Die Coniunctio (Gegensatzvereinigung) | 65 | ||
| Sein oder Nichtsein | 66 | ||
| Reiner Wiehl, Heidelberg: Die Verwirklichung des Unmöglichen. Zum Realitätsproblem in der Pathosophie Viktor von Weizsäckers | 71 | ||
| I. | 72 | ||
| II. | 74 | ||
| III. | 76 | ||
| IV. | 78 | ||
| V. | 81 | ||
| VI. | 83 | ||
| Yoshikazu Ikeda, Takayama: Das Zwischen. Eine Besonderheit des japanischen Denkens | 89 | ||
| I. | 90 | ||
| II. | 92 | ||
| III. | 93 | ||
| IV. | 94 | ||
| V. | 95 | ||
| Rainer-M. E. Jacobi, Essen: Leben im Zwischen. Vorüberlegungen zu einem erkenntniskritischen Verständnis der Gestaltkreislehre Viktor von Weizsäckers | 97 | ||
| I. | 100 | ||
| II. | 104 | ||
| III. | 106 | ||
| IV. | 109 | ||
| V. | 111 | ||
| VI. | 114 | ||
| Günther Pöltner, Wien: Was ist das – ein guter Arzt? Von der Unverzichtbarkeit der Philosophie für die Medizin | 119 | ||
| I. | 119 | ||
| II. | 121 | ||
| III. | 123 | ||
| IV. | 124 | ||
| V. | 126 | ||
| VI. | 128 | ||
| Fritz Hartmann, Hannover: Zur Dialektik von Gesundsein und Kranksein bei Friedrich Nietzsche | 131 | ||
| I. Gesundsein und Kranksein als Grund zum Philosophieren oder als Grund des Philosophierens | 131 | ||
| II. Aktualität der Dialektik von gesund und krank bei Nietzsche | 133 | ||
| III. „Die höhere Vernunft des Leibes“ als Leitfaden zu Gesundbleiben und Gesundwerden | 140 | ||
| IV. Auf dem Wege zu einer höheren, größeren Gesundheit | 143 | ||
| Friedhelm Lamprecht/Martin Sack, Hannover: Was heißt Gesundsein? Salutogenese und Selbstorganisation | 145 | ||
| Sudhir Kakar, Neu Delhi: Gesundheit und Kultur. Heilung in östlicher und westlicher Perspektive | 153 | ||
| I. | 153 | ||
| II. | 157 | ||
| III. | 159 | ||
| IV. | 161 | ||
| V. | 163 | ||
| Christa Wolf, Berlin: Krebs und Gesellschaft | 167 | ||
| I. | 169 | ||
| II. | 170 | ||
| III. | 172 | ||
| IV. | 173 | ||
| V. | 174 | ||
| VI. | 176 | ||
| VII. | 177 | ||
| VIII. | 179 | ||
| Verwendete Literatur | 181 | ||
| Dieter Lenzen, Berlin: Todesverdrängung und Krankheitsbereitschaft. Konsequenzen eines autopoietischen Lebenslaufkonzeptes für die medizinische Versorgung | 183 | ||
| I. | 185 | ||
| II. | 187 | ||
| III. | 193 | ||
| IV. | 195 | ||
| Heinz Stefan Herzka, Zürich: Übergänge sind überall | 197 | ||
| Hinderk M. Emrich, Hannover: Die Wahrnehmung des Anderen. Postmoderne Hyperflexibilität und koevolutive Identitätsbildung | 205 | ||
| I. Einleitung | 205 | ||
| II. Phänomenologie des postmodernen Identitätsverlusts | 206 | ||
| III. Zur Konstitution der interpersonalen Beziehung | 207 | ||
| IV. Zur Konstitution des „Zwischen“ | 210 | ||
| V. Systemtheorie der Koevolution | 211 | ||
| VI. Koevolutive Interpersonalität und Mimesistheorie | 214 | ||
| VII. Interpersonalität und Versprechen | 215 | ||
| Michael Schmidt-Degenhard, Heidelberg: Die psychiatrische Exploration als offenes Feld zwischen Betroffensein und Verstehen | 217 | ||
| I. Klinische Diagnostik aus der Gesprächssituation | 218 | ||
| II. Die Exploration als dialogische Erfahrung | 219 | ||
| III. Die dialektische Dynamik des Verstehens | 220 | ||
| IV. Verstehen und Verständigung in der Explorationssituation | 221 | ||
| V. Einfühlung, Sich-Identifizieren, Beobachtungsdistanzierung und Interpretation als Wirkfaktoren des explorativen Dialogs | 222 | ||
| VI. Ich, Du und Wir in der Situation des Betroffenwerdens | 224 | ||
| VII. Die Wirklichkeit der psychotischen Erlebniswelt und die Grenzen des Verstehens | 226 | ||
| Jürgen Hübner, Heidelberg: Christlicher Glaube, Naturbild und Medizin. Ein Beitrag zur Grundlegung medizinischer Ethik | 229 | ||
| I. Glaube, Weltanschauung und Theologie | 229 | ||
| II. Zum Verstehen des christlichen Glaubens | 232 | ||
| III. Zur Bedeutung des Weltbildes | 238 | ||
| IV. Folgerungen für die Medizin | 242 | ||
| Edition | 247 | ||
| Rainer-M. E. Jacobi, Essen: Viktor von Weizsäcker und Goethe. Einführung zur Edition von „Der Umgang mit der Natur“ | 247 | ||
| 1. Zur Goethe-Rezeption bei Viktor von Weizsäcker | 247 | ||
| 2. „Der Umgang mit der Natur“ – Quellenlage und Textgestalt | 254 | ||
| 3. Zur Bedeutung des Textes | 256 | ||
| Viktor von Weizsäcker/Rainer-M. E. Jacobi (Essen)/Wolfgang Riedel (Berlin / Würzburg): Der Umgang mit der Natur (1949) | 262 | ||
| Buchbesprechungen | 281 | ||
| Kimura, Bin: Zwischen Mensch und Mensch. Strukturen Japanischer Subjektivität. Übersetzt und herausgegeben von Elmar Weinmayr | 281 | ||
| Tellenbach, Hubertus: Schwermut, Wahn und Fallsucht in der abendländischen Dichtung. Hürtgenwald 1992, Guido Pressler-Verlag, 253 S. | 282 | ||
| Lamprecht, Friedhelm/Johnen, Rolf (Hrsg.): Salutogenese – Ein neues Konzept in der Psychosomatik? | 284 | ||
| Zum Naturbegriff der Gegenwart. Kongreßdokumentation zum Projekt „Natur im Kopf“ Stuttgart, 21.–26. Juni 1993, Landeshauptstadt Stuttgart, Kulturamt (Hrsg.) | 285 |
