Die Erstreckung vertraglicher Schuldverhältnisse von der GmbH auf ihre Gesellschafter
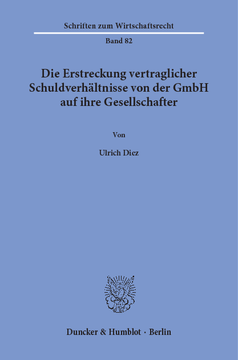
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Die Erstreckung vertraglicher Schuldverhältnisse von der GmbH auf ihre Gesellschafter
Schriften zum Wirtschaftsrecht, Vol. 82
(1994)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Einleitung | 15 | ||
| 1. Teil: Vorhandene Lösungsansätze und deren Standort im System | 22 | ||
| Kapitel 1: Stellungnahmen zur Erstreckung vertraglicher Pflichten | 22 | ||
| 1. Wiedemanns „Vertragszwecklehre" | 22 | ||
| 2. Karsten Schmidts „Vertragsschlußkonzept" | 27 | ||
| 3. Mertens „Auslegungsthese" | 30 | ||
| 4. „Deliktslösung" | 32 | ||
| 5. Die Ansatzpunkte der Rechtsprechung | 34 | ||
| Kapitel 2: Nicht vertragszentrierte Ansätze | 36 | ||
| 1. „Mißbrauchslehren" und „institutionelle Betrachtung" | 36 | ||
| a) Die subjektive Mißbrauchslehre | 36 | ||
| b) Institutionelle Durchgriffslehren | 40 | ||
| c) Objektive Mißbrauchslehre | 43 | ||
| d) Stellungnahme | 44 | ||
| 2. „Leitungsmacht der Gesellschafter und Verantwortung" | 45 | ||
| a) Die These vom Gleichklang von Herrschaft und Haftung | 46 | ||
| b) Die These von der Gesellschaft als autonomem Willenszentrum | 47 | ||
| c) Die These einer Geltung personengesellschaftlicher Zuordnungsregeln für den Realtypus personalistische GmbH | 49 | ||
| d) Stellungnahme | 49 | ||
| Kapitel 3: Zwischenergebnis und Folgerungen für die weitere Untersuchung | 54 | ||
| 2. Teil: Erstreckungsbedarf jenseits gesicherter Rechtsanwendung | 57 | ||
| Kapitel 1: Das Regelungsproblem aus Sicht der Beteiligten | 57 | ||
| 1. Die Interessen der Gesellschaft | 58 | ||
| a) Die „Bestimmungsgrößen" des Gesellschaftsinteresses | 58 | ||
| b) Erstreckung und Gesellschaftsinteressen | 62 | ||
| 2. Interessen der Gesellschafter | 64 | ||
| 3. Das Interesse der Dritt-Gläubiger | 66 | ||
| 4. Das Interesse des begünstigten Gläubigers | 66 | ||
| a) Erstreckungsbedarf aus Gläubigersicht? | 67 | ||
| b) Gestaltungsmöglichkeiten der Beteiligten | 70 | ||
| 5. Relevante Drittinteressen | 73 | ||
| 6. Zusammenfassung | 74 | ||
| Kapitel 2: Der zwischen Gesellschaft und Gläubiger geschlossene Vertrag als Geltungsgrund | 76 | ||
| 1. Das „Verbot drittbelastender Verträge" und die „Relativität der Schuldverhältnisse" als Schranke? | 77 | ||
| a) Zum Gegenstandsgebiet und zur Reichweite dieser Prinzipien | 77 | ||
| b) Gesetzliche Ausnahmen vom Verbot drittbelastender Verträge | 83 | ||
| 2. Ansprüche aufgrund einer „Negation des Trennungsprinzips"? | 85 | ||
| a) Methodische Bedenken | 86 | ||
| aa) Bei Ableitung eines Trennungsprinzips aus der Rechtsfolgenanordnung des § 13 Abs. 2 GmbH | 86 | ||
| bb) Bei einem primär auf die Regelung des § 13 Abs. 1 GmbHG bezogenen Verständnis des Trennungsprinzips | 87 | ||
| b) Sachliche Bedenken | 89 | ||
| c) Zwischenergebnis | 91 | ||
| 3. Konsequenzen für Vertragzweck, Vertragsauslegung und Vertragsumgehung als Begründungsmodi | 91 | ||
| a) Vertragsauslegung | 91 | ||
| b) Vertragsumgehung | 92 | ||
| c) Möglichkeit einer Vertragszwecklehre in Parallele zur Normzwecklehre? | 93 | ||
| d) Verbleibende Möglichkeiten einer Effektuierung des Vertragszwecks | 96 | ||
| Kapitel 3: Anerkannte Verpflichtungsgründe als umfassender Lösungsansatz? | 97 | ||
| 1. Rechtsgeschäftliche Begründung von Pflichten zwischen Gesellschafter und Gläubiger | 97 | ||
| a) Selbstbindung durch Selbsthandeln | 97 | ||
| aa) Bedeutung des Gläubigerinteresse für die Auslegung der ausgetauschten Erklärungen | 99 | ||
| bb) Zwischenergebnis | 103 | ||
| b) Verpflichtung im Wege der Stellvertretung | 103 | ||
| 2. Eigenhaftung des Gesellschafter-Geschäftsführers aus c.i.c. | 105 | ||
| a) Zur Person des Schuldners vorvertraglicher Pflichten | 105 | ||
| aa) Inanspruchnahme besonderen Vertrauens als Verpflichtungsgrund | 106 | ||
| bb) Die Rechtsprechung zur Eigenhaftung aufgrund Eigeninteresses | 106 | ||
| b) Der Umfang einer Erstreckung | 110 | ||
| c) Zwischenergebnis | 112 | ||
| 3. Bindung nach Deliktsrecht | 112 | ||
| a) Die subjektive Tatseite des § 826 BGB | 114 | ||
| b) Das Verdikt der Sittenwidrigkeit | 114 | ||
| aa) Beispielsfälle aus der Rechtsprechung zur Beeinträchtigung der Forderung durch Einwirken auf die Schuldnergesellschaft | 115 | ||
| bb) Wirkbereich der Norm | 118 | ||
| c) Rechtsfolge eines Verstoßes | 119 | ||
| d) Zwischenergebnis | 119 | ||
| 4. Inanspruchnahme aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben? | 120 | ||
| a) Vorgaben und Grenzen aufgrund der bisherigen Ergebnisse | 120 | ||
| b) Verpflichtung der Gesellschafter aufgrund widersprüchlichen Verhaltens | 122 | ||
| aa) Beispielsfälle | 122 | ||
| bb) Argumente für eine Bindung jenseits rechtsgeschäftlicher Verpflichtung | 123 | ||
| cc) Kann das Verbot widersprüchlichen Verhaltens nur Rechte begrenzen? | 126 | ||
| c) Zwischenergebnis | 127 | ||
| 5. Abgeleitete Ansprüche | 128 | ||
| a) Geeignete Innenbindung des Gesellschafters als Voraussetzung | 129 | ||
| b) Pflicht der Gesellschaft zur Übertragung eigener Rechtsmacht | 130 | ||
| c) Grenzen der Übertragbarkeit gesellschaftlicher Ansprüche | 131 | ||
| d) Zwischenergebnis | 133 | ||
| Kapitel 4: Verbliebener Klärungsbedarf | 133 | ||
| 3. Teil: Die „Respektpflicht" der Gesellschafter als Lösungsmodell | 136 | ||
| Kapitel 1: Jedermanns-Pflicht, die praktische Wirksamkeit fremder Forderungen nicht zu beeinträchtigen? | 136 | ||
| 1. Ausgangspunkt der Überlegungen | 136 | ||
| 2. Aktuell vertretene Ansätze | 138 | ||
| a) Die Forderungszuständigkeit als Schutzobjekt des § 823 Abs. 1 BGB | 139 | ||
| b) Anspruch auf obligationsgemäße Willensrichtung des Schuldners | 140 | ||
| c) Verbot der ihrem Zweck nach gegen das Recht gerichteten Handlungen | 141 | ||
| 3. Berechtigung eines allgemeinen StörungsVerbotes? | 142 | ||
| Kapitel 2: Begründung einer Pflicht der Gesellschafter, die Gläubigerforderung nicht zu entwerten | 144 | ||
| 1. Der Geltungsgrund der Respektpflicht | 145 | ||
| a) Besonderheiten in der Beziehung zwischen Gesellschafter und Gesellschaftsgläubiger | 145 | ||
| b) Mittelbares rechtsgeschäftliches Band als „Sonderverbindung" im Sinne des § 242 BGB? | 148 | ||
| c) Besondere Interessenverknüpfung und Interessengefährdung als zusätzliche adressatenreduzierende Kriterien | 152 | ||
| aa) Relevanz dieser Kriterien in anderen Zusammenhängen | 152 | ||
| bb) Funktion dieser Merkmale | 154 | ||
| 2. Inhalt der Loyalitätspflichten des Gesellschafters nach Treu und Glauben — Arten der zu erstreckenden Verbindlichkeiten | 156 | ||
| a) Wettbewerbsverbote | 157 | ||
| aa) Das vertragliche Verbot, persönlich in Wettbewerb zum Gesellschaftsgläubiger zu treten | 157 | ||
| bb) Das Verbot, Dritten Wettbewerbsmöglichkeiten zu eröffnen | 164 | ||
| b) Geheimhaltungspflichten und Verwertungsverbote | 167 | ||
| c) Patentanfechtung | 168 | ||
| d) Ausschließlichkeitsbindungen | 171 | ||
| aa) Erstreckung aufgrund der Respektpflicht? | 173 | ||
| bb) Gemäß § 826 BGB? | 174 | ||
| e) Unvertretbare Handlungen | 174 | ||
| f) Duldungspflicht | 177 | ||
| 3. Voraussetzungen in der Person des Gesellschafters und allgemeine Schranken einer Inanspruchnahme | 179 | ||
| a) Stellung des Gesellschafters in der Gesellschaft | 179 | ||
| b) Fortbestand der Mitgliedschaft als Erfordernis? | 182 | ||
| c) Abdingbarkeit der Erstreckung | 184 | ||
| 4. Erzwingbarkeit der Respektpflicht | 185 | ||
| Kapitel 3: Vereinbarkeit der Respektpflicht mit der Haftungsordnung der GmbH | 189 | ||
| 1. Die Funktion des § 13 Abs. 2 GmbHG aus Sicht des Gesetzgebers | 191 | ||
| 2. Teleologische Gesichtspunkte | 194 | ||
| 3. Folgerungen aus der Existenz eines Haftungsfonds | 196 | ||
| 4. Ergebnis der Prüfung | 197 | ||
| Schluß | 199 | ||
| Literaturverzeichnis | 205 |
