Der grundrechtliche Informationsanspruch des Forschers gegenüber dem Staat
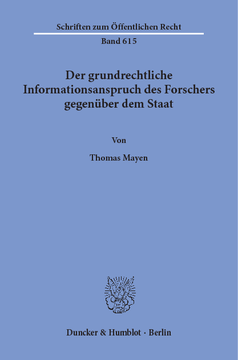
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Der grundrechtliche Informationsanspruch des Forschers gegenüber dem Staat
Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 615
(1992)
Additional Information
Book Details
Pricing
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 20 | ||
| Einleitung | 27 | ||
| § 1 Rechtfertigung des verfassungsrechtlichen Untersuchungsansatzes | 28 | ||
| I. Der tatsächliche Konflikt um den Zugang der Forschung zu staatlichen Daten | 28 | ||
| 1. Der Bedarf der Forschung an staatlichen Daten — einige ausgewählte Beispiele | 28 | ||
| a) Historische Forschung | 29 | ||
| b) Empirische Sozialforschung | 29 | ||
| c) Epidemiologische Forschung | 30 | ||
| 2. Berichte über Forschungsbehinderungen durch Zugangsverweigerung | 31 | ||
| II. Der Schutz des wissenschaftlichen Datenzugangs durch das einfache Recht | 34 | ||
| § 2 Präzisierung der Fragestellung | 37 | ||
| I. Zum Begriff des „Anspruchs" | 37 | ||
| II. Die „Information" als Anspruchsgegenstand | 38 | ||
| 1. Die Unterscheidung von unmittelbarem (direktem) und mittelbarem (indirektem) Informationsanspruch | 38 | ||
| 2. Die Abgrenzung von der Öffentlichkeitsarbeit des Staates | 40 | ||
| III. Die grundrechtlichen Freiheitsverbürgungen als Anspruchsgrundlage | 40 | ||
| IV. Eingrenzungen in bezug auf den Anspruchsverpflichteten | 41 | ||
| V. Präzisierung in bezug auf die Person des Anspruchsberechtigten | 41 | ||
| Erster Teil: Die verfassungsrechtliche Problematik der Fragestellung | 43 | ||
| § 3 Keine unmittelbare Verbürgung eines Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 43 | ||
| § 4 Der Stand von Rechtsprechung und Schrifttum | 45 | ||
| I. Die ablehnende Haltung in der Rechtsprechung | 45 | ||
| 1. Der „typische" Argumentationsverlauf | 46 | ||
| a) Die gemeinsamen Prämissen | 46 | ||
| aa) Die Forschungsfreiheit als maßgeblicher verfassungsrechtlicher Anknüpfungspunkt | 46 | ||
| bb) Der Informationsanspruch als Problem originärer grundrechtlicher Leistungsansprüche | 47 | ||
| cc) Die Doppelnatur des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Abwehrrecht und als objektive Wertentscheidung | 47 | ||
| b) Die Argumente gegen die Anerkennung des Informationsanspruchs | 48 | ||
| aa) Die restriktive Position des Bundesverwaltungsgerichts: nur Anspruch auf derivative Teilhabe am Wissenschaftsbetrieb | 49 | ||
| bb) Das Kriterium der Unerläßlichkeit der staatlichen Informationsleistung | 50 | ||
| cc) Keine Sonderrolle des Staates beim Informationsanspruch | 51 | ||
| dd) Die Grundrechte anderer | 52 | ||
| 2. Abweichende Argumentationsmuster | 52 | ||
| II. Der Meinungsstand im Schrifttum | 53 | ||
| 1. Die Gegner eines Informationsanspruchs zu Forschungszwecken — Argumente | 54 | ||
| a) Die Unbestimmtheit im Anspruchsobjekt | 54 | ||
| b) Der Vorbehalt des Möglichen | 55 | ||
| c) Die Beschränkung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG auf die traditionellen Dimensionen der allgemeinen Informationsfreiheit | 55 | ||
| 2. Die Befürworter eines prinzipiellen Informationsanspruchs zu Forschungszwecken gegenüber dem Staat | 56 | ||
| a) Der „traditionelle" Ansatz: Die Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Grundlage eines Leistungsrechts auf Information zu Forschungszwecken | 58 | ||
| b) Der „ParadigmenWechsel": Alternativen zum verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt und zur leistungsrechtlichen Konstruktion | 60 | ||
| aa) Alternativen im verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt | 60 | ||
| bb) Der Informationsanspruch als Reaktion auf den abwehrrechtlichen Gehalt des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 61 | ||
| § 5 Bilanz und kritische Würdigung | 63 | ||
| I. Zur Frage originärer Leistungsrechte bei Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 63 | ||
| 1. Die Eignung der „Wertentscheidung" des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Grundlage eines originären Leistungsanspruchs | 64 | ||
| 2. Begründungsdefizite bei der Handhabung des Merkmals der „Unerläßlichkeit" | 65 | ||
| II. Berechtigung der Einordnung des Informationsanspruchs als Problem grundrechtlicher Leistungsansprüche | 65 | ||
| III. Unklarheiten über das Verhältnis von Wissenschaftsfreiheit und Informationsfreiheit | 70 | ||
| 1. Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als thematisch einschlägiges Grundrecht? | 71 | ||
| 2. Sperrwirkungen aus dem Grundrecht der Informationsfreiheit? | 74 | ||
| § 6 Konsequenzen und Fortgang der Untersuchung | 74 | ||
| I. Die Notwendigkeit der Erweiterung der Fragestellung gegenüber dem bisher typischen Argumentationsablauf | 74 | ||
| II. Zur Rolle der Grundrechtstheorie | 75 | ||
| 1. Grundrechtstheorie als notwendige Offenlegung des Vorverständnisses bei der Grundrechtsinterpretation | 76 | ||
| 2. Grundrechtstheorie als „Deduktionsprinzip"? | 77 | ||
| 3. Konsequenzen | 78 | ||
| III. Zum Fortgang der Untersuchung | 79 | ||
| Zweiter Teil: Der Anspruch auf Information zu Forschungszwecken durch den Staat als Gewährleistungsdimension der Wissenschaftsfreiheit | 80 | ||
| Erstes Kapitel: Die Wissenschaftsfreiheit als thematisch primär einschlägiges Grundrecht | 80 | ||
| § 7 Die wissenschaftliche Informationsfreiheit als Bestandteil der Wissenschaftsfreiheit: Zum Verhältnis von Wissenschaftsfreiheit und Informationsfreiheit | 81 | ||
| I. Vorgaben im Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 85 | ||
| II. Das Prinzip der Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft als zentrale Auslegungsmaxime für Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 85 | ||
| 1. Der Inhalt des Prinzips der Eigengesetzlichkeit | 86 | ||
| 2. Die Begründung des Prinzips der Eigengesetzlichkeit | 87 | ||
| a) Die Unabgeschlossenheit und Vielgestaltigkeit des tatsächlichen Phänomens „Wissenschaft" | 87 | ||
| b) Die bewußte Respektierung der Vielgestaltigkeit und Unabgeschlossenheit der Wissenschaft durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 88 | ||
| 3. Die Ausklammerung der „Vorarbeiten" als Verstoß gegen das Verbot staatlichen Wissenschaftsrichtertums | 89 | ||
| III. Keine Notwendigkeit zur Ausklammerung der Vorarbeiten aus dem Gesichtspunkt hinreichender Abgrenzbarkeit des Normbereichs von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 92 | ||
| 1. Zur Notwendigkeit positiver Abgrenzung | 92 | ||
| 2. Untauglichkeit der Konkretisierung nach Gattungstypen | 93 | ||
| 3. Die Einordnung in den wissenschaftlichen Denk- und Handlungskomplex | 94 | ||
| a) Eckdaten für eine Präzisierung der Begriffe „Wissenschaft" und „Forschung" | 95 | ||
| aa) Die Unbrauchbarkeit materialer im Sinne von wertender Begriffsbestimmung | 95 | ||
| bb) Kein (außerwissenschaftliches) Definitionsverbot | 95 | ||
| cc) Zum Ziel eines „neutralen" Wissenschaftsbegriffs | 98 | ||
| b) Versuch einer Begriffsbestimmung | 99 | ||
| aa) Wahrheitsfindung und Erkenntnis als Ziel | 100 | ||
| bb) Versuch | 101 | ||
| cc) Methodengeleitetheit des Strebens um Erkenntnis | 102 | ||
| dd) Nachprüfbarkeit des Vorgehens | 103 | ||
| ee) Das Bemühen um Einfügung in übergeordnete Gesetzmäßigkeiten | 103 | ||
| c) Die Einordnung in den wissenschaftlichen Denk- und Handlungskomplex als Kriterium zur Abgrenzung zwischen wissenschaftlicher und nicht-wissenschaftlicher Informationsbeschaffung | 104 | ||
| IV. (Zwischen-)Ergebnis | 105 | ||
| § 8 Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als lex specialis für den Schutz der wissenschaftlich benötigten Informationen | 105 | ||
| I. Keine Verdrängung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG im Falle der Existenz eines allgemeinen Informationsanspruchs | 106 | ||
| II. Keine Sperrwirkung des Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. GG | 106 | ||
| 1. Keine Anhaltspunkte im Wortlaut des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 106 | ||
| 2. Fehlende Überzeugungskraft der Gegenargumente | 107 | ||
| a) Das Argument der fehlenden Abgrenzbarkeit | 107 | ||
| b) Das Privilegierungs-Argument | 108 | ||
| § 9 Ergebnis des ersten Kapitels und Fortgang der Untersuchung | 109 | ||
| Zweites Kapitel: Der Informationsanspruch zu Forschungszwecken als Folge der abwehrrechtlichen Seite des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 111 | ||
| § 10 Zur Bedeutung der abwehrrechtlichen Dimension des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 112 | ||
| I. Zur thematischen Reichweite des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Abwehrrecht | 112 | ||
| II. Der Abwehranspruch als Bestandteil der abwehrrechtlichen Dimension des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 | 113 | ||
| §11 Ansatzmöglichkeiten für eine abwehrrechtliche Begründung des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 115 | ||
| I. Allgemeine Voraussetzungen für die Eröffnung des grundrechtlichen Abwehranspruchs | 115 | ||
| 1. Unbeachtlichkeit der äußeren Form des beanspruchten staatlichen Verhaltens | 115 | ||
| 2. Der Grundrechtseingriff als Mindestvoraussetzung | 115 | ||
| 3. Grundrechtseingriff und Grundrechtsverletzung — zur Bedeutung der Rechtswidrigkeit des Grundrechtseingriffs | 116 | ||
| a) Die Unterscheidung von Schutzbereich und effektivem Garantiebereich der Grundrechte | 116 | ||
| aa) Der grundrechtliche Schutzbereich | 117 | ||
| bb) Der effektive Garantiebereich | 118 | ||
| b) Die Bedeutung von Grundrechtseingriff und Grundrechtsverletzung für den Abwehranspruch | 119 | ||
| II. Begründungsanforderungen für eine abwehrrechtliche Konstruktion des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 119 | ||
| 1. Zum Begriff des Grundrechtseingriffs | 120 | ||
| a) Der traditionelle Eingriffsbegriff | 120 | ||
| b) Die Ausweitung des traditionellen Eingriffsbegriffs | 122 | ||
| aa) Die Ausdehnung auf sog. faktische und mittelbare Grundrechtseingriffe | 122 | ||
| bb) Unterlassen als Grundrechtseingriff | 123 | ||
| 2. Drei denkbare Ansätze für eine abwehrrechtliche Begründung des Informationsanspruchs | 125 | ||
| a) Das Unterlassen der Informationsgewährung als Grundrechtseingriff | 125 | ||
| b) Die Informationsverweigerung als faktisches (indirektes) Forschungsverbot | 125 | ||
| c) Die Informations-"Leistung" als Beseitigung eines vorausgegangenen Verbots wissenschaftlicher Eigeninformation | 126 | ||
| (Zwischen-)Ergebnis | 128 | ||
| § 12 Problemabschichtung: Nicht-tragfähige Begründungsansätze | 128 | ||
| I. Das Unterlassen der Information als Grundrechtseingriff | 128 | ||
| 1. Unterlassen als Grundrechtseingriff — eine nur nominell abwehrrechtliche Konzeption | 129 | ||
| 2. Beibehaltung der grundsätzlichen Trennung von Abwehr- und Leistungsanspruch | 130 | ||
| Ergebnis | 132 | ||
| II. Die Informationsverweigerung als faktisches Forschungsverbot? | 132 | ||
| § 13 Berechtigung der abwehrrechtlichen Konstruktion für die Fälle des indirekten Informationsanspruchs | 134 | ||
| I. Die Schlüssigkeit des Konzepts | 136 | ||
| 1. Die (indirekte) Informationsgewährung als abwehrrechtlich gebotene Störungsbeseitigung | 136 | ||
| 2. Mögliche Einwände | 137 | ||
| a) Die Behörde oder der Gesetzgeber als Anspruchsgegner? | 138 | ||
| b) Der grundsätzliche Spielraum des Staates bei der Erfüllung der Beseitigungspflicht | 139 | ||
| c) Untrennbare Verbindung zwischen direkter und indirekter Information? | 140 | ||
| d) Informationsanspruch und Gesetzesvorbehalt | 142 | ||
| (Zwischen-)Ergebnis | 145 | ||
| II. Berechtigung der Prämisse | 145 | ||
| 1. Die Problematik der Prämisse | 146 | ||
| a) Die Eigeninformation aus staatlichen Datenbeständen als Sonderform der Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Sachen | 147 | ||
| b) Die überwiegend leistungsrechtliche Betrachtungsweise für die Fälle der Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Sachen | 148 | ||
| c) Die Gründe für die Zurückweisung abwehrrechtlicher Konstruktionen für die Fälle der Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Sachen | 151 | ||
| aa) Natürliche Freiheit oder staatlich geschaffenes Recht? | 152 | ||
| bb) Die fehlende Einwilligung des öffentlichen Sachherrn | 152 | ||
| cc) Das „Wann" und „Wo" der Freiheitsbetätigung | 153 | ||
| dd) Das Argument der Anstaltsgewalt | 154 | ||
| 2. Stellungnahme | 155 | ||
| a) Ist die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Sachen als Ausübung „natürlicher" Freiheit darstellbar? | 155 | ||
| aa) Die Unerheblichkeit des staatlichen Zulassungsaktes für die Frage der „natürlichen" Freiheit | 156 | ||
| bb) „Natürliche" Freiheit als voraussetzungslose Freiheit? | 157 | ||
| (Zwischen-)Ergebnis: | 160 | ||
| b) Begrenzung des Schutzbereichs auf „erlaubte" Nutzungen? | 161 | ||
| aa) Das zugrundeliegende Konzept einer engen Tatbestandstheorie | 161 | ||
| (1) Allgemeine grundrechtsdogmatische Konzepte | 161 | ||
| (2) Enge Tatbestandskonzeptionen speziell für Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 162 | ||
| (a) Die Position von Pieroth / Schlink | 162 | ||
| (b) Die Position von Lerche | 163 | ||
| (c) Die Position von Wahl | 164 | ||
| (3) Bedeutung für die Fälle des indirekten Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 165 | ||
| bb) Die Gegenkonzeption eines weiten Tatbestandskonzepts | 165 | ||
| cc) Kritik und Stellungnahme | 166 | ||
| (1) Die allgemeine Rechtsordnung als Grenze des grundrechtlichen Schutzbereichs bei Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG? | 167 | ||
| (2) Verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen Dritter als Grenze des grundrechtlichen Schutzbereichs? | 169 | ||
| (3) Zur Sonderposition von Wahl | 173 | ||
| Ergebnis | 173 | ||
| c) Zur Möglichkeit der Ausgrenzung des „Wann" und „Wo" der Freiheitsbetätigung aus dem grundrechtlichen Schutzbereich | 173 | ||
| aa) Friedrich Müllers „Theorie der sachspezifischen Modalitäten" | 174 | ||
| bb) Würdigung | 176 | ||
| Ergebnis | 178 | ||
| d) Keine Einengung des grundrechtlichen Schutzbereichs unter dem Gesichtspunkt des „besonderen Gewaltverhältnisses" | 178 | ||
| 3. (Zwischen-)Ergebnis | 179 | ||
| III. Zusammenfassung der Ergebnisse von § 13 | 180 | ||
| § 14 Voraussetzungen und Schranken des (indirekten) Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 181 | ||
| I. Die Voraussetzungen des indirekten Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 181 | ||
| 1. Information durch aktive Informationsbeschaffung | 182 | ||
| 2. Die Einfügung der Informationsbeschaffung in ein konkretes Forschungsvorhaben | 182 | ||
| 3. Keine Einschränkungen in Hinblick auf die Person des Anspruchsberechtigten | 182 | ||
| II. Die Schranken des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken bei Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 184 | ||
| 1. Zu den Schranken der Forschungsfreiheit im allgemeinen | 184 | ||
| 2. Die Schranken des aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG abgeleiteten Informationsanspruchs | 190 | ||
| a) Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung | 191 | ||
| aa) Inhalt und Schranken | 192 | ||
| bb) Kollisionsfälle | 193 | ||
| (1) Scheinkollisionen | 193 | ||
| (a) Anonymisierung als Grenze des Schutzbereichs | 193 | ||
| (b) Die Einwilligung als Schutzbereichsgrenze | 196 | ||
| (c) Kein Schutz für bestimmte Datenarten? | 199 | ||
| (2) Fälle „echter" Kollision zwischen Forschungsfreiheit und informationeller Selbstbestimmung | 199 | ||
| cc) Einige Leitlinien zur Kollisionslösung | 200 | ||
| (1) Das Gefahrenpotential für den Betroffenen | 200 | ||
| (a) Der Verwendungszusammenhang als Indikator für das zu erwartende Gefahrenpotential | 201 | ||
| (b) Besonderheiten des Verwendungszwecks beim Informationszugriff zu Forschungszwecken | 202 | ||
| (c) Hypothetische Verwendungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten | 204 | ||
| (d) Die Mißbrauchsgefahr | 204 | ||
| (e) Die Sensibilität der Daten als abwägungsrelevanter Gesichtspunkt? | 206 | ||
| (2) Das Ausmaß der Behinderung des Forschungsvorhabens | 207 | ||
| (3) Die Bedeutung eines Forschungsvorhabens für die Allgemeinheit | 208 | ||
| (4) Zur Rolle des Gesetzesvorbehalts | 210 | ||
| b) Die Sicherheit des Staates als Schranke des Informationsanspruchs | 210 | ||
| c) Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung als Schranke des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 212 | ||
| d) Die Bestimmungsbefugnis des Staates über seine Datenbestände als Schranke des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 214 | ||
| Ergebnis | 217 | ||
| Drittes Kapitel: Der Informationsanspruch zu Forschungszwecken als Folge leistungsrechtlicher Gehalte des Art. 5 Abs. 3 Satz I GG? | 218 | ||
| § 15 Die Information zu Forschungszwecken als „Leistung" | 218 | ||
| I. Die Beschränkung der leistungsrechtlichen Problematik auf die Fälle der direkten Information | 218 | ||
| 1. Zum Begriff des „Leistungsanspruchs" | 218 | ||
| 2. Konsequenzen für die Einordnung des Informationsanspruchs zu Forschungszwecken | 219 | ||
| II. Weitere Eingrenzungen | 220 | ||
| 1. Der Informationsanspruch als materieller Leistungsanspruch i.e.S. | 221 | ||
| 2. Originärer oder derivativer Leistungsanspruch? | 222 | ||
| § 16 Die besondere Problematik eines „Leistungsrechts auf staatliche Information zu Forschungszwecken" | 224 | ||
| I. Die allgemeine Fragestellung | 225 | ||
| II. Rechtsprechung und Schrifttum im Überblick | 225 | ||
| 1. Der Stand der Diskussion um die leistungsrechtliche Seite der Wissenschaftsfreiheit | 226 | ||
| a) Das Hochschul-Urteil des Bundesverfassungsgerichts | 226 | ||
| b) Die zurückhaltende Rezeption der Entscheidung | 228 | ||
| 2. Die allgemeine Diskussion um die Leistungsrechte | 229 | ||
| a) Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 229 | ||
| b) Die Stellungnahmen im Schrifttum | 230 | ||
| III. Die Schwierigkeiten einer Begründung grundrechtlicher Leistungsansprüche | 232 | ||
| 1. Die Unterscheidung zwischen der Realisierung von Freiheit als Staatsaufgabe und als Anspruchsgegenstand | 232 | ||
| 2. Sachliche Bedenken | 235 | ||
| a) Die spezifische Unbestimmtheit verfassungsunmittelbarer Leistungsansprüche | 235 | ||
| b) Die Knappheit der staatlich verfügbaren Mittel | 238 | ||
| c) Die Unvereinbarkeit mit der Freiheit des Leistungsempfängers | 240 | ||
| 3. Zum Stellenwert der Schwierigkeiten | 240 | ||
| 4. (Zwischen) Ergebnis | 242 | ||
| IV. Konsequenzen für den Informationsanspruch zu Forschungszwecken | 243 | ||
| 1. Modifikation der leistungsrechtlichen Problematik beim Informationsanspruch zu Forschungszwecken | 243 | ||
| a) Die prinzipielle Verfügbarkeit der Ressource „Information" | 243 | ||
| b) Bestimmtheitsprobleme | 244 | ||
| aa) Keine ausreichende Festlegung der Art der zur Gewährleistung realer Forschungsfreiheit einzusetzenden Mittel | 245 | ||
| bb) Unbestimmtheit des Anspruchsobjekts „Information"? | 247 | ||
| cc) Zusammenfassung | 247 | ||
| 2. Begründungsanforderungen für die Ableitung eines Informationsanspruchs aus der Wissenschaftsfreiheit | 247 | ||
| V. Zum Fortgang der Untersuchung | 249 | ||
| § 17 Der objektiv-rechtliche Gehalt des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als Grundlage eines Leistungsrechts auf Information zu Forschungszwecken | 250 | ||
| I. Inhalt und Eigenart des objektiv-rechtlichen Grundrechtsgehalts | 251 | ||
| 1. Der objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalt als normierter Inhalt der Grundrechtsbestimmung | 252 | ||
| 2. Inhalt und Wirkungsweise: Der objektiv-rechtliche Gehalt der Grundrechtsbestimmungen als verbindliche Grundentscheidung für das jeweils grundrechtlich geschützte Rechtsgut | 253 | ||
| a) Allgemeines | 253 | ||
| b) Die Pflicht zur Gewährleistung realer Freiheit im besonderen | 255 | ||
| II. Die Eignung des objektiv-rechtlichen Gehalts der Grundrechtsbestimmungen als Grundlage eines Leistungsanspruchs auf Information zu Forschungszwecken | 256 | ||
| 1. Bedingungen für die Begründung eines solchen Leistungsanspruchs | 256 | ||
| a) Die prinzipielle Offenheit und Unbestimmtheit des objektivrechtlichen Gehalts der Grundrechtsbestimmungen | 257 | ||
| b) Die Frage der Subjektivierbarkeit des objektiv-rechtlichen Gehalts der Grundrechtsbestimmungen | 258 | ||
| c) Zum Verhältnis beider Voraussetzungen zueinander | 260 | ||
| 2. Zur Möglichkeit einer Präzisierung des objektiv-rechtlichen Gehalts der Wissenschaftsfreiheit | 261 | ||
| a) Bedingungen einer Präzisierung | 261 | ||
| b) Erste Möglichkeit: Staatliche Pflicht zur Gewährleistung eines Optimums freier Forschungstätigkeit (sog. Optimalstandard)? | 262 | ||
| c) Zweite Möglichkeit: Verpflichtung des Staates zur Herstellung eines (absoluten) Mindeststandards freier Forschung | 269 | ||
| d) Dritte Möglichkeit: Staatliche Verpflichtung zur Herstellung eines bestimmten qualitativen und / oder quantitativen Zustands von Forschung | 270 | ||
| III. Ergebnis | 273 | ||
| § 18 Das Leistungsrecht auf Information zu Forschungszwecken als Folge einer in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG verankerten Einrichtungsgarantie? | 274 | ||
| I. Der Zusammenhang zwischen Leistungsrechten und Einrichtungsgarantien | 274 | ||
| 1. Rechtsprechung und Schrifttum im Überblick | 274 | ||
| 2. Zum Begriff der Einrichtungsgarantie | 277 | ||
| a) Berechtigung der „klassischen" Bedeutung der Einrichtungsgarantien | 277 | ||
| b) Ablehnung der erweiternden Konzeptionen | 279 | ||
| aa) Ablehnung eines institutionellen Grundrechtsverständnisses | 279 | ||
| bb) Keine Ausdehnung der Garantieobjekte auf gesellschaftliche Sachverhalte | 281 | ||
| cc) Keine Erweiterung der Einrichtungsgarantien auf künftig zu schaffende Garantieobjekte | 282 | ||
| 3. Konsequenzen für den Zusammenhang von Einrichtungsgarantien und Leistungsansprüchen | 282 | ||
| II. Der Informationsanspruch zu Forschungszwecken als Institutionsgewährleistungsanspruch? | 283 | ||
| 1. Die in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierte Einrichtung | 283 | ||
| 2. Die Information als notwendiges Mittel der Funktionsgewährleistung? | 284 | ||
| III. Ergebnis | 285 | ||
| § 19 Das Leistungsrecht auf Information zu Forschungszwecken als Folge eines Zusammenspiels von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG mit dem Demokratieprinzip? | 285 | ||
| I. Das Demokratiegebot als Grundlage einer durch Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG subjektivierten Informationspflicht | 286 | ||
| 1. Die unbestreitbaren Bezüge des Demokratiegebots zur Öffentlichkeit des Staatshandelns | 287 | ||
| 2. Die fehlende Gleichsetzung von Öffentlichkeit und Informationsanspruch | 288 | ||
| II. Demokratisch-funktionale Auslegung des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG | 289 | ||
| 1. „Vorbilder" bei den Befürwortern eines Informationsanspruchs der Presse | 289 | ||
| 2. Übertragbarkeit auf die Wissenschaftsfreiheit? | 290 | ||
| 3. Kann diese Argumentation einen konkreten Anspruch auf direkte Information begründen? | 291 | ||
| § 20 Die Verbindung von Wissenschaftsfreiheit und Sozialstaatsprinzip als Grundlage? | 291 | ||
| § 21 Das Leistungsrecht auf Information zu Forschungszwecken als Folge einer „öffentlichen Aufgabe" der Wissenschaft? | 292 | ||
| I. Wissenschaft als „öffentliche Aufgabe" | 293 | ||
| II. Die „öffentliche Aufgabe" als anspruchsbegründende normative Rechtsfigur? | 293 | ||
| Zusammenfassung der Ergebnisse des 3. Kapitels | 295 | ||
| Dritter Teil: Weitere Anspruchsgrundlagen | 296 | ||
| § 22 Zensurverbot und Petitionsrecht | 297 | ||
| I. Das Zensurverbot (Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG) | 297 | ||
| II. Das Petitionsrecht (Art. 17 GG) | 298 | ||
| § 23 Die Informationsfreiheit als Grundlage eines Informationsanspruchs zu Forschungszwecken? | 299 | ||
| I. Die Offenheit der Informationsfreiheit für den Informationszweck „Forschung" | 299 | ||
| II. Vorrang des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG für die Fälle des indirekten Informationsanspruchs | 300 | ||
| III. Die Informationsfreiheit als Grundlage eines direkten Informationsanspruchs zu Forschungszwecken? | 301 | ||
| 1. Keine Begründung eines Auskunftsanspruchs durch den Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. GG | 302 | ||
| 2. Anhaltspunkte für eine rein abwehrrechtliche Konzeption der Informationsfreiheit in der Entstehungsgeschichte | 304 | ||
| 3. Zur Möglichkeit eines Auskunftsanspruchs als ungeschriebenem Bestandteil des Normbereichs von Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. GG | 305 | ||
| a) Zum Stellenwert von Wortlaut und Entstehungsgeschichte | 305 | ||
| b) Bedingungen für die Anerkennung einer leistungsrechtlichen Seite des Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. GG | 306 | ||
| c) Zum Merkmal der „allgemein zugänglichen Quellen" | 307 | ||
| d) Gründe gegen die Ableitung eines auf Auskunfterteilung gerichteten Leistungsanspruchs aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. GG | 309 | ||
| IV. Ergebnis | 310 | ||
| § 24 Die Meinungsfreiheit als Grundlage eines Informationsanspruchs zu Forschungszwecken? | 310 | ||
| Gesamtergebnis des dritten Teils | 312 | ||
| Vierter Teil: Zusammenfassung und Ergebnisse der Untersuchung | 313 | ||
| Literaturverzeichnis | 317 | ||
| Stichwortverzeichnis | 347 |
