Elemente der ökonomischen Raumstruktur
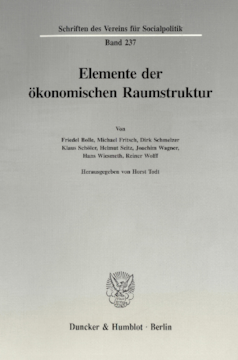
BOOK
Cite BOOK
Style
Format
Elemente der ökonomischen Raumstruktur
Editors: Todt, Horst
Schriften des Vereins für Socialpolitik, Vol. 237
(1995)
Additional Information
Book Details
Abstract
Der vorliegende Sammelband gibt einige Vorträge wieder, die anläßlich der Sitzung des Regionalwissenschaftlichen Ausschusses im Herbst 1993 in Freiberg (Sachsen) gehalten wurden. Dieses Gremium versucht, alle im deutschsprachigen Raum aktiven Forscher auf dem Gebiet der regionalen Ökonomik an einen Tisch zu bringen, um die einschlägige Diskussion voranzubringen. Die Zusammenkunft stand nicht unter einem Motto; es gab kein Generalthema und es gab auch kein Raster von Themen, auf das sich der Ausschuß eingeengt hätte. Vielmehr haben Mitglieder und einschlägig interessierte Gäste aus ihrer Arbeit berichtet.Diese Konzeption hat Vor- und Nachteile. Es darf einerseits nicht erwartet werden, daß alle wichtigen oder aktuellen Felder der Regionalwissenschaft vertreten sind, noch kann die Auswahl unter irgendeinem relevanten Aspekt repräsentativ sein; auch engere Teilgebiete sind so nicht systematisch zu erfassen. Andererseits darf man hoffen, daß die Fachvertreter genau die Themen behandeln, die sie selbst zur Zeit für wichtig halten; ein Optimist mag hoffen, daß dies auch das tatsächlich Wichtige sei. Eine solche Hoffnung gab auch den Ausschlag für den gewählten Weg: Es soll eine Momentaufnahme von Forschungsaktivitäten sein.Entsprechend heterogen war das Ergebnis. Verschiedene Ansätze, die durchaus auch differierende Positionen repräsentieren, sind in diesem Band zusammengefaßt. Sie reichen von strikt theoretischen Untersuchungen zu Überblicksarbeiten, von empirischen zu wirtschaftspolitischen Diskussionen.Einen rein theoretischen Vortrag hielt Hans Wiesmeth über lokale und regionale öffentliche Güter, die in einem geschlossenen Modell diskutiert werden. Er verband seine Überlegungen mit einem Plädoyer für Lindahl-Gleichgewichte. Klaus Schöler erlaubte einen Einblick in seine laufenden Untersuchungen zum Thema räumlicher Preistechniken. Reiner Wolff berichtete aus seiner Arbeit über genetische Algorithmen zur Lösung von Transport- und Rundreiseproblemen, ein Be
